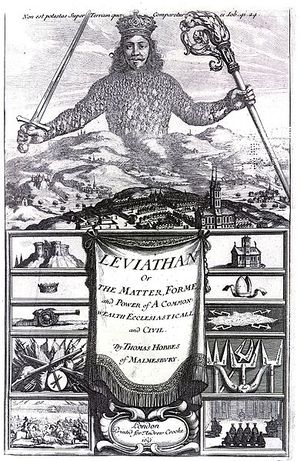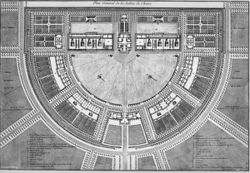« Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen » : différence entre les versions
| Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
[[Fichier:Clausewitz.jpg|vignette|200px|droite|Carl von Clausewitz.]] | [[Fichier:Clausewitz.jpg|vignette|200px|droite|Carl von Clausewitz.]] | ||
Carl von Clausewitz, | Carl von Clausewitz, ein preußischer Offizier aus dem frühen 19. Jahrhundert, spielte eine entscheidende Rolle bei der Theoretisierung des Krieges. Er verfasste das Werk "Vom Kriege" (Vom Kriege auf Deutsch), das zu einem der einflussreichsten Texte über Militärstrategie und Kriegstheorie wurde. | ||
Carl von Clausewitz | Carl von Clausewitz diente während der Napoleonischen Kriege, die von 1803 bis 1815 stattfanden, in der preußischen Armee. Während dieser Zeit sammelte er wertvolle Erfahrungen im Kampf und in der Militärstrategie, die seine Kriegstheorien beeinflussten. Clausewitz nahm an mehreren großen Schlachten gegen Napoleons Armee teil und wurde Zeuge der dramatischen Veränderungen in der Art und Weise, wie Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts geführt wurden. Während dieser Zeit begann er, seine Theorie zu entwickeln, dass der Krieg eine Erweiterung der Politik ist. Nach dem Ende der napoleonischen Kriege diente Clausewitz weiterhin in der preußischen Armee und begann, sein Hauptwerk "Vom Kriege" zu verfassen. Er starb jedoch, bevor er das Werk fertigstellen konnte, das posthum von seiner Frau veröffentlicht wurde. | ||
Clausewitz | Clausewitz behauptete, dass der Krieg "die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" sei. Dieses wohl bekannteste Zitat von Clausewitz drückt den Gedanken aus, dass der Krieg ein Instrument der nationalen Politik ist und dass militärische Ziele von politischen Zielen geleitet werden müssen. Mit anderen Worten: Der Krieg ist ein politisches Instrument und kein Selbstzweck. Clausewitz' Denken betont auch die Bedeutung des "Nebels des Krieges" und der "Reibung" bei der Durchführung von Militäroperationen. Er argumentiert, dass der Krieg von Natur aus unsicher und unvorhersehbar ist und dass Kommandanten und Strategen in der Lage sein müssen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Trotz seines Todes im Jahr 1831 übte Clausewitz' Denken weiterhin einen großen Einfluss auf die Militär- und Strategietheorie aus. Seine Werke werden an Militärakademien auf der ganzen Welt studiert und bleiben eine unverzichtbare Referenz im Bereich der Militärstrategie. | ||
Clausewitz | Clausewitz definiert Krieg als einen Gewaltakt, der den Gegner dazu zwingen soll, unseren Willen auszuführen. Dies ist ein sehr rationaler Rahmen, es handelt sich nicht um die Logik eines "Kriegsverrückten". Der Krieg wird geführt, um etwas zu erreichen. Carl von Clausewitz hat den Krieg als einen Gewaltakt konzeptualisiert, dessen Ziel es ist, den Gegner zu zwingen, unseren Willen auszuführen. Seiner Meinung nach ist der Krieg kein irrationales oder chaotisches Unterfangen, sondern vielmehr ein Instrument der Politik, ein rationales Mittel zur Verfolgung der Ziele eines Staates. In seinem Hauptwerk "Vom Kriege" entwickelt Clausewitz diesen Gedanken weiter, indem er feststellt, dass der Krieg lediglich die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Das heißt, Staaten setzen den Krieg ein, um politische Ziele zu erreichen, die sie mit friedlichen Mitteln nicht durchsetzen können. | ||
Stellen wir uns einen Staat vor, der eine Regierung mit dem Ziel ist, fruchtbares Land zu erwerben, um seine Wirtschaft oder seine Ernährungssicherheit zu verbessern. Da sein Nachbar nicht bereit ist, dieses Land freiwillig abzutreten, entscheidet sich der Staat für den Einsatz von Krieg, um sein Ziel zu erreichen. Wenn der kriegsführende Staat siegreich ist, wird wahrscheinlich ein Friedensvertrag geschlossen, der die Landübertragung offiziell festschreibt. Dieser Vertrag könnte auch andere Bestimmungen enthalten, z. B. Kriegsentschädigungen, Regelungen für vertriebene Bevölkerungsgruppen und das Versprechen, in Zukunft keine Aggressionen zu zeigen. Das ursprüngliche Ziel (der Erwerb von fruchtbarem Land) wird also mithilfe von Krieg erreicht, der als politisches Instrument eingesetzt wird. | |||
Diese von Clausewitz geprägte Auffassung von Krieg macht deutlich, dass der Krieg eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. In diesem Zusammenhang wird der Krieg als ein Werkzeug der Politik betrachtet, eine Option, die eingesetzt werden kann, wenn andere Methoden wie Diplomatie oder Handel bei der Lösung von Konflikten zwischen Staaten versagt haben. | |||
Es ist entscheidend zu verstehen, dass der Krieg nach Clausewitz keine eigenständige Einheit ist, sondern vielmehr ein Instrument der Politik, das von den politischen Behörden kontrolliert und gesteuert wird. Das heißt, dass sowohl die Entscheidung, einen Krieg zu erklären, als auch die Verwaltung und Führung des Krieges in der Verantwortung der politischen Führer liegen. Die militärischen Ziele sind somit den politischen Zielen untergeordnet. Im clausewitzschen Denken ist der Krieg ein Mittel, um politische Ziele zu erreichen, die mit anderen Methoden nicht erreicht werden können. Er wird jedoch immer als vorübergehende Lösung und nicht als Dauerzustand betrachtet. Der Krieg ist also kein Zweck an sich, sondern ein Mittel zum Zweck: das vom Staat definierte politische Ziel. Sobald dieses Ziel erreicht ist oder wenn es nicht mehr möglich ist, es zu erreichen, endet der Krieg und man kehrt zu einem Zustand des Friedens zurück. Aus diesem Grund ist der Begriff des Friedens untrennbar mit dem des Krieges verbunden: Der Krieg zielt darauf ab, einen neuen, für den Staat, der ihn führt, günstigeren Friedenszustand zu schaffen. | |||
== | == Das westfälische System == | ||
Das Westfälische System, benannt nach dem Westfälischen Friedensvertrag, der 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete, hat die internationale politische Struktur und das Verständnis von Krieg tiefgreifend beeinflusst. Diese Reihe von Verträgen verankerte den Begriff der staatlichen Souveränität und legte die Vorstellung fest, dass jeder Staat die ausschließliche Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung ohne Einmischung von außen besitzt. Damit formalisierte es auch die Idee der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Was den Krieg betrifft, so hat das westfälische System dazu beigetragen, ihn als eine Aktivität zwischen Staaten und nicht zwischen Fraktionen oder Individuen zu formalisieren. Es förderte auch die Entwicklung von Regeln und Normen für die Kriegsführung, obwohl dieser Prozess erst in den folgenden Jahrhunderten mit der Entwicklung des humanitären Völkerrechts so richtig in Schwung kam. Während der Krieg also weiterhin als Instrument der Außenpolitik angesehen wurde, begann das westfälische System damit, Beschränkungen und Regeln für seine Anwendung einzuführen. Diese Zwänge wurden durch die Entwicklung des Völkerrechts in den folgenden Jahrhunderten noch verstärkt. | |||
Hugo Grotius, | Hugo Grotius, auch bekannt als Hugo de Groot, war eine zentrale Figur bei der Entwicklung des Völkerrechts, insbesondere im Hinblick auf die Gesetze von Krieg und Frieden. Sein bekanntestes Werk, "De Jure Belli ac Pacis" ("Vom Recht des Krieges und des Friedens"), das 1625 veröffentlicht wurde, gilt als einer der grundlegenden Texte des Völkerrechts. In diesem Werk versucht Grotius, eine Reihe von Regeln für das Verhalten von Staaten in Kriegs- und Friedenszeiten festzulegen. Er untersucht ausführlich, wann ein Krieg gerechtfertigt ist (jus ad bellum), wie er geführt werden sollte (jus in bello) und wie nach einem Konflikt ein gerechter Frieden wiederhergestellt werden kann (jus post bellum). | ||
Diese Ideen hatten einen bedeutenden Einfluss darauf, wie der Krieg wahrgenommen und geführt wird, indem sie die Vorstellung einführten, dass selbst in Kriegszeiten bestimmte Handlungen nicht akzeptabel sind und dass die Kriegsführung bestimmten ethischen und rechtlichen Grundsätzen unterliegen muss. Die von Grotius aufgestellten Grundsätze wurden im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt und ausgebaut und führten zur Formulierung detaillierterer und umfassenderer internationaler Konventionen wie den Genfer Konventionen, die heute das Verhalten in Kriegszeiten regeln. | |||
Die Organisation des zwischenstaatlichen Systems hat dazu geführt, dass strenge Regeln zur Regulierung der Kriegsführung erlassen wurden. Ziel dieser Regeln ist es, die zerstörerischen Folgen des Krieges so weit wie möglich zu begrenzen und Personen zu schützen, die nicht direkt am Krieg beteiligt sind, wie z. B. Zivilisten oder Kriegsgefangene. Aus diesem Grund muss ein Krieg nach internationalem Recht vor seinem Beginn erklärt werden. Diese Erklärung soll allen beteiligten Parteien, einschließlich anderer Länder und internationaler Organisationen, klar signalisieren, dass ein bewaffneter Konflikt begonnen hat. Während eines Krieges müssen sich die Kombattanten an bestimmte Regeln halten. So dürfen sie beispielsweise nicht absichtlich Zivilisten oder zivile Gebäude wie Schulen oder Krankenhäuser ins Visier nehmen oder Waffen einsetzen, die nach dem Völkerrecht verboten sind, wie chemische oder biologische Waffen. Schließlich muss nach einem Krieg ein Friedensprozess in Gang gesetzt werden, um Streitigkeiten zu lösen, Kriegsverbrechen zu bestrafen und die durch den Konflikt verursachten Schäden zu beheben. Obwohl diese Regeln oft verletzt werden, ist ihre Existenz und universelle Anerkennung ein wichtiger Versuch, eine Tätigkeit zu zivilisieren, die von Natur aus gewalttätig und zerstörerisch ist. | |||
Der Krieg wurde trotz seiner oft verheerenden Folgen als Mittel zur Lösung politischer Streitigkeiten in das zwischenstaatliche System integriert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nicht darum geht, den Krieg zu fördern oder zu verherrlichen, sondern vielmehr darum, zu versuchen, ihn einzudämmen und zu regulieren. Seit dem 17. Jahrhundert wurden zahlreiche Regeln aufgestellt, die versuchen, die Verheerungen des Krieges zu begrenzen. Dazu gehört das humanitäre Völkerrecht, das Grenzen für die Art und Weise setzt, wie Krieg geführt werden kann, und Personen schützt, die nicht oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, wie Zivilisten, Gesundheitsarbeiter und Kriegsgefangene. Darüber hinaus hat das Völkerrecht auch Regeln dafür aufgestellt, wie man einen Krieg erklärt, Feindseligkeiten führt und Frieden schließt. Dazu gehören das Kriegsrecht, das Regeln für die Durchführung von Feindseligkeiten aufstellt, und das Friedensrecht, das den Abschluss von Friedensverträgen und die Lösung internationaler Konflikte regelt. Diese Bemühungen zur Regulierung des Krieges zeugen von der Erkenntnis, dass ein Krieg zwar manchmal unvermeidlich sein kann, aber auf eine Art und Weise geführt werden muss, die menschliches Leid und materielle Zerstörung so weit wie möglich minimiert.[[Image:Helst, Peace of Münster.jpg|thumb|400px|<center>Bankett der Amsterdamer Bürgergarde zur Feier des Friedens von Münster (1648), ausgestellt im Rijksmuseum, von Bartholomeus van der Helst.]] | |||
Der Westfälische Friedensvertrag, der 1648 zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges geschlossen wurde, bestand aus zwei verschiedenen Abkommen: dem Vertrag von Osnabrück und dem Vertrag von Münster. Der Vertrag von Osnabrück wurde zwischen dem Schwedischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation geschlossen, während der Vertrag von Münster zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und den Vereinigten Provinzen (den heutigen Niederlanden) sowie zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich geschlossen wurde. Diese Verträge sind historisch wichtig, da sie den Grundstein für die moderne internationale Ordnung legten, die auf der Souveränität der Staaten beruht. Der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten wurde ebenso festgelegt wie der Grundsatz des Machtgleichgewichts. Der Westfälische Friedensvertrag bedeutete im Grunde das Ende der Idee eines universellen christlichen Reiches in Europa und ebnete den Weg für ein System unabhängiger und souveräner Nationalstaaten. | |||
Die Westfälischen Verträge beendeten den Dreißigjährigen Krieg, einen Religionskrieg, der Europa und insbesondere das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zwischen 1618 und 1648 auseinanderriss. In diesem Krieg standen sich vor allem katholische und protestantische Kräfte gegenüber, obwohl Politik und Machtkämpfe ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Durch die Beendigung dieses Krieges brachten die Westfälischen Verträge nicht nur einen willkommenen Frieden, sondern markierten auch einen grundlegenden Wandel in der politischen Organisation Europas. Vor diesen Verträgen war die Idee eines universellen christlichen Reiches, in dem eine höhere Autorität (entweder der Papst oder der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) eine gewisse Autorität über Königreiche und Fürstentümer haben sollte, noch lebendig. Die Westfälischen Verträge legten den Grundsatz der staatlichen Souveränität fest und besagen, dass jeder Staat die absolute und ausschließliche Autorität über sein Territorium und sein Volk besitzt. Das bedeutete, dass zum ersten Mal Staaten und nicht Kaiser oder Päpste zu den Hauptakteuren auf der internationalen Bühne wurden. Dies wird als das "westfälische System" bezeichnet, das nach wie vor die Grundlage der modernen internationalen Ordnung bildet. | |||
Die Schweiz wurde 1648 im Westfälischen Friedensvertrag als unabhängige Einheit anerkannt, obwohl es länger dauerte, bis sich ihre heutige Form als Staat konsolidierte. Die immerwährende Neutralität der Schweiz wurde auch auf dem Wiener Kongress 1815 festgelegt, was ihren eigenständigen Status auf der internationalen Bühne stärkte. Dennoch ist zu beachten, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft als Union der Kantone bereits vor dem Westfälischen Friedensvertrag existierte. Ihre einzigartige Struktur entsprach jedoch nicht genau dem Konzept des Nationalstaats, wie er mit dem westfälischen System entstand. Daher kann man sagen, dass es lange gedauert hat, bis die Schweiz in ihrer modernen Form auftauchte. | |||
Der Westfälische Friedensvertrag legte den Grundstein für das moderne internationale System, das auf nationaler Souveränität beruht. Mit anderen Worten: Jeder Staat hat das Recht, sein Hoheitsgebiet nach eigenem Ermessen ohne Einmischung von außen zu regieren. Dieses Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ist ein zentraler Pfeiler des internationalen Systems. Es beseitigt jedoch nicht den Konflikt oder die Meinungsverschiedenheit zwischen Staaten. Wenn eine Meinungsverschiedenheit auftritt, kann Krieg als Mittel zur Lösung eingesetzt werden. In der modernen Welt werden jedoch in der Regel andere Formen der Konfliktlösung wie Diplomatie, Dialog und Verhandlungen bevorzugt. Krieg wird oft als letztes Mittel angesehen, wenn keine andere Option praktikabel oder wirksam ist. | |||
Die Unterscheidung zwischen dem inneren und dem äußeren Raum der Staaten ist in der internationalen Politik von grundlegender Bedeutung. Innerhalb seiner Grenzen hat ein Staat die Souveränität, seine eigenen Gesetze und Vorschriften durchzusetzen und die Ordnung so aufrechtzuerhalten, wie er es für notwendig erachtet. Dieser innere Raum ist häufig durch einen Satz klar definierter Regeln und Normen gekennzeichnet, die weithin anerkannt und eingehalten werden. Außerhalb seiner Grenzen muss sich ein Staat in einem komplexeren und oft weniger regulierten Umfeld bewegen, in dem die Interaktionen hauptsächlich zwischen souveränen Staaten stattfinden, die möglicherweise unterschiedliche Interessen haben. Dieser äußere Raum wird durch das Völkerrecht geregelt, das weniger verbindlich ist und stärker von der Zusammenarbeit zwischen Staaten abhängt. | |||
Der Grundsatz der Souveränität begründet zwar die formale Gleichheit aller Staaten im Völkerrecht, führt aber nicht zwangsläufig zu einer tatsächlichen Gleichheit auf der internationalen Bühne. Einige Staaten können aufgrund ihrer wirtschaftlichen, militärischen oder strategischen Macht einen unverhältnismäßig großen Einfluss ausüben. Gleichzeitig hat der Aufstieg nichtstaatlicher Akteure die internationale Landschaft komplexer gemacht. Nichtregierungsorganisationen (NGOs), multinationale Unternehmen und sogar Einzelpersonen (wie Aktivisten, politische Dissidenten oder Prominente) können nun bedeutende Rollen in der internationalen Politik spielen. Diese Akteure können die globale Politik beeinflussen, indem sie die öffentliche Meinung mobilisieren, direkte Aktionen durchführen, grundlegende Dienstleistungen erbringen oder wirtschaftliche Macht ausüben. Doch trotz des wachsenden Einflusses dieser nichtstaatlichen Akteure bleiben die Staaten die wichtigsten und mächtigsten Akteure auf der internationalen Bühne. | |||
Im zeitgenössischen internationalen System ist der Staat die grundlegende politische Einheit. Das Konzept des souveränen Nationalstaats bleibt, obwohl es kritisiert und oft durch Fragen des Transnationalismus, der Globalisierung und der interdependenten internationalen Beziehungen verkompliziert wird, der wichtigste Organisator der Weltpolitik. Von jedem Staat als souveränem Gebilde wird erwartet, dass er absolute Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung ausübt. Das internationale System beruht auf der Interaktion dieser souveränen Staaten und der Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Realität oftmals komplexer ist. Viele nichtstaatliche Akteure - von multinationalen Konzernen über terroristische Gruppen bis hin zu Nichtregierungsorganisationen und internationalen Institutionen - spielen ebenfalls eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne. Manchmal können diese Akteure sogar die Autorität und Souveränität von Staaten in Frage stellen. Doch trotz dieser Herausforderungen bleibt die Idee des Nationalstaats zentral für das Verständnis und die Strukturierung unserer politischen Welt. | |||
Man spricht nicht von "Weltstudien" oder "globalen Studien". Der Begriff, der sich durchgesetzt hat, ist der der "Internationalen Beziehungen". Das Studienfeld "Internationale Beziehungen" konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Staaten und, im weiteren Sinne, zwischen Akteuren auf der Weltbühne. Es geht nicht einfach darum, die Welt als Ganzes zu studieren, sondern zu verstehen, wie Staaten miteinander interagieren, wie sie Macht aushandeln und herausfordern, wie sie zusammenarbeiten und in Konflikte geraten. Die Betonung liegt auf "Beziehungen", denn über diese Beziehungen definieren sich die Staaten gegenseitig, gestalten ihre Außenpolitik und beeinflussen das internationale System. Daher bleiben der Nationalstaat und die Staatsgrenze trotz der zunehmenden Interdependenz und Globalisierung Schlüsselbegriffe in der Theorie und Praxis der internationalen Beziehungen. Tatsächlich ist die Strukturierung des Raums zwischen Staaten eine grundlegende Dimension in der Analyse der internationalen Beziehungen. Es ist diese Strukturierung, die unter anderem Bündnisse, Konflikte, Handel und Bevölkerungsströme bestimmt. Sie ist es auch, die einen bedeutenden Einfluss auf die Weltordnungspolitik und die Entwicklung internationaler Normen hat. | |||
Der 1648 unterzeichnete Westfälische Friedensvertrag legte den Grundstein für die moderne internationale Ordnung, die auf dem Prinzip der nationalen Souveränität beruht. Nach diesem Prinzip hat jeder Staat das Recht, sein eigenes Territorium und seine eigene Bevölkerung ohne Einmischung von außen zu regieren. Souveräne Gleichheit bedeutet, dass aus der Sicht des Völkerrechts alle Staaten gleich sind, unabhängig von ihrer Größe, ihrem Reichtum oder ihrer Macht. Das bedeutet, dass jeder Staat das Recht hat, in vollem Umfang an der internationalen Gemeinschaft teilzunehmen und von anderen Staaten respektiert zu werden. | |||
Doch auch wenn der Westfälische Friedensvertrag Souveränität und souveräne Gleichheit als grundlegende Prinzipien des internationalen Systems etabliert hat, darf man daraus nicht ableiten, dass Krieg eine unvermeidliche Folge dieser Prinzipien ist. Denn auch wenn Streitigkeiten zwischen Staaten zu bewaffneten Konflikten führen können, ist der Krieg weder die einzige noch die am meisten gewünschte Art der Streitbeilegung. Die Grundsätze des Völkerrechts, wie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, sind auch für die aus Westfalen hervorgegangene internationale Ordnung zentral. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahrhunderte internationale Normen und Institutionen entwickelt, die die Kriegsführung einrahmen und regulieren und den Dialog, die Verhandlungen und die Zusammenarbeit zwischen Staaten fördern. Das Westfälische System ist daher nicht einfach eine Lizenz zum Krieg, sondern der Rahmen, in dem Staaten koexistieren, zusammenarbeiten und manchmal auch gegeneinander kämpfen. | |||
== | == Vom Totalen Krieg zum Institutionalisierten Krieg (Holsti) == | ||
Le XVIIe siècle a été une époque de transformations significatives dans l'organisation politique et sociale de nombreux pays, conduisant à l'émergence de l'État moderne. C'est durant cette période que les États ont commencé à consolider leur pouvoir, à centraliser l'autorité, à imposer des impôts de façon systématique et à développer des bureaucraties plus efficaces et structurées. Cette centralisation et cette bureaucratisation ont permis aux États d'amasser des ressources et de les mobiliser plus efficacement, en vue notamment de conduire des guerres. À mesure que les États devenaient plus puissants et plus efficaces, ils étaient capables de mener des guerres à plus grande échelle et avec plus d'intensité. Cela a ouvert la voie à ce qu'on appelle la "guerre totale", où tous les aspects de la société sont mobilisés pour l'effort de guerre et où la distinction entre combattants et non-combattants devient floue. Parallèlement à ces changements, le système international évoluait également, avec l'établissement du système westphalien basé sur la souveraineté des États. Ces deux processus - l'évolution de l'État et la transformation du système international - se sont renforcés mutuellement. La consolidation de l'État a contribué à l'essor du système westphalien, tandis que ce dernier a fourni un cadre permettant aux États de se développer et de se renforcer. | Le XVIIe siècle a été une époque de transformations significatives dans l'organisation politique et sociale de nombreux pays, conduisant à l'émergence de l'État moderne. C'est durant cette période que les États ont commencé à consolider leur pouvoir, à centraliser l'autorité, à imposer des impôts de façon systématique et à développer des bureaucraties plus efficaces et structurées. Cette centralisation et cette bureaucratisation ont permis aux États d'amasser des ressources et de les mobiliser plus efficacement, en vue notamment de conduire des guerres. À mesure que les États devenaient plus puissants et plus efficaces, ils étaient capables de mener des guerres à plus grande échelle et avec plus d'intensité. Cela a ouvert la voie à ce qu'on appelle la "guerre totale", où tous les aspects de la société sont mobilisés pour l'effort de guerre et où la distinction entre combattants et non-combattants devient floue. Parallèlement à ces changements, le système international évoluait également, avec l'établissement du système westphalien basé sur la souveraineté des États. Ces deux processus - l'évolution de l'État et la transformation du système international - se sont renforcés mutuellement. La consolidation de l'État a contribué à l'essor du système westphalien, tandis que ce dernier a fourni un cadre permettant aux États de se développer et de se renforcer. | ||
Version du 24 juin 2023 à 08:53
La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu ● Aux origines de la chute de la République de Weimar ● La pensée sociale de Max Weber et Vilfredo Pareto ● La notion de « concept » en sciences-sociales ● Histoire de la discipline de la science politique : théories et conceptions ● Marxisme et Structuralisme ● Fonctionnalisme et Systémisme ● Interactionnisme et Constructivisme ● Les théories de l’anthropologie politique ● Le débat des trois I : intérêts, institutions et idées ● La théorie du choix rationnel et l'analyse des intérêts en science politique ● Approche analytique des institutions en science politique ● L'étude des idées et idéologies dans la science politique ● Les théories de la guerre en science politique ● La Guerre : conceptions et évolutions ● La raison d’État ● État, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveaux ● Les théories de la violence en science politique ● Welfare State et biopouvoir ● Analyse des régimes démocratiques et des processus de démocratisation ● Systèmes Électoraux : Mécanismes, Enjeux et Conséquences ● Le système de gouvernement des démocraties ● Morphologie des contestations ● L’action dans la théorie politique ● Introduction à la politique suisse ● Introduction au comportement politique ● Analyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publique ● Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation ● Analyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluation ● Introduction à la sous-discipline des relations internationales
Krieg ist ein komplexes Phänomen, das im Laufe der Geschichte viele verschiedene Auffassungen und Entwicklungen durchlaufen hat. Verschiedene Epochen und Gesellschaften hatten unterschiedliche Perspektiven auf den Krieg, und diese Auffassungen haben sich als Reaktion auf politische, wirtschaftliche, technologische und soziale Veränderungen weiterentwickelt.
Krieg ist ein bewaffneter Konflikt zwischen Staaten oder Gruppen, der oft durch extreme Gewalt, soziale Störungen und wirtschaftliche Unterbrechungen gekennzeichnet ist. Er beinhaltet in der Regel den Einsatz und die Verwendung von militärischen Kräften und die Anwendung von Strategien und Taktiken, um den Gegner zu besiegen. Krieg kann viele Ursachen haben, u. a. territoriale, politische, wirtschaftliche oder ideologische Meinungsverschiedenheiten. Es wird allgemein angenommen, dass der moderne Krieg mit der Entstehung des Nationalstaats im 17. Der Westfälische Friedensvertrag von 1648 markierte das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Europa und etablierte das Konzept der nationalen Souveränität. Dadurch wurde ein internationales System geschaffen, das auf unabhängigen Nationalstaaten beruhte, die rechtmäßig auf Krieg zurückgreifen konnten. Die Vergrößerung der Armeen, die Verbesserung der Militärtechnologie und die Entwicklung von Taktiken und Strategien trugen ebenfalls zur Entstehung des modernen Krieges bei. Im Zeitalter des Terrorismus und der Globalisierung verändert sich das Wesen des Krieges. Wir sind nun mit asymmetrischen Konflikten konfrontiert, in denen nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus hat der Aufstieg der Kybernetik zur Entstehung des Cyberkriegs geführt. Schließlich ist der Informationskrieg, bei dem Informationen zur Manipulation oder Täuschung der öffentlichen Meinung oder des Gegners eingesetzt werden, zu einer gängigen Taktik geworden.
Die Vorstellung vom Ende des Krieges ist umstritten. Einige argumentieren, dass die Globalisierung, die wirtschaftliche Interdependenz und die Verbreitung demokratischer Werte den Krieg weniger wahrscheinlich gemacht haben. Andere argumentieren, dass der Krieg nicht so schnell verschwinden wird, und verweisen auf die Existenz laufender bewaffneter Konflikte, anhaltende internationale Spannungen und die Möglichkeit künftiger Konflikte um begrenzte Ressourcen oder aufgrund von Klimainstabilität. Hinzu kommt, dass traditionelle Konflikte zwischen Staaten zwar möglicherweise abnehmen, neue Formen von Konflikten wie Terrorismus oder Kybernetik jedoch fortbestehen. Die Zukunft des Krieges ist ungewiss, aber sicher ist, dass die Fortsetzung von Diplomatie, Dialog und Abrüstung entscheidend ist, um Krieg zu verhindern und einen dauerhaften Frieden zu fördern.
Zunächst werden wir die grundlegende Natur des Krieges erforschen, bevor wir uns mit der Entstehung des modernen Krieges beschäftigen. Wir werden feststellen, dass Krieg über bloße Gewalt hinausgeht und als regulierendes Element in unserem seit Jahrhunderten geformten internationalen System fungiert. Anschließend untersuchen wir die zeitgenössischen Entwicklungen des Krieges, insbesondere im Zusammenhang mit Terrorismus und Globalisierung, und fragen uns, ob sich das Wesen des Krieges wandelt und ob sich seine Grundprinzipien weiterentwickeln. Abschließend werden wir uns die Frage nach der Zukunft des Krieges stellen: Sind wir Zeugen seines Endes oder besteht er in anderen Formen fort?
Was ist Krieg?
Definition von Krieg
Wir werden uns fragen, was Krieg ist, und uns mit den Warnungen und Missverständnissen über den Krieg auseinandersetzen. Es gibt sehr viele Definitionen des Begriffs Krieg, aber eine der treffendsten ist die von Hedley Bull, dem Begründer der englischen Schule, der in seinem 1977 erschienenen Buch The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics folgende Definition gibt: "an organized violence carried on by political units against each other" (eine organisierte Gewalttätigkeit von politischen Einheiten gegeneinander).
Hedley Bulls Definition von Krieg hebt mehrere Schlüsselaspekte dieses komplexen Phänomens hervor.
1. "Organisierte Gewalt": Die Verwendung dieses Satzes legt nahe, dass Krieg keine zufällige oder chaotische Folge von Gewaltakten ist. Sie ist organisiert und geplant, oftmals in sehr detaillierter Weise. Diese Organisation kann die Mobilisierung von Truppen, die Entwicklung von Strategien und Taktiken, die Produktion und Beschaffung von Waffen und viele andere logistische Aspekte beinhalten. Die betreffende Gewalt ist ebenfalls extrem und beinhaltet in der Regel Tod und schwere Verletzungen, Zerstörung von Eigentum und soziale Instabilität.
2. "Von politischen Einheiten geführt": Hier betont Bull, dass der Krieg eine Handlung ist, die von politischen Akteuren begangen wird - typischerweise von Nationalstaaten, aber potenziell auch von nichtstaatlichen Gruppen mit einer politischen Organisation. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass Krieg oft das Produkt politischer Entscheidungen ist und eingesetzt wird, um politische Ziele zu erreichen. Dazu können Ziele wie die Eroberung von Territorium, ein Regimewechsel, die Behauptung nationaler Macht oder die Verteidigung gegen eine wahrgenommene Bedrohung gehören.
3. "Gegeneinander": Dieser Teil der Definition betont, dass Krieg einen Konflikt beinhaltet. Es handelt sich nicht um einseitige Gewaltakte, sondern um eine Situation, in der sich mehrere Parteien aktiv gegeneinander stellen. Dies impliziert eine interaktive Dynamik, bei der die Handlungen jeder Partei die Handlungen der anderen beeinflusst, wodurch ein Kreislauf der Gewalt entsteht, der schwer zu durchbrechen sein kann.
Diese Definition ist zwar einfach, umfasst also viele Aspekte des Krieges. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Krieg ein komplexes Phänomen ist, das nicht vollständig durch eine einzige Definition verstanden oder erklärt werden kann. Auch viele andere Perspektiven und Theorien können wertvolle Informationen über das Wesen des Krieges, seinen Ursprung, seinen Verlauf und seine Folgen liefern.
Die Unterscheidung zwischen zwischen zwischenmenschlicher Gewalt, wie Kriminalität und Aggressionen, und Krieg als organisierte Gewalt, die von politischen Einheiten ausgeübt wird, ist von entscheidender Bedeutung :
- Zwischenmenschliche Gewalt: Diese bezieht sich auf Gewalttaten von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen, die häufig im Zusammenhang mit Verbrechen wie Diebstahl, Körperverletzung, Mord usw. begangen werden. Sie wird in der Regel nicht in großem Umfang koordiniert oder organisiert und dient nicht der Erreichung politischer Ziele. Die Motive können vielfältig sein und von persönlichen Konflikten bis hin zum Streben nach materiellen Gewinnen reichen.
- Krieg: Im Gegensatz zu zwischenmenschlicher Gewalt ist Krieg eine groß angelegte Form der Gewalt, die von politischen Einheiten, in der Regel Nationalstaaten oder strukturierten politischen Gruppen, sorgfältig organisiert und geplant wird. Im Krieg sollen bestimmte, oftmals politische Ziele durch den Einsatz von Gewalt erreicht werden. Die Kämpfer sind in der Regel ausgebildete und ausgerüstete Soldaten oder Militante, und die Konflikte werden oft nach bestimmten Regeln oder Konventionen ausgetragen.
Der von Hedley Bull angesprochene Punkt des offiziellen Charakters des Krieges ist ein entscheidendes Element, um sein Wesen zu verstehen. Seiner Meinung nach wird der Krieg von politischen Einheiten, in der Regel Staaten, geführt und findet gegen andere politische Einheiten statt. Er ist eine Handlung, die offiziell sanktioniert und im Namen des Staates geführt wird. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie den Begriff des Krieges von dem der Verbrechensbekämpfung trennt, die ebenfalls eine Form der organisierten Gewalt ist, aber in einem anderen Rahmen operiert. Während Krieg in der Regel ein Konflikt zwischen Staaten oder politischen Gruppen ist, handelt es sich bei der Verbrechensbekämpfung um Maßnahmen, die der Staat innerhalb seiner eigenen Grenzen ergreift, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Die Verbrechensbekämpfung wird in der Regel von Ordnungskräften wie der Polizei durchgeführt, deren Aufgabe es ist, Verbrechen zu verhindern und zu unterdrücken. Sie dient nicht dazu, politische oder strategische Ziele zu erreichen, wie es bei einem Krieg der Fall ist, sondern vielmehr dazu, die Bürger zu schützen und das Gesetz durchzusetzen. Diese Differenzierung unterstreicht den Ausnahmecharakter des Krieges als Akt organisierter Gewalt, der politische Grenzen überschreitet, im Gegensatz zu innerstaatlicher Gewalt steht und von einem Staat oder einer politischen Einheit sanktioniert wird. Krieg ist seinem Wesen nach ein politisches Phänomen, das auf die Veränderung des Status quo abzielt, häufig durch den Einsatz von Waffengewalt, und stellt daher eine eigene Dimension der Gewalt in der Gesellschaft dar.
Die von Hedley Bull formulierte Definition des Krieges ist recht umfassend und präzise. Sie beschreibt das Wesen des modernen Krieges gut, indem sie seine Schlüsselaspekte hervorhebt: Er ist organisierte Gewalt, die von politischen Einheiten untereinander ausgeübt wird und in der Regel außerhalb dieser politischen Einheiten gerichtet ist. Diese Definition deckt gut ab, was viele Menschen unter "Krieg" verstehen, auch diejenigen, die ihn in einem akademischen oder militärischen Rahmen untersuchen. Sie erfasst die Vorstellung, dass Krieg ein strukturiertes Phänomen ist, mit bestimmten Akteuren (politischen Einheiten), einem offiziellen Charakter und einer externen Ausrichtung. Diese Definition dient auch als Grundlage, um die Komplexität moderner Konflikte zu verstehen, bei denen die Grenzen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren verschwimmen können und Konflikte internationale Akteure einbeziehen und nationale Grenzen überschreiten können.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Definition zwar nützlich ist, aber nur eine von vielen möglichen Arten ist, Krieg zu definieren und zu verstehen. Andere Perspektiven können den Schwerpunkt auf andere Aspekte des Krieges legen, wie z. B. seine soziale, wirtschaftliche oder psychologische Dimension. Wie bei jedem komplexen Phänomen erfordert ein umfassendes Verständnis des Krieges einen mehrdimensionalen Ansatz, der seine zahlreichen Facetten und Auswirkungen berücksichtigt.
Dekonstruieren von Vorurteilen
Krieg als Konzept ist durch die Geschichte, die Medien, die Literatur und andere Formen der kulturellen Kommunikation in unser kollektives Bewusstsein eingedrungen. Unsere intuitiven Wahrnehmungen des Krieges können jedoch von vorgefassten Meinungen geprägt sein, die nicht unbedingt die Komplexität der Realität widerspiegeln.
L'approche de Thomas Hobbes : « la guerre de tous contre tous »
Für Thomas Hobbes in seinem 1651 veröffentlichten Buch Der Leviathan ist Krieg "der Krieg aller gegen alle". In diesem Buch beschreibt Hobbes den Naturzustand, einen hypothetischen Zustand, in dem es keine Regierung oder zentrale Autorität gibt, die die Ordnung durchsetzt. Er definiert den Naturzustand als einen "Krieg aller gegen alle" (lateinisch bellum omnium contra omnes), in dem die Individuen in ständiger Konkurrenz zueinander um das Überleben und die Ressourcen stehen. Hobbes zufolge würden die Menschen ohne eine zentrale Autorität, die für Ordnung sorgt, ständig miteinander in Konflikt geraten, was zu einem Leben führen würde, das "einsam, arm, unangenehm, brutal und kurz" wäre. Aus diesem Grund seien die Menschen bereit, einen Teil ihrer Freiheit zugunsten einer Regierung oder eines Herrschers (des Leviathan) aufzugeben, der in der Lage sei, Frieden und Ordnung zu erzwingen.
In "Der Leviathan" argumentiert Hobbes, dass sich das Leben der Individuen ohne einen Staat oder eine zentrale Autorität in einem ständigen Zustand des "Krieges aller gegen alle" befinden würde. Dies ist laut Hobbes die Anarchie, die in Abwesenheit des Staates herrscht. Anarchie bedeutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt Chaos oder Desorganisation, sondern vielmehr das Fehlen einer zentralen Autorität, die Regeln und Verhaltensnormen durchsetzt. Für Hobbes ist der Staat daher ein notwendiges Instrument, um die interindividuellen Beziehungen zu regulieren, Konflikte zu verhindern und die Sicherheit der Individuen zu gewährleisten. Die Individuen sind Hobbes zufolge bereit, einen Teil ihrer Freiheit aufzugeben, um im Gegenzug die Sicherheit und Stabilität zu erhalten, die der Staat ihnen bieten kann.
In Wirklichkeit neigen die Menschen selbst in Situationen extremer sozialer oder politischer Instabilität dazu, Strukturen und Organisationen zu bilden, um die Ordnung zu wahren und das Überleben zu erleichtern. Ein ewiger Krieg, wie ihn Hobbes im Naturzustand beschreibt, ist aus empirischer Sicht praktisch unmöglich. Darüber hinaus erfordert die Führung eines Krieges ein Maß an Organisation und Koordination, das Individuen im Zustand der Anarchie nur schwer erreichen könnten. Individuen schließen sich eher zu ihrer eigenen Verteidigung oder zur Erreichung gemeinsamer Ziele zusammen, was an sich schon als eine primitive Form des Staates oder der Staatsführung angesehen werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass Hobbes den Naturzustand und den "Krieg aller gegen alle" als begriffliche Werkzeuge verwendet, um für die Bedeutung des Staates und des Gesellschaftsvertrags zu argumentieren. Er legt nicht unbedingt nahe, dass dieser Naturzustand jemals wortwörtlich existiert hat.
Bewaffnete Konflikte, insbesondere solche, die auf die Ebene des Krieges aufsteigen, beinhalten weitaus komplexere Dynamiken als einfache Aggressionen oder individuelle Konflikte. Sie erfordern eine bedeutende Organisation, strategische Planung und erhebliche Ressourcen.
An Kriegen sind in der Regel politische Akteure beteiligt - Staaten oder Gruppen, die versuchen, bestimmte politische Ziele zu erreichen. Somit ist Krieg nicht nur eine Ausweitung individueller Aggression oder Egoismus, sondern auch stark mit Politik, Ideologie und Machtstrukturen verbunden. Darüber hinaus haben Kriege oft weitreichende soziale und politische Folgen. Sie können Grenzen umgestalten, Regierungen stürzen, große gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen und nachhaltige Auswirkungen auf Einzelpersonen und Gemeinschaften haben. Aus diesem Grund erfordert das Studium des Krieges ein umfassendes Verständnis vieler verschiedener Aspekte der menschlichen Gesellschaft, einschließlich Politik, Psychologie, Wirtschaft, Technologie und Geschichte.
Hobbes' Vision vom "Krieg aller gegen alle" konzentriert sich auf Egoismus und Konflikt als inhärente Aspekte der menschlichen Natur. Der Krieg, wie wir ihn kennen, ist jedoch nicht einfach das Produkt von Egoismus oder individueller Aggression. Er ist vielmehr eine komplexe soziale Schöpfung, die eine substanzielle Organisation und Koordination erfordert. Der Gedanke, dass der Krieg tatsächlich ein Produkt unserer Sozialität und nicht unseres Egoismus ist, ist sehr erhellend. Um einen Krieg zu führen, braucht man nicht nur Ressourcen, sondern auch eine Organisationsstruktur, um die Anstrengungen zu koordinieren, eine Ideologie oder ein Ziel, um die Teilnehmer zu vereinen, und Normen oder Regeln, um das Verhalten zu regulieren. All diese Elemente sind ein Produkt des gesellschaftlichen Lebens. Diese Perspektive legt nahe, dass wir, um den Krieg zu verstehen, über bloße Instinkte oder individuelles Verhalten hinausblicken und die sozialen, politischen und kulturellen Strukturen betrachten müssen, die den bewaffneten Konflikt ermöglichen und prägen. Sie betont auch, dass die Verhinderung von Kriegen eine besondere Aufmerksamkeit für diese Strukturen und nicht nur für die menschliche Natur erfordert.
Obwohl Hobbes' Theorie des "Krieges aller gegen alle" nahelegt, dass der Krieg in der egoistischen Natur des Einzelnen verwurzelt ist, ist die Realität viel komplexer. Krieg erfordert ein gewisses Maß an Organisation, Planung und Koordination, die alle eher Merkmale menschlicher Gesellschaften als isolierter Individuen sind. Daher kann Krieg besser als ein soziales Phänomen verstanden werden und nicht nur als eine Erweiterung des Egoismus oder der Aggression des Einzelnen. Krieg wird häufig von einer Vielzahl sozialer Strukturen und Prozesse beeinflusst und hat wiederum Einfluss auf diese, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und soziale Normen und Werte. Bewaffnete Konflikte entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind tief in den spezifischen sozialen und historischen Kontexten verwurzelt.
Krieg ist weit mehr als eine bloße Manifestation menschlicher Aggression oder Selbstsucht. Er ist vielmehr das Ergebnis eines breiten Spektrums an sozialen und organisatorischen Faktoren, die einen groß angelegten Konflikt ermöglichen, erleichtern und motivieren. Um einen Krieg zu entfachen, bedarf es weit mehr als nur des Willens oder des Wunsches zu kämpfen. Es bedarf organisatorischer Strukturen, die in der Lage sind, Ressourcen zu mobilisieren, Strategien zu koordinieren und Streitkräfte zu führen. Zu diesen Strukturen gehören unter anderem bürokratische Verwaltungen, militärische Befehlsketten und logistische Unterstützungssysteme. Diese Organisationen können nicht ohne den sozialen Rahmen existieren, der sie unterstützt. Darüber hinaus bedarf es auch einer bestimmten Art von Kultur und Ideologie, die den Krieg rechtfertigt und aufwertet. Soziale Überzeugungen, Werte und Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung und Aufrechterhaltung dieser Organisationen sowie bei der Motivation des Einzelnen, sich am Krieg zu beteiligen. Somit ist der Krieg ein zutiefst soziales und strukturelles Phänomen. Er ist das Produkt unserer Fähigkeit, in einer Gesellschaft zusammenzuleben, und nicht unseres Egoismus oder unserer individuellen Aggression. Diese Perspektive kann wichtige Ansatzpunkte für die Konfliktprävention und Friedensförderung bieten.
Heraklits Ansatz: Der Krieg ist der Vater aller Dinge, und von allen Dingen ist er König
Wir haben gerade gesehen, wie man Krieg führt und ihn ermöglicht, nun wollen wir uns mit dem zweiten Mythos mit dem "Wann" beschäftigen. Der zweite Mythos ist der des ewigen Krieges von Heraklit, der postuliert: "Der Krieg ist der Vater aller Dinge, und von allen Dingen ist er König". Diese Ansicht vereinfacht die Realität jedoch zu sehr.
Der Krieg, wie wir ihn heute kennen, ist ein spezifisches Phänomen, das ein gewisses Maß an sozialer und organisatorischer Struktur erfordert, wie wir zuvor erörtert haben. Mit anderen Worten: Krieg ist nicht einfach eine Manifestation menschlicher Gewalt, sondern vielmehr eine organisierte und strukturierte Form des Konflikts, die sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von sozialen, politischen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren entwickelt hat. Das Vorhandensein von organisierter Gewalt ist kein universelles Merkmal aller menschlichen Gesellschaften im Laufe der Geschichte. Einige Gesellschaften erlebten längere Zeiträume des Friedens, während andere ein höheres Maß an Gewalt und Konflikten aufwiesen. Darüber hinaus hat sich auch das Wesen des Krieges selbst im Laufe der Zeit erheblich verändert. Die Kriege der Antike beispielsweise unterschieden sich in Bezug auf Strategie, Technologie, Taktik und Folgen erheblich von den modernen Kriegen.
Wenn man einen etwas soziologischeren Blick hat, könnte man sagen, dass Krieg ein relativ junges Phänomen in der menschlichen Geschichte ist, zumindest ist es ein Merkmal, das nicht zeitlos ist. Archäologische und anthropologische Beweise deuten darauf hin, dass der Krieg, so wie wir ihn heute als organisierten Großkonflikt zwischen politischen Einheiten verstehen, ein relativ junges Phänomen in der Menschheitsgeschichte ist. Erst mit der Entstehung komplexerer und hierarchischerer Gesellschaften, die oft mit Sesshaftigkeit und Landwirtschaft einherging, beginnen wir, klare Anzeichen für organisierten Krieg zu sehen. Davor gab es zwar sicherlich zwischenmenschliche Gewalt und kleinere Konflikte, aber keine überzeugenden Beweise für groß angelegte Konflikte, die eine komplexe Koordination und politische Ziele beinhalten. Das bedeutet nicht, dass die menschlichen Gesellschaften friedlich oder gewaltfrei waren, sondern vielmehr, dass die Art dieser Gewalt anders war und nicht dem entsprach, was wir üblicherweise als "Krieg" bezeichnen.
Die Vorstellung, dass der Krieg in der Geschichte der Menschheit ein neues Phänomen ist, wird durch zahlreiche Forschungsergebnisse aus der Anthropologie und Archäologie gestützt. Vor dem Aufkommen der Landwirtschaft während der neolithischen Revolution, die auf etwa 7000 v. Chr. datiert wird, lebten die Menschen in der Regel in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern. Diese Gruppen hatten zwar Konflikte, aber diese waren in der Regel klein und ähnelten nicht den organisierten Kriegen, die wir heute kennen. Man kann nicht wirklich von Krieg sprechen. Krieg, wie wir ihn heute definieren, erfordert eine gewisse soziale Organisation und Arbeitsspezialisierung, einschließlich der Bildung von Gruppen, die sich den Kämpfen widmen. Außerdem beinhaltet Krieg oft Konflikte um die Kontrolle von Ressourcen, was mit dem Aufkommen der Landwirtschaft und der Sesshaftigkeit der Menschen relevanter wird, als die Ressourcen lokalisierter und begrenzter werden. Aus diesem Grund sind sich die meisten Forscher einig, dass es Krieg als strukturiertes und organisiertes Phänomen wahrscheinlich erst seit der neolithischen Revolution vor etwa 10.000 Jahren gibt. Das bedeutet, dass es während des größten Teils der Menschheitsgeschichte den Krieg, wie wir ihn kennen, nicht gab, was die Vorstellung in Frage stellt, dass er ein natürlicher und unvermeidlicher Aspekt der menschlichen Gesellschaft ist. Wenn man also davon ausgeht, dass der Mensch vor 200.000 Jahren entstanden ist, würde der Krieg also nur 5% unserer Geschichte betreffen. Wir sind weit entfernt von einem ahistorischen und universellen Phänomen, das es schon immer gegeben hätte.
Es ist wichtig zu vermeiden, den Krieg als etwas zu essentialisieren, das in uns steckt. Wenn wir uns die Tatsachen empirisch ansehen, hat es Krieg nicht immer gegeben und er ist mit einer entwickelten sozialen Organisation verbunden. Diese Form der sozialen Organisation trat ab der Jungsteinzeit auf und fiel mit einer funktionalen Spezialisierung zusammen, nämlich mit dem Aufkommen der ersten Städte. Somit ist der Krieg als organisiertes und institutionalisiertes Phänomen intrinsisch mit der Entstehung komplexerer Gesellschaften verbunden, insbesondere mit der Entstehung der ersten Städte. Das Leben in der Stadt führte zu einer viel stärkeren Arbeitsteilung, bei der sich Individuen auf bestimmte Berufe spezialisierten, von denen einige mit Verteidigung und Krieg zu tun hatten. In Jäger- und Sammlergesellschaften gab es oft eine Arbeitsteilung auf der Grundlage von Geschlecht und Alter, aber die Vielfalt der Rollen war im Allgemeinen begrenzt im Vergleich zu dem, was man in komplexeren landwirtschaftlichen Gesellschaften sieht. Mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der ersten Städte wurde die Arbeitsteilung erheblich ausgeweitet, was die Bildung von Klassen spezialisierter Krieger ermöglichte. Dies fiel auch mit der Entstehung der ersten Staaten zusammen, die über die Ressourcen und die Organisation verfügten, um groß angelegte Kriege zu führen. In dieser Zeit entstanden Formen organisierter und lang anhaltender Gewalt, die wir als Kriege erkennen.
Dies ist ein Gedanke, der ziemlich grundlegend für die Idee des Staatsaufbaus und die Entwicklung unserer Gesellschaften ist. Die Fähigkeit, Kriege zu organisieren und zu führen, ist zu einem Schlüsselelement bei der Bildung von Staaten geworden. In vielen Fällen hat die Androhung von Gewalt oder Krieg dazu beigetragen, verschiedene Gruppen unter einer zentralen Autorität zu vereinen, was zur Gründung von Nationalstaaten führte. Dies spiegelt sich in Hobbes' Theorie des Gesellschaftsvertrags wider, in der er postuliert, dass die Menschen im Austausch für Sicherheit und Ordnung bereit sind, auf bestimmte Freiheiten zu verzichten und einer höchsten Instanz (dem Staat) Autorität zu verleihen. In diesem Sinne kann der Krieg (oder die Kriegsgefahr) als Katalysator für die Bildung von Staaten dienen. Darüber hinaus ist die Verwaltung des Krieges durch die Aufstellung von Armeen, die Verteidigung des Territoriums, die Durchsetzung des Völkerrechts und die Diplomatie zu einem wesentlichen Teil der Verantwortlichkeiten moderner Staaten geworden. Dies zeigt sich in der Entwicklung dedizierter Bürokratien, von Steuersystemen zur Finanzierung militärischer Anstrengungen und einer Innen- und Außenpolitik, die sich auf Militär- und Sicherheitsfragen konzentriert. So sind Krieg und Staatsbildung zutiefst miteinander verbunden, wobei jede die andere im Laufe der Menschheitsgeschichte beeinflusst und gestaltet.
Die berufliche Spezialisierung war ein Schlüsselfaktor in der Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Dies wird als Arbeitsteilung bezeichnet, ein Konzept, das von Denkern wie Adam Smith und Emile Durkheim umfassend erforscht wurde. Die Arbeitsteilung kann als ein Prozess beschrieben werden, bei dem die Aufgaben, die für das Überleben und Funktionieren einer Gesellschaft notwendig sind, unter ihren Mitgliedern aufgeteilt werden. Zum Beispiel können sich einige Menschen auf die Landwirtschaft spezialisieren, während andere sich auf das Bauwesen, den Handel, das Bildungswesen oder die Sicherheit spezialisieren. Diese Spezialisierung ermöglicht es jedem Einzelnen, rollenspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, was in der Regel die Effizienz und Produktivität der Gesellschaft als Ganzes erhöht. Im Gegenzug sind die Individuen voneinander abhängig, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wodurch ein komplexes Netz gegenseitiger Abhängigkeiten entsteht. Im Hinblick auf Sicherheit und Gewaltanwendung hat die Spezialisierung zur Schaffung von Polizeikräften und Armeen geführt. Diese Einheiten sind für die Aufrechterhaltung der Ordnung, den Schutz der Gesellschaft und die Durchsetzung von Gesetzen und Vorschriften zuständig. Diese Spezialisierung hatte auch bedeutende Auswirkungen auf die Kriegsführung und die Strukturierung moderner Gesellschaften.
Der Krieg, wie wir ihn heute verstehen, fällt mit der neolithischen Revolution zusammen, einer Zeit, in der die Menschen begannen, sesshaft zu werden und komplexere soziale Strukturen zu schaffen. Davor gab es zwar Konflikte zwischen Gruppen, aber sie hatten wahrscheinlich nicht die gleiche Größenordnung oder den gleichen Organisationsgrad wie das, was wir heute als "Krieg" klassifizieren. In der neolithischen Revolution entwickelten sich die Menschen von einem Leben als nomadische Jäger und Sammler zu einem Leben als sesshafte Landwirte. Dies führte zur Entstehung der ersten nennenswerten Bevölkerungsdichte - der Städte - sowie zu neuen Formen der sozialen und politischen Struktur. Diese höhere Bevölkerungsdichte und die komplexeren Strukturen erhöhten wahrscheinlich den Wettbewerb um Ressourcen, was zu einem besser organisierten Konflikt geführt haben könnte. Außerdem begann sich mit dem Aufkommen der Städte eine Spezialisierung der Berufe zu entwickeln. Diese Spezialisierung umfasste Rollen, die sich dem Schutz und der Verteidigung der Gemeinschaft widmeten, wie z. B. Krieger oder Soldaten, die sich ganz diesen Aufgaben widmen konnten, anstatt sich auch noch um die Landwirtschaft oder die Jagd kümmern zu müssen. Diese Spezialisierung ermöglichte die Entstehung besser organisierter und effektiverer militärischer Kräfte und trug so zur Eskalation des Krieges als soziales Phänomen bei.
Nach der neolithischen Revolution erleben wir einen raschen Anstieg der sozialen und politischen Komplexität. Sesshaftigkeit und Landwirtschaft führten zu stabileren und wohlhabenderen Gesellschaften, die in der Lage waren, eine wachsende Bevölkerung zu unterstützen. Mit dieser Zunahme der Bevölkerung und des Wohlstands verschärfte sich der Wettbewerb um die Ressourcen, was zu mehr Konflikten führte. Die ersten Stadtstaaten, wie die von Sumer in Mesopotamien um 5000 v. Chr., sind ein hervorragendes Beispiel für diese Zunahme der Komplexität. Diese Stadtstaaten waren hoch organisierte hierarchische Gesellschaften mit einer klaren Arbeitsteilung, einschließlich der militärischen Rollen. Sie hatten ihre eigenen Regierungen, Rechtssysteme und Religionen und besaßen und kontrollierten sehr oft ihr eigenes Territorium. Diese Stadtstaaten konkurrierten um die Kontrolle der Ressourcen und des Territoriums, und dieser Wettbewerb wurde oft in Kriegen ausgetragen. Die Kriege der damaligen Zeit waren oft offizielle Angelegenheiten, die von Königen oder ähnlichen Herrschern geführt wurden, und sie waren ein wichtiger Teil der damaligen Politik. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese Stadtstaaten zu größeren und komplexeren Königreichen und Imperien, wie dem Ägyptischen Reich, dem Assyrischen Reich und später dem Persischen, Griechischen und Römischen Reich. Diese Reiche führten zu noch größeren und komplexeren Kriegen, an denen oft Tausende oder sogar Zehntausende von Soldaten beteiligt waren.
Die Phalanx: Ursprünge moderner organisierter Gewalt
Während der klassischen Antike und vor allem während der Zeit des Römischen Reiches machte der Krieg einen qualitativen Sprung in Bezug auf die organisatorische und technologische Komplexität.
In organisatorischer Hinsicht entwickelte sich die römische Armee zu einer wahren Kriegsmaschine mit einer klaren Hierarchie, strenger Disziplin, rigoroser Ausbildung und ausgeklügelter Logistik. Das Modell der römischen Armee, das auf der Legion als Grundeinheit basierte, ermöglichte es den Römern, ihre Streitkräfte schnell und effizient über ein großes Gebiet zu verteilen. In technologischer Hinsicht wurden in dieser Zeit auch neue Waffen und Kriegsgeräte eingeführt und verbreitet. Die Römer entwickelten z. B. das Pilum, eine Art Speer, der dazu gedacht war, Schilde und Rüstungen zu durchdringen. Auch bei der Konstruktion von Belagerungsmaschinen wie Katapulten und Rammböcken gingen sie neue Wege.
Die technologische Dimension des Krieges beschränkte sich nicht auf Waffen und Ausrüstung. Die Römer waren besonders effektiv in der Nutzung von Technik zur Unterstützung ihrer militärischen Bemühungen. Sie bauten zum Beispiel ein ausgedehntes Netz von Straßen und Brücken, um die schnelle Bewegung ihrer Truppen zu erleichtern. Außerdem nutzten sie ihr Ingenieurwissen zum Bau von Forts und Befestigungen und zur Durchführung komplexer Belagerungsoperationen. Diese organisatorischen und technologischen Innovationen machten den Krieg zu einem immer komplexeren und kostspieligeren Unterfangen. Sie haben jedoch auch dazu beigetragen, die Macht von Imperien wie Rom zu stärken, indem sie es ihnen ermöglichten, große Gebiete zu erobern und zu kontrollieren.
Die Entwicklung des Krieges ist eng mit der zunehmenden Komplexität der Gesellschaften verknüpft. Die Phalanx ist ein Paradebeispiel dafür. Die Phalanx war eine Kampfformation, die von den Armeen des antiken Griechenlands verwendet wurde. Sie war eine schwere Infanterieeinheit, die aus Soldaten (Hopliten) bestand, die Seite an Seite in dichten Reihen standen. Jeder Soldat trug einen Schild und war mit einem Langspeer (Sarisse) ausgestattet, mit dem er den Feind angriff, während er hinter dem Schild seines Nachbarn geschützt blieb. Die Phalanx war eine hoch organisierte und disziplinierte Formation, die intensives Training und präzise Koordination erforderte. Ihr Hauptziel war es, den Feind beim ersten Aufprall zu zerschmettern, indem sie die kollektive Kraft der Soldaten nutzte, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen.
Dies war ein großer Fortschritt im Vergleich zu den zuvor verwendeten unordentlicheren Kampfmethoden. Diese komplexere Kampforganisation spiegelt die komplexere Struktur der griechischen Gesellschaft zu dieser Zeit wider. Die Armeen der Bürgersoldaten mussten gut diszipliniert und gut ausgebildet sein, um die Phalanx effektiv einsetzen zu können. Alexander der Große perfektionierte auf seinen militärischen Feldzügen den Einsatz der Phalanx und fügte Elemente der Kavallerie und der leichten Infanterie hinzu, um eine flexiblere und anpassungsfähigere Streitmacht zu schaffen. Dies trug zu seinen militärischen Erfolgen und der Expansion seines Reiches bei.
Die Entwicklung der Kriegsführung wurde maßgeblich durch den technologischen Fortschritt beeinflusst. Als sich die Gesellschaften weiterentwickelten und komplexer wurden, spielte die Technologie eine immer größere Rolle bei der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Von den Phalanxen im antiken Griechenland über den Einsatz von Katapulten und anderen Belagerungsmaschinen im Mittelalter bis hin zur Verwendung von Schießpulver in China und Europa hat die Technologie stets zur Gestaltung militärischer Strategien beigetragen. Dieser Trend setzte sich in der Neuzeit mit der Entwicklung von Artillerie, dampfbetriebenen Kriegsschiffen, U-Booten, Flugzeugen, Panzern und schließlich Atomwaffen fort. In jüngerer Zeit sind Cyberwar und bewaffnete Drohnen zu Schlüsselelementen des zeitgenössischen Schlachtfelds geworden. Die Technologie hat nicht nur Taktiken und Kampfstrategien beeinflusst, sondern auch die Logistik, die Kommunikation und die militärische Aufklärung verändert. Sie hat schnellere, effektivere und großflächigere Militäraktionen ermöglicht.
Das Mittelalter war geprägt von einem Wandel in der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Mit dem Untergang des Römischen Reiches gingen die fortschrittliche Militärorganisation und -technologie der Römer verloren. Die Konflikte dieser Zeit waren oft eher feudaler Natur, an denen Ritter und lokale Herrscher beteiligt waren, und die Schlachten waren oft kleiner und weiter verstreut. Der Krieg konzentrierte sich eher auf die Belagerung von Burgen und Überfälle als auf große, gereihte Schlachten.
Im 15. Jahrhundert, mit dem Beginn der Renaissance und der Bildung der ersten modernen Nationalstaaten, erleben wir einen weiteren Wandel des Krieges. Technologische Innovationen, insbesondere die Einführung von Artillerie und Feuerwaffen, veränderten die Dynamik des Krieges. Die militärische Organisation ist zentralisierter und strukturierter geworden, mit stehenden Armeen unter staatlichem Kommando.
Der moderne Staat spielte auch eine große Rolle bei der Umgestaltung des Krieges. Die Nationalstaaten begannen, die Verantwortung für die Verteidigung und die Sicherheit ihrer Bürger zu übernehmen. Dies führte zur Schaffung von Militärbürokratien, Rekrutierungs- und Ausbildungssystemen sowie einer logistischen Infrastruktur zur Unterstützung stehender Armeen. Der moderne Staat ermöglichte auch die Mobilisierung von Ressourcen in viel größerem Umfang, als dies in früheren feudalen Systemen möglich war. Diese Veränderungen hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wesen des Krieges und legten den Grundstein für den Krieg, wie wir ihn heute kennen.
Der Einfluss des Krieges auf die politische Moderne
Betrachtet man die lange Geschichte der Menschheit, so ist der Krieg, wie wir ihn heute verstehen, ein relativ junges Phänomen. Sein Vorkommen ist eng mit der Entstehung und Entwicklung komplexerer sozialer und politischer Strukturen verbunden. Wenn wir bis in die Steinzeit zurückgehen, finden wir nur wenige Hinweise auf organisierte Gewalt in großem Maßstab. Das Aufkommen des Krieges wird in der Regel mit dem Aufkommen der Zivilisation in Verbindung gebracht, das mit der neolithischen Revolution begann, als die Menschen begannen, sesshaft zu werden und organisiertere Gesellschaften zu schaffen. Mit dem Aufkommen der ersten Stadtstaaten um 5000 v. Chr. wurde der Krieg zu einem häufigeren Phänomen, da diese politischen Einheiten um Territorium und Ressourcen konkurrierten. Der Krieg nimmt eine organisiertere und strukturiertere Form an, mit stehenden Armeen und einer Militärstrategie. Die Entwicklung der modernen Kriegsführung ab dem 17. Jahrhundert fällt mit der Entstehung des modernen Staates zusammen. Mit größeren Ressourcen und einer zentralisierten Verwaltungsstruktur waren die Nationalstaaten in der Lage, Kriege in einem nie dagewesenen Ausmaß und mit einer nie dagewesenen Intensität zu führen.
Die Geschichte des Krieges ist auch die Geschichte des Staates. Einerseits kann die Bedrohung durch den Krieg die Gründung von Staaten fördern. Angesichts feindseliger Nachbarn können sich Gemeinschaften dafür entscheiden, sich unter einer einzigen politischen Autorität zu vereinen, um sich zu verteidigen. Der moderne Staat ist häufig aus diesem Prozess hervorgegangen, wie das berühmte Zitat von Thomas Hobbes veranschaulicht: "Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf". Andererseits erfordert die Kriegsführung eine groß angelegte Organisation und Koordination. Staaten haben diese Struktur bereitgestellt, indem sie Armeen aufstellten, Steuern zur Finanzierung von Militärkampagnen erhoben und Militärstrategien und -politiken festlegten. In Kriegszeiten haben Staaten oft ihre Macht und Reichweite vergrößert, sowohl über ihre eigenen Bürger als auch über das von ihnen kontrollierte Gebiet. Schließlich haben Kriege oft die Form und das Wesen von Staaten verändert. Konflikte können zur Auflösung oder zur Gründung neuer Staaten führen, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, in der viele Kolonialreiche untergingen und neue Nationalstaaten entstanden. Es ist schwierig, die Geschichte des Staates zu verstehen, ohne die Rolle des Krieges zu berücksichtigen, und umgekehrt.
Der Krieg und der moderne Staat sind in der politischen Geschichte tief miteinander verbunden. Diese Beziehung ist zentral, um die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften und die Form, die bewaffnete Konflikte annehmen, zu verstehen. Der moderne Staat, wie er sich in Europa ab dem 17. Jahrhundert entwickelte, ist durch eine Zentralisierung der Macht und ein Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt gekennzeichnet. Die Bildung von Nationalstaaten und die Entstehung des westfälischen Systems fielen mit einer bedeutenden Veränderung des Wesens des Krieges zusammen. Erstens hat der moderne Staat den Krieg institutionalisiert. Der Staat hat das Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt, und der Krieg wurde zur Staatsangelegenheit. Diese Entwicklung ermöglichte die Einführung von Regeln und Strukturen rund um die Kriegsführung. Zweitens hat der moderne Staat den Krieg professionalisiert. Mit der Zentralisierung der Macht waren die Staaten in der Lage, stehende Armeen zu unterhalten. Dies führte zu zunehmend organisierten und technologisch fortschrittlichen Kriegen. Drittens: Der moderne Staat hat den Krieg verstaatlicht. In vormodernen Gesellschaften wurden Kriege oft von Fürsten oder Häuptlingen geführt, die in ihrem eigenen Namen handelten. Mit dem modernen Staat wurde der Krieg zu einer Angelegenheit der gesamten Nation. Der Krieg, so wie wir ihn heute verstehen, ist eine Schöpfung des modernen Staates. Er ist das Produkt der Entwicklung der menschlichen politischen Organisation und der Konzentration der Macht in den Händen des Staates.
Der Staat, wie wir ihn heute verstehen, ist eine spezifische Form der politischen Organisation, die sich in einer bestimmten Periode der Geschichte herausgebildet hat. Es gibt viele andere politische Organisationsformen, die es im Laufe der Geschichte gegeben hat und die in einigen Teilen der Welt auch heute noch existieren. Imperien zum Beispiel waren in der Antike und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine gängige Form der politischen Organisation. Sie zeichneten sich durch eine zentrale Autorität (meist ein Kaiser oder König) aus, die über eine Reihe unterschiedlicher Gebiete und Völker herrschte. Stadtstaaten waren eine andere Form der politischen Organisation, die besonders im antiken Griechenland und im Italien der Renaissance verbreitet war. In diesem System bildeten eine Stadt und ihr umliegendes Gebiet eine unabhängige politische Einheit. Auch Kolonien sind eine Form der politischen Organisation, wenn auch häufig unter der Herrschaft einer anderen politischen Einheit (wie einem Reich oder einem Staat). Besonders häufig waren Kolonien in der Ära des europäischen Imperialismus vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Davon abgesehen ist der Staat zwar eine spezifische und relativ neue Form der politischen Organisation, doch hatte er einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wesen des Krieges und die Art und Weise, wie er geführt wird. Deshalb ist das Studium des Staates so wichtig, um den modernen Krieg zu verstehen.
Der Staat wird häufig als eine Struktur wahrgenommen, die notwendig ist, um soziale Stabilität, Sicherheit, die Einhaltung von Gesetzen und die Bereitstellung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit, Transport usw. zu gewährleisten. Diese positive Wahrnehmung des Staates sollte uns jedoch nicht davon abhalten, die komplexeren und manchmal problematischen Aspekte der Existenz des Staates zu verstehen. Einer dieser Aspekte hängt mit dem Monopol legitimer Gewalt zusammen, das der Staat nach der klassischen soziologischen Theorie von Max Weber besitzt. Dieses Monopol ermöglicht es dem Staat, die Ordnung aufrechtzuerhalten und das Gesetz durchzusetzen, aber es ermöglicht dem Staat auch, Krieg zu führen. Die Tatsache, dass Krieg in der Regel von Staaten geführt wird und untrennbar mit der Entstehung und Entwicklung des modernen Staates verbunden ist, ist eine Erinnerung daran, dass der Staat nicht nur eine Kraft der Stabilität und des Wohlstands ist, sondern auch eine Quelle der Gewalt und des Konflikts sein kann. Dies ist ein Aspekt, den wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir über den Staat und seine Rolle in der Gesellschaft nachdenken. Krieg, Gewalt und Konflikt sind nicht einfach nur Abnormitäten, sondern ein integraler Bestandteil der Natur des Staates. Deshalb ist das Verständnis des Krieges so entscheidend für das Verständnis des Staates.
Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist es, innerhalb seiner Grenzen für Frieden und Ordnung zu sorgen. Diese Aufgabe wird durch eine Reihe von Institutionen wie die Polizei und das Justizsystem erfüllt, deren Aufgabe es ist, das Gesetz durchzusetzen und Konflikte zwischen den Bürgern zu verhindern oder zu lösen. Der Staat wird oft als Garant für Sicherheit und Stabilität angesehen, und das ist einer der Gründe, warum die Bürger bereit sind, einen Teil ihrer Freiheit und Macht an ihn abzutreten. Jenseits der Staatsgrenzen sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Auf internationaler Ebene gibt es keine mit einem Staat vergleichbare Einheit, die in der Lage wäre, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Beziehungen zwischen Staaten werden oft als ein Zustand der "Anarchie" in dem Sinne beschrieben, dass es keine übergeordnete zentrale Autorität gibt. Dies kann zu Konflikten und Kriegen führen, da jeder Staat die Freiheit hat, so zu handeln, wie er es für richtig hält, um seine Interessen zu verteidigen.
Der Staat spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrung des internationalen Friedens. Als Teilnehmer an internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der WTO, der NATO und anderen hilft der Staat bei der Formulierung und Einhaltung internationaler Normen und Regeln, die für die Vermeidung und Bewältigung von Konflikten zwischen Nationen von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus beteiligen sich Staaten durch die Unterzeichnung und Einhaltung internationaler Verträge aktiv an der Schaffung einer regelbasierten Weltordnung, die zu Stabilität und Sicherheit auf internationaler Ebene beiträgt. In diesem Sinne wird der Staat als ein wesentlicher Akteur der modernen Zivilisation gesehen, der in der Lage ist, Ordnung zu schaffen und aufrechtzuerhalten, Zusammenarbeit zu fördern und Chaos und Anarchie zu verhindern. Dies wird im Allgemeinen als positive Entwicklung im Vergleich zu früheren historischen Perioden gesehen, in denen Gewalt und Krieg die gängigeren Mittel zur Lösung von Konflikten waren.
Eine der wichtigsten Rechtfertigungen für die Existenz des Staates liegt in seiner Fähigkeit, die Ordnung aufrechtzuerhalten und Chaos zu verhindern. Das Konzept des "Monopols der legitimen Gewalt" ist hier von grundlegender Bedeutung. Nach diesem Konzept, das von dem deutschen Soziologen Max Weber formuliert wurde, hat der Staat das ausschließliche Recht, innerhalb der Grenzen seines Hoheitsgebiets physische Gewalt anzuwenden, anzudrohen oder zuzulassen. In diesem Sinne wird der Staat oft als Gegenmittel zum Hobbes'schen "Naturzustand" betrachtet, in dem das Leben in Abwesenheit einer zentralisierten Macht "einsam, arm, brutal und kurz" wäre. Daher wird der Staat häufig als der Akteur betrachtet, der für Ordnung sorgt, Chaos und Anarchie verhindert und die Sicherheit seiner Bürger gewährleistet.
Ein effizienter Staat ist in der Regel in der Lage, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und grundlegende öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, wodurch er zur sozialen Stabilität und zum sozialen Frieden beiträgt. In Gebieten, in denen der Staat schwach, abwesend oder ineffizient ist, kann es jedoch zu chaotischen Zuständen kommen. Konfliktgebiete sind beispielsweise häufig durch das Fehlen eines funktionierenden Staates gekennzeichnet, der in der Lage ist, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ebenso kann in zerfallenen oder gescheiterten Staaten die Unfähigkeit, Sicherheit zu gewährleisten und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen, zu einem hohen Maß an Gewalt, Kriminalität und Instabilität führen.
Massengewalt wie Völkermorde sind Phänomene, die durch die Entstehung des modernen Staates und der industriellen Technologie erheblich erleichtert wurden. Bürokratische Effizienz, Mobilisierungsfähigkeit und die Kontrolle über große Ressourcen, die typische Merkmale moderner Staaten sind, können leider für zerstörerische Zwecke missbraucht werden. Nehmen wir als Beispiel die Shoah während des Zweiten Weltkriegs. Die systematische und groß angelegte Vernichtung der Juden und anderer Gruppen durch die Nationalsozialisten wurde durch den modernen Industriestaat und seinen bürokratischen Apparat ermöglicht. Auch der Völkermord in Ruanda 1994, bei dem innerhalb weniger Monate rund 800.000 Tutsi getötet wurden, wurde in großem Maßstab und mit erschreckender Effizienz größtenteils durch die Mobilisierung staatlicher Strukturen und Ressourcen durchgeführt.
Die beiden Weltkriege sind typische Beispiele für den totalen Krieg, ein Konzept, das einen Konflikt beschreibt, in dem die beteiligten Nationen alle ihre wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ressourcen mobilisieren, um den Krieg zu führen, und in dem die Unterscheidung zwischen Zivilisten und militärischen Kombattanten verwischt wird, wodurch die gesamte Bevölkerung den Schrecken des Krieges ausgesetzt wird. Der Erste Weltkrieg führte eine Industrialisierung und Mechanisierung des Krieges in einem nie dagewesenen Ausmaß ein, mit dem massiven Einsatz neuer Technologien wie schwerer Artillerie, Flugzeugen, Panzern und Giftgas. Die Gewalt dieses Krieges wurde durch die totale Beteiligung der kriegführenden Nationen verstärkt, wobei ihre Wirtschaft und Gesellschaft vollständig für die Kriegsanstrengungen mobilisiert wurden. Der Zweite Weltkrieg intensivierte das Konzept des totalen Krieges noch weiter. Er war durch die massive Bombardierung ganzer Städte, die systematische Ausrottung der Zivilbevölkerung und den Einsatz von Atomwaffen gekennzeichnet. In diesem Krieg wurden auch Propaganda in großem Stil eingesetzt, die Kriegswirtschaft ausgenutzt und Arbeitskräfte in großem Umfang mobilisiert. Somit ist der totale Krieg ein weiterer Ausdruck dafür, wie die Moderne und der moderne Staat die Entstehung neuer Formen der Gewalt in großem Maßstab ermöglicht haben.
Das 20. Jahrhundert war aufgrund der beiden Weltkriege, zahlreicher regionaler Konflikte, Völkermorde und totalitärer Regime von beispielloser Gewalt geprägt. Dieses Ausmaß an Gewalt wird häufig auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt, darunter die Entstehung mächtiger moderner Staaten, die Verfügbarkeit von Massenvernichtungswaffen und extreme Ideologien. Die Weltkriege haben zig Millionen Menschenleben gefordert. Darüber hinaus haben andere Konflikte wie der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Völkermord an den Armeniern, der Holocaust, der Völkermord in Ruanda sowie die stalinistischen und maoistischen Säuberungen den Tod von weiteren Millionen Menschen verursacht. Auch interne politische Gewalt, die häufig von totalitären Regimen ausgeübt wurde, war im 20. Jahrhundert eine wichtige Quelle der Gewalt. Regime wie Stalin in der Sowjetunion, Mao in China, Pol Pot in Kambodscha und viele andere setzten politische Gewalt ein, um Gegner auszuschalten, ideologische Ziele zu erreichen oder ihre Macht zu erhalten. Alles in allem zeigt die Gewalt des 20. Jahrhunderts, wie zweischneidig die Moderne und der moderne Staat waren: Einerseits ermöglichten sie ein beispielloses Maß an Entwicklung, Wohlstand und Stabilität in vielen Teilen der Welt; andererseits ermöglichten sie ein beispielloses Maß an Gewalt und Zerstörung.
Der moderne Staat, der durch seine Souveränität, sein definiertes Territorium, seine Bevölkerung und seine Regierung gekennzeichnet ist, soll seinen Bürgern Schutz vor Gewalt bieten. Er soll Ordnung und Stabilität durch Rechtsstaatlichkeit, eine effiziente Verwaltung und den Schutz der Rechte und Freiheiten seiner Bürger gewährleisten. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt jedoch, dass der moderne Staat auch eine Hauptquelle der Gewalt sein kann. Weltkriege, regionale Konflikte, Völkermord und politische Säuberungen wurden weitgehend von modernen Staaten verübt oder erleichtert. Diese Formen der Gewalt stehen häufig im Zusammenhang mit der Ausübung staatlicher Macht, der Verteidigung der bestehenden Ordnung oder der Durchsetzung bestimmter Ideologien oder Politiken. Der moderne Staat hat also zwei Seiten. Einerseits kann er Ordnung, Sicherheit und Stabilität garantieren und einen Rahmen für Wohlstand und Entwicklung bieten. Andererseits kann er eine Hauptquelle von Gewalt und Unterdrückung sein, insbesondere wenn er für Kriegszwecke, politische Unterdrückung oder zur Durchsetzung bestimmter ideologischer Ziele eingesetzt wird. Es ist wichtig, dieses Paradoxon zu verstehen, um die Komplexität der politischen und sozialen Herausforderungen zu erfassen, mit denen wir in der modernen Welt konfrontiert sind.
Entwicklung des Krieges im Laufe der Geschichte
Der Krieg als Konstrukteur des modernen Staates
Um den Krieg zu untersuchen, muss man sich vor allem auf seine Verbindungen zum modernen Staat als politische Organisation konzentrieren. Wir werden sehen, wie der Krieg heute durch und durch die Entstehung des modernen Staates ist. Wir werden zunächst feststellen, dass der Krieg eine Angelegenheit des Staates ist. Um die Idee einzuführen, dass der Krieg mit dem Aufbau des Staates selbst und der Entstehung des Staates als politische Organisationsform in Europa ab dem Ausgang des Mittelalters verbunden ist, dafür ist der beste Weg und wie von dem Soziohistoriker Charles Tilly in seinem Artikel War Making and State Making as Organized Crime gebracht, der die Idee von war making/state making entwickelt hat: Durch das Führen von Kriegen wurde der Staat gemacht und umgekehrt.
In "War Making and State Making as Organized Crime" bietet Charles Tilly eine provokante sozio-historische Analyse des Aufbaus des modernen Staates in Westeuropa. Er argumentiert, dass die Prozesse der Staatsbildung und des Krieges intrinsisch miteinander verbunden sind, und er vergleicht Staaten sogar mit kriminellen Organisationen, um die Zwangs- und Ausbeutungsaspekte ihrer Entstehung hervorzuheben. Tilly zufolge wird die Bildung moderner Staaten weitgehend von den Bemühungen der herrschenden Eliten angetrieben, die für den Krieg notwendigen Ressourcen zu mobilisieren. Zu diesem Zweck greifen diese Eliten auf Mittel wie Besteuerung, Einberufung und Enteignung zurück, die mit Formen von Erpressung und Schutzgelderpressung gleichgesetzt werden können. Darüber hinaus argumentiert Tilly, dass der Aufbau des Staates auch durch die Monopolisierung der Anwendung legitimer Gewalt erleichtert wurde. Mit anderen Worten: Die Herrscher waren bestrebt, alle anderen Quellen von Macht und Autorität in ihrem Gebiet zu beseitigen oder unterzuordnen, darunter Feudalherren, Zünfte, Gilden und bewaffnete Banden. Dieser Prozess war häufig mit der Anwendung von Gewalt, Zwang und politischer Manipulation verbunden. Schließlich betont Tilly, dass der Aufbau des Staates auch die Herstellung eines sozialen Konsenses oder zumindest die Zustimmung der Bevölkerung erforderte, und zwar durch die Entwicklung einer nationalen Identität, die Schaffung sozialer und politischer Institutionen und die Bereitstellung von Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen. Diese Analyse bietet eine kritische und entlarvende Perspektive auf den Aufbau moderner Staaten, beleuchtet ihre gewalttätigen und zwanghaften Wurzeln und unterstreicht gleichzeitig ihre Schlüsselrolle bei der Strukturierung unserer heutigen Gesellschaften.
Die Vorstellung vom modernen Staat, wie wir ihn heute kennen, basiert hauptsächlich auf dem europäischen Modell, das sich während der Renaissance und der Neuzeit zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert herausbildete. Diese Entwicklung war gekennzeichnet durch die Zentralisierung der politischen Macht, die Bildung definierter nationaler Grenzen, die Entwicklung einer Verwaltungsbürokratie und die Monopolisierung der Anwendung legitimer Gewalt durch den Staat. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es in anderen Teilen der Welt auch andere politische Modelle gibt, die auf unterschiedlichen historischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Verläufen beruhen. Beispielsweise kann die politische Struktur in manchen Gesellschaften stärker dezentralisiert sein oder auf anderen Prinzipien wie Gegenseitigkeit, Hierarchie oder Gleichheit beruhen. Darüber hinaus ist der Prozess des Exports des europäischen Staatsmodells, insbesondere durch die Kolonialisierung und in jüngerer Zeit durch Staatsaufbau oder Nation-Building, häufig auf Widerstand gestoßen und konnte zu Konflikten und Spannungen führen. Dies ist häufig darauf zurückzuführen, dass diese Prozesse möglicherweise die lokalen Gegebenheiten nicht berücksichtigen und manchmal als Formen der kulturellen oder politischen Auferlegung wahrgenommen werden können.
Charles Tilly schlägt in seinem Artikel "War Making and State Making as Organized Crime" einen Denkrahmen vor, um den Prozess der Staatenbildung zu verstehen, wobei er sich insbesondere auf Europa zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert konzentriert. Tilly sieht den Prozess der Staatsentstehung als ein Produkt zweier miteinander verbundener Dynamiken: war making (Krieg) und state making (Staatsbildung).
- War making: Tilly postuliert, dass Staaten durch die ständige Notwendigkeit geformt wurden, sich auf Kriege vorzubereiten, sie zu führen und zu finanzieren. Kriege, insbesondere im europäischen Kontext, waren Schlüsselfaktoren für die Entwicklung staatlicher Strukturen, vor allem aufgrund der Ressourcen, die für die Durchführung von Kriegen benötigt wurden.
- State making: Hierbei handelt es sich um den Prozess, durch den die Zentralgewalt eines Staates gefestigt wird. Für Tilly bedeutet dies, dass er seine internen Rivalen (insbesondere die Feudalherren) kontrolliert und neutralisiert und seine Autorität über das gesamte von ihm kontrollierte Gebiet durchsetzt.
Diese beiden Prozesse sind eng miteinander verknüpft, da Kriege den Anstoß für die Konsolidierung des Staates liefern und gleichzeitig selbst durch diese Konsolidierung ermöglicht werden. Um Kriege zu finanzieren, mussten die Staaten beispielsweise effizientere Steuer- und Verwaltungssysteme einführen, was ihre Autorität stärkte.
Krieg und der moderne Staat
Das Feudalsystem war eine komplexe Struktur der Beziehungen zwischen den Grundherren und dem König, die auf Landbesitz (oder "Lehen") und Loyalität beruhte. Die Lehnsherren hatten eine große Autonomie über ihr Land und waren in der Regel für die Sicherheit und Gerechtigkeit auf ihrem Land verantwortlich. Als Gegenleistung für ihr Lehen mussten sie dem König Treue schwören und ihm militärische Unterstützung gewähren, wenn er sie brauchte. Dieses Vasallensystem bildete die Grundlage der Macht während des Mittelalters. Mit dem Aufkommen des modernen Staates wurde dieses System jedoch allmählich abgelöst. Die Konsolidierung des Staates ging mit dem Bestreben einher, die Macht zu zentralisieren, was häufig mit der Beseitigung oder Reduzierung der Macht der Feudalherren einherging. Ein Schlüsselelement in diesem Prozess war die Notwendigkeit, den Krieg zu finanzieren und zu unterstützen. Die Könige begannen, Verwaltungs- und Steuerstrukturen zu entwickeln, um Gelder zu beschaffen und Armeen direkt zu rekrutieren, anstatt sich auf die Feudalherren zu verlassen. Dies stärkte ihre Autorität und ermöglichte die Bildung von Staaten, die stärker zentralisiert und bürokratisiert waren.
Laut Charles Tilly war der Krieg eine starke Triebfeder für die Entstehung des modernen Staates. Im Mittelalter führte der Wettbewerb zwischen den Fürsten, ihr Territorium zu vergrößern und ihre Macht zu steigern, oft zu Konflikten. Die Fürsten kämpften ständig gegeneinander und versuchten, die Kontrolle über das Land und die Ressourcen der anderen zu erlangen. Außerdem waren diese Konflikte auf lokaler Ebene oft mit größeren Konflikten zwischen den Königreichen verbunden. Die Könige brauchten eine starke Machtbasis, um ihre Kriegsanstrengungen zu unterstützen, was dazu führte, dass sie versuchten, ihre Kontrolle über ihre Fürsten zu stärken. Diese Dynamiken erzeugten einen ständigen Druck zu einer stärkeren Zentralisierung und effizienteren Organisation. Die Könige entwickelten ausgefeiltere Verwaltungen und effizientere Steuersysteme, um ihre Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Gleichzeitig versuchten sie, die Macht der Feudalherren zu beschränken und ihre eigene Autorität zu behaupten. Diese Prozesse legten den Grundstein für den modernen Staat.
Norbert Elias, ein deutscher Soziologe, entwickelte in seinem Werk "The Civilizing Process" den Begriff des "eliminatorischen Kampfes". In diesem Zusammenhang bezeichnet er einen Wettbewerb, bei dem sich die Akteure gegenseitig eliminieren, bis nur noch wenige oder sogar nur noch einer übrig ist. Im Zusammenhang mit der Staatsbildung kann dies als Metapher für die Art und Weise gesehen werden, wie Feudalherren im Mittelalter um Macht und Territorium kämpften. Im Laufe der Zeit wurden einige Fürsten eliminiert, entweder durch militärische Niederlagen oder durch Assimilation in größere Einheiten. Dieser Prozess des eliminatorischen Kampfes trug zur Zentralisierung der Macht und zur Bildung des modernen Staates bei.
Im Laufe der Jahrhunderte bauten viele französische Könige ihre Macht schrittweise aus, übernahmen die Gebiete des Feudaladels und festigten die zentrale Autorität. Diese Bemühungen wurden häufig durch strategische Heiratsbündnisse, militärische Eroberungen, politische Absprachen und in einigen Fällen durch das natürliche oder erzwungene Aussterben bestimmter Adelslinien unterstützt. Vor allem Ludwig XI. spielte in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Als König von 1461 bis 1483 wurde er aufgrund seiner klugen und manipulativen Politik als "Universelle Aragne" oder "Universelle Spinne" bezeichnet. Ludwig XI. arbeitete hart daran, die königliche Macht zu zentralisieren, den Einfluss der großen Feudalherren zu verringern und eine effizientere und direktere Verwaltung im gesamten Königreich einzuführen. Dies trug zur Bildung des modernen Staates mit einer zentralisierten Macht und einer organisierten Verwaltung bei, der im Laufe der Jahrhunderte weiter ausgebaut wurde, insbesondere durch Franz I. und Ludwig XIV, den "Sonnenkönig".
Frankreich und Großbritannien werden oft als typische Beispiele für die Entstehung des modernen Staates angeführt. In Frankreich zentralisierten die Könige nach und nach die Macht und führten eine direktere und effizientere Verwaltung ein. Der Höhepunkt dieser Zentralisierung wurde wahrscheinlich unter der Herrschaft Ludwigs XIV. erreicht, der erklärte "L'Etat, c'est moi" und direkt von seinem Palast in Versailles aus regierte. Dieser Prozess wurde jedoch von Zeiten des Konflikts und der Revolte unterbrochen, wie der Fronde und später der Französischen Revolution. Großbritannien hingegen ging einen etwas anderen Weg zur Bildung des modernen Staates. König Heinrich VIII. festigte die königliche Macht, indem er die Kirche von England einrichtete und die Klöster auflöste, aber in Großbritannien gab es auch eine starke Bewegung für die Einschränkung der königlichen Macht. Dies gipfelte in der Glorious Revolution von 1688 und der Einführung eines Verfassungssystems, in dem die Macht zwischen dem König und dem Parlament geteilt wurde. In beiden Fällen spielte der Krieg eine große Rolle bei der Staatsbildung. Die Notwendigkeit, Armeen aufzustellen, Steuern zur Finanzierung von Kriegen zu erheben und die innere Ordnung aufrechtzuerhalten, trug wesentlich zur Zentralisierung der Macht und zur Schaffung effizienter Verwaltungsstrukturen bei.
Der externe Wettbewerb, insbesondere ab der Renaissance und während der Neuzeit, war eine wichtige Triebkraft bei der Bildung von Staaten und der Strukturierung des internationalen Systems, wie wir es heute kennen. Dies lässt sich an der Entwicklung von Diplomatie, Bündnissen und Verträgen, Kriegen zur Eroberung und Kontrolle von Territorien und sogar an der kolonialen Expansion ablesen. Dies führte auch zu einer klareren Festlegung von Staatsgrenzen und zur Anerkennung der Souveränität von Staaten. Insbesondere die Beteiligung Ludwigs XI. und seiner Nachfolger an den Kriegen in Italien und gegen England spielte eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung Frankreichs als Staat und bei der Festlegung seiner nationalen Grenzen und Interessen. In ähnlicher Weise hat auch der Wettbewerb zwischen den europäischen Mächten um Gebiete im Ausland während der Ära der Kolonialisierung das internationale System mitgeprägt.
Die imperialen Ambitionen von Herrschern wie Ludwig XI. waren zum Teil von dem Wunsch getrieben, ihre Macht und Autorität sowohl intern als auch extern zu festigen. Sie brauchten Ressourcen, um Kriege zu führen, was oft bedeutete, dass sie von ihren Untertanen höhere Steuern verlangten. Diese Kriege hatten oft auch eine religiöse Dimension, mit der Idee, die christliche Welt wieder zu vereinen. Als sich diese Königreiche entwickelten und begannen, miteinander zu kollidieren, begann sich ein internationales System herauszubilden. Dies war ein langsamer und oft konfliktreicher Prozess mit vielen Kriegen und politischen Konflikten. Doch im Laufe der Zeit begannen diese Staaten, die Souveränität anderer anzuerkennen, Regeln für internationale Interaktionen aufzustellen und Institutionen zu entwickeln, die diese Interaktionen erleichtern sollten.
All dies hat zur Bildung eines Systems miteinander verbundener Nationalstaaten geführt, in dem jeder Staat seine eigenen Interessen und Ziele verfolgt, aber auch eine gewisse Verpflichtung hat, die Souveränität anderer Staaten zu respektieren. Dies ist die Grundlage des internationalen Systems, das wir heute haben, auch wenn sich die Besonderheiten im Laufe der Zeit verändert haben.
Die Rolle des Krieges im zwischenstaatlichen System
Um einen Krieg zu führen (war-making), muss ein Staat erhebliche Ressourcen mobilisieren. Dazu gehören materielle Ressourcen wie Geld, um die Armee zu finanzieren und Waffen zu kaufen, Nahrungsmittel, um die Armee zu ernähren, und Materialien, um Befestigungen und andere militärische Infrastrukturen zu bauen. Es erfordert auch menschliche Ressourcen, wie Soldaten, um zu kämpfen, und Arbeiter, um die benötigten Güter zu produzieren. Um diese Ressourcen zu erhalten, muss der Staat in der Lage sein, eine wirksame Kontrolle über sein Territorium und seine Bewohner auszuüben. Hier kommt der Staatsaufbau (state-making) ins Spiel. Der Staat muss wirksame Steuersysteme einrichten, um das Geld für die Finanzierung des Krieges einzutreiben. Er muss auch in der Lage sein, Soldaten zu rekrutieren oder einzuziehen, was möglicherweise Anstrengungen erfordert, um ein Gefühl der Loyalität oder Pflicht gegenüber dem Staat zu schaffen. Außerdem muss er in der Lage sein, innerhalb seiner Grenzen für Ordnung zu sorgen und Konflikte zu lösen, damit er sich auf den Krieg außerhalb der Grenzen konzentrieren kann. Somit sind Krieg und Staatsaufbau eng miteinander verbunden. Das eine erfordert das andere, und beide verstärken sich gegenseitig. Wie Charles Tilly schrieb: "Staaten führen Kriege und Kriege führen Staaten".
Die Notwendigkeit, Kriege zu führen, hat die Staaten dazu veranlasst, eine effiziente Bürokratie zu entwickeln, die in der Lage ist, Ressourcen zu sammeln und eine Armee zu organisieren. Dieser Prozess stärkte die Fähigkeit des Staates, sein Territorium und seine Einwohner zu regieren, d. h. seine Souveränität. Um die Bevölkerung zu erfassen, Steuern einzutreiben und Soldaten zu rekrutieren, musste der Staat eine Verwaltung aufbauen, die diese Aufgaben bewältigen konnte. Dies bedeutete die Entwicklung von Systemen zur Erfassung von Informationen über die Einwohner, die Einführung von Gesetzen über Steuern und Einberufung und die Schaffung von Stellen, die diese Gesetze durchsetzen sollten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese bürokratischen Systeme weiter und wurden immer effizienter und ausgefeilter. Sie trugen auch dazu bei, die Autorität des Staates zu stärken, indem die Einwohner seine Legitimität akzeptierten. Die Menschen waren eher bereit, Steuern zu zahlen und in der Armee zu dienen, wenn sie glaubten, dass der Staat das Recht hatte, dies von ihnen zu verlangen. Der Krieg spielte eine zentrale Rolle im Prozess des Staatsaufbaus, nicht nur, weil er die Entwicklung einer effizienten Bürokratie förderte, sondern auch, weil er die Autorität und Legitimität des Staates stärkte.
Charles Tilly zufolge entwickelte sich der moderne Staat aus einem langfristigen Prozess, der als "war making" (Krieg) und "state making" (Staatsaufbau) bezeichnet wird. Diese Theorie behauptet, dass Kriege die Hauptantriebskräfte für die Zunahme der Macht und Autorität des Staates in der Gesellschaft waren. Tillys Theorie legt nahe, dass sich der moderne Staat in einem Kontext von Konflikt und Gewalt gebildet hat, in dem die Fähigkeit, Kriege zu führen und ein Gebiet effektiv zu kontrollieren, Schlüsselfaktoren für das Überleben und den Erfolg des Staates waren.
Nach dem Ende des Mittelalters trat Europa in eine Zeit des intensiven Wettbewerbs zwischen den aufstrebenden Nationalstaaten ein. Diese Staaten versuchten, ihren Einfluss auszuweiten und ihre Vorherrschaft über andere zu behaupten, was häufig zu Kriegen führte. Eines der symbolträchtigsten Beispiele für diese Zeit ist Napoleon Bonaparte. Als Kaiser von Frankreich strebte Napoleon eine französische Herrschaft auf dem europäischen Kontinent an und schuf ein Reich, das sich von Spanien bis Russland erstreckte. Sein Versuch, ein grenzenloses und inklusives Imperium zu schaffen, war in Wirklichkeit ein Versuch, andere Nationen dem Willen Frankreichs zu unterwerfen. Diese Zeit der Rivalitäten und Kriege ermöglichte jedoch auch die Konsolidierung des Nationalstaats als wichtigste Form der politischen Organisation. Die Staaten verstärkten die Kontrolle über ihr Territorium, zentralisierten ihre Autorität und entwickelten bürokratische Institutionen, um ihre Angelegenheiten zu verwalten. Die Entstehung des modernen Nationalstaats in der nachmittelalterlichen Zeit war zum großen Teil das Produkt imperialer Ambitionen und zwischenstaatlicher Rivalitäten. Diese Faktoren führten zur Etablierung eines zwischenstaatlichen Systems, das auf Souveränität und Krieg als Mittel zur Konfliktlösung basierte. Und diese Entwicklung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf unsere heutige Welt.
Nach einer Zeit intensiver Kriege und Konflikte hat sich zwischen den europäischen Nationalstaaten ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte eingestellt. Dieses Gleichgewicht, das häufig als "Gleichgewicht der Mächte" bezeichnet wird, ist zu einem Grundprinzip der internationalen Politik geworden. Das Gleichgewicht der Kräfte geht davon aus, dass die nationale Sicherheit gewährleistet ist, wenn die militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten so verteilt sind, dass kein Staat in der Lage ist, die anderen zu dominieren. Dies fördert die Zusammenarbeit, den friedlichen Wettbewerb und hilft theoretisch, Kriege zu verhindern, indem es von Aggressionen abhält. Darüber hinaus hat dieser Prozess auch zu einer Stabilisierung der Grenzen geführt. Die Staaten erkannten schließlich die Grenzen des jeweils anderen an und respektierten sie, was dazu beitrug, Spannungen abzubauen und den Frieden zu erhalten.
Von da an entstand die Idee der Souveränität, d. h. die Idee der Autorität über das Territorium wurde in Räume aufgeteilt, über die Souveränität ausgeübt wird, die sich untereinander ausschließen. Souveränität ist ein Grundprinzip des modernen internationalen Systems, das auf der Vorstellung beruht, dass jeder Staat die höchste und ausschließliche Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung besitzt. Diese Autorität umfasst das Recht, Gesetze zu erlassen, diese Gesetze anzuwenden und diejenigen zu bestrafen, die gegen sie verstoßen, die Grenzen zu kontrollieren, diplomatische Beziehungen zu anderen Staaten zu pflegen und gegebenenfalls den Krieg zu erklären. Souveränität ist untrennbar mit dem Begriff des Nationalstaats verbunden und grundlegend für das Verständnis der Dynamik der internationalen Beziehungen. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Staat das Recht hat, seine eigenen inneren Angelegenheiten ohne Einmischung von außen zu regeln, was von anderen Staaten im internationalen System als Recht anerkannt wird.
Langfristig entwickelt sich um das Souveränitätsprinzip herum ein Universalismus des Nationalstaats, der nicht der des Imperiums ist, da das Souveränitätsprinzip von allen als organisierendes Prinzip des internationalen Systems anerkannt wird. Das Prinzip der Souveränität und der Gleichheit aller Staaten ist eine Grundlage des internationalen Systems und der Vereinten Nationen. Das bedeutet, dass theoretisch jeder Staat, ob groß oder klein, reich oder arm, z. B. in der Generalversammlung der Vereinten Nationen nur eine Stimme hat. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der souveränen Gleichheit, der in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist. In Artikel 2 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen heißt es, dass die Organisation auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder beruht.
Die Idee der Vereinten Nationen entspringt der Idee des Prinzips der Souveränität als Organisator des internationalen Systems. Dieses sich entwickelnde zwischenstaatliche System ist um die Idee herum organisiert, dass es eine Logik des internen Gleichgewichts gibt, bei der der Staat ein Gebiet verwaltet, d. h. die "Polizei"; und extern, bei der die Staaten untereinander ihre Angelegenheiten regeln. Diese Unterscheidung ist ein zentraler Aspekt des Konzepts der staatlichen Souveränität. Es ist der Staat, der das Vorrecht und die Pflicht hat, die inneren Angelegenheiten zu regeln, einschließlich der Durchsetzung von Gesetzen, der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung, der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und der Rechtspflege. Dies wird als interne Souveränität bezeichnet. In Bezug auf die externe Souveränität ist dies das Recht und die Fähigkeit eines Staates, auf der internationalen Bühne autonom zu handeln. Dazu gehört das Recht, mit anderen Staaten in Beziehung zu treten, internationale Verträge zu unterzeichnen, sich an internationalen Organisationen zu beteiligen und seine Außenpolitik nach seinen eigenen Interessen zu betreiben.
In dem Moment, in dem es all diese Staaten gibt, die gebildet werden, müssen sie auch miteinander kommunizieren. Da jeder als Staat überleben muss und es noch andere Staaten gibt, wie sollen wir da kommunizieren? Wenn wir davon ausgehen, dass der Krieg eine Institution ist, dient er genau diesem Zweck. Der Krieg als Institution war ein Mittel für Staaten, um miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Krieg wünschenswert oder unvermeidbar ist, aber er hat sicherlich eine Rolle bei der Bildung von Staaten und bei der Definition der Beziehungen zwischen ihnen gespielt. In der europäischen Geschichte wurden Kriege beispielsweise häufig dazu genutzt, Konflikte über Territorium, Macht, Ressourcen oder Ideologie zu lösen. Die Ergebnisse dieser Kriege führten oft zu Veränderungen der Grenzen, Bündnisse und Machtverhältnisse zwischen den Staaten.
Laut John Vasquez ist Krieg eine erlernte Modalität der politischen Entscheidungsfindung, durch die zwei oder mehr politische Einheiten auf der Grundlage eines gewalttätigen Wettbewerbs materielle Güter oder Güter von symbolischem Wert zuteilen. Die Definition von John Vasquez hebt den Aspekt des gewaltsamen Wettbewerbs im Krieg hervor. Nach dieser Sichtweise ist Krieg ein Mechanismus, mit dem politische Einheiten, in der Regel Staaten, ihre Meinungsverschiedenheiten oder Rivalitäten lösen. Dabei kann es um Macht, Territorium, Ressourcen oder Ideologien gehen. Diese Definition unterstreicht eine Sichtweise des Krieges, die fest in einer realistischen Denktradition in den internationalen Beziehungen verankert ist, die die internationale Politik als einen Kampf aller gegen alle sieht, bei dem Konflikte unvermeidlich sind und der Krieg ein natürliches Mittel der Politik ist.
Wir entfernen uns von der Vorstellung des Krieges als etwas Anarchischem oder Gewalttätigem. Krieg ist etwas, das in seinem modernen Verständnis entwickelt wurde, um Streitigkeiten zwischen Staaten beizulegen, er ist ein Mechanismus zur Konfliktlösung. Dies erscheint kontraintuitiv, da Krieg im Allgemeinen mit Anarchie und Gewalt in Verbindung gebracht wird. Im Kontext der internationalen Beziehungen und der politischen Theorie kann der Krieg jedoch trotz seiner tragischen Folgen als ein Mechanismus zur Lösung von Konflikten zwischen Staaten verstanden werden. Diese Perspektive versucht nicht, die durch den Krieg verursachte Gewalt und Zerstörung zu verharmlosen, sondern vielmehr zu verstehen, wie und warum sich Staaten für den Einsatz militärischer Gewalt entscheiden, um ihre Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Aus dieser Perspektive ist Krieg kein chaotischer Zustand, sondern eine Form des politischen Verhaltens, die von bestimmten Normen, Regeln und Strategien bestimmt wird. Aus diesem Grund wird der Krieg oft als "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" beschrieben - ein berühmter Satz des Militärtheoretikers Carl von Clausewitz. Das bedeutet, dass der Krieg von Staaten als Instrument eingesetzt wird, um politische Ziele zu erreichen, wenn andere Mittel versagen.
Krieg kann als ultimativer Konfliktlösungsmechanismus verstanden werden, der eingesetzt wird, wenn Meinungsverschiedenheiten nicht mit anderen Mitteln gelöst werden können. Dieser Prozess erfordert die Mobilisierung bedeutender Ressourcen, wie z. B. Streitkräfte, die aus den Steuereinnahmen der kriegführenden Staaten finanziert werden. Das Endziel ist eine Einigung, die oft durch den Ausgang der Kämpfe bestimmt wird. Ein Sieg führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer endgültigen Beilegung des Konflikts zugunsten des Siegers. Der Ausgang eines Krieges kann zu Kompromissen, politischen und territorialen Veränderungen und manchmal sogar zur Entstehung neuer Streitigkeiten führen.
Krieg kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Aus einer humanitären Perspektive wird er häufig im Hinblick auf das Leid und die Verluste an Menschenleben gesehen, die er verursacht. Aus dieser Perspektive ergeben sich Fragen zum Schutz der Zivilbevölkerung, zu den Menschenrechten und den Auswirkungen auf die sozioökonomische Entwicklung der betroffenen Gebiete. Aus rechtlicher Sicht ist der Krieg mit einer komplexen Reihe von internationalen Regelungen und Gesetzen verbunden, darunter das humanitäre Völkerrecht, das Kriegsrecht und verschiedene internationale Abkommen und Verträge. Diese Regelungen zielen darauf ab, die Auswirkungen des Krieges zu begrenzen, insbesondere durch den Schutz von Zivilisten und das Verbot bestimmter Praktiken und Waffen. Trotz dieser Regelungen bleiben die rechtlichen Herausforderungen jedoch hoch, insbesondere wenn es darum geht, die Legitimität einer bewaffneten Intervention zu bestimmen, die Verantwortlichkeiten bei Verstößen gegen das Völkerrecht zu bewerten oder die Folgen nach einem Konflikt, wie Übergangsjustiz und Wiederaufbau, zu bewältigen.
Alles in allem ist Krieg als Konfliktlösungsmechanismus ein komplexes Phänomen, das sowohl humanitäre als auch politische, wirtschaftliche und rechtliche Fragen aufwirft. Der Blickwinkel dieses Kurses ist der der Politikwissenschaft, um zu sehen, woher dieses Phänomen kommt und wozu es dient. Wir beschäftigen uns hier nicht mit der normativen Dimension des Krieges.
Wir kommen zu der Idee, dass Krieg ein Konfliktlösungsmechanismus ist und dass daher, wenn die Strategie ein Ende hat, das Ende und das Ziel dieser Strategie der Frieden ist. Das ultimative Ziel der Militärstrategie ist oft die Schaffung oder Wiederherstellung des Friedens, auch wenn der Weg dorthin die Anwendung von Gewalt beinhaltet. Diese Idee hat ihren Ursprung in den Schriften verschiedener militärischer Denker, von denen Carl von Clausewitz vielleicht der bekannteste ist. In seinem Werk "Vom Kriege" beschrieb Clausewitz den Krieg als die "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Diese Perspektive legt nahe, dass der Krieg kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel zur Erreichung politischer Ziele, zu denen auch die Schaffung von Frieden gehören kann. Darüber hinaus wird Krieg in der Tradition der Theorie der internationalen Beziehungen häufig als ein Instrument betrachtet, das Staaten zur Lösung von Streitigkeiten einsetzen können, wenn sie es nicht schaffen, mit friedlichen Mitteln eine Einigung zu erzielen. Obwohl Krieg also ein gewalttätiger und zerstörerischer Akt ist, kann er als Teil eines umfassenderen Prozesses zur Wiederherstellung von Stabilität und Frieden betrachtet werden.
Beide sind miteinander verbunden. Wir befinden uns in einem Verständnis, in dem Frieden eng mit Krieg verbunden ist und vor allem, dass die Definition von Frieden eng mit Krieg verbunden ist. Frieden wird als die Abwesenheit von Krieg verstanden. Es ist interessant zu sehen, wie das Ziel der Strategie darin besteht, zu gewinnen und zu einem Zustand des Friedens zurückzukehren. Es ist wirklich der Krieg, der diesen Zustand bestimmt. Es gibt eine sehr starke Dialektik zwischen den beiden. Wir beschäftigen uns mit der Beziehung zwischen Krieg und Staat, aber auch zwischen Krieg und Frieden. Diese Beziehung ist von grundlegender Bedeutung, mit der wir uns heute nicht befassen werden. In vielen theoretischen Rahmen wird Frieden im Gegensatz zu Krieg definiert. Das heißt, Frieden wird häufig als die Abwesenheit eines bewaffneten Konflikts konzeptualisiert. Diese Sichtweise wird als "negativer Frieden" bezeichnet, in dem Sinne, dass Frieden eher durch das definiert wird, was er nicht ist (d. h. Krieg), als durch das, was er ist. Die Militärstrategie zielt oft darauf ab, diesen Zustand des "negativen Friedens" wiederherzustellen, indem man den Krieg gewinnt oder günstige Bedingungen für das Ende des Konflikts erreicht.
Wir sprechen von Frieden, denn wichtig ist, dass in der Konzeption des Krieges, die sich mit der Entstehung dieses zwischenstaatlichen Systems herausbildet, d. h. mit Staaten, die sich im Inneren bilden und nach außen miteinander konkurrieren, der Krieg kein Ziel an sich ist, das Ziel ist nicht die Kriegsführung selbst, sondern der Frieden; man führt Krieg, um etwas zu erreichen. Dies ist die Auffassung von Raymon Aron. Raymond Aron ist ein französischer Philosoph und Soziologe, der für seine Arbeiten zur Soziologie der internationalen Beziehungen und zur politischen Theorie berühmt ist. Seiner Meinung nach ist der Krieg kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck des Friedens. Das bedeutet, dass der Krieg ein politisches Instrument ist, ein Werkzeug, das von Staaten eingesetzt wird, um bestimmte Ziele zu erreichen, in der Regel mit dem Ziel, Konflikte zu lösen und Frieden zu erreichen. Aus dieser Perspektive ist der Krieg eine extreme Form der Diplomatie und der Verhandlungen zwischen Staaten. Er ist eine Erweiterung der Politik und wird geführt, wenn friedliche Mittel bei der Lösung von Streitigkeiten versagen. Aus diesem Grund erklärte Aron: "Frieden ist der Zweck, Krieg ist das Mittel".
Die Auffassung vom Krieg als Konfliktlösungsmechanismus beruht auf der Idee, dass der Krieg ein Instrument der Politik ist, eine Form des Dialogs zwischen Staaten. Er wird eingesetzt, wenn friedliche Mittel zur Konfliktlösung versagt haben oder wenn die Ziele nicht mit anderen Mitteln erreicht werden können. In dieser Perspektive setzen Staaten den Krieg ein, um ihre strategischen Ziele zu erreichen, sei es der Schutz ihrer territorialen Interessen, die Ausweitung ihres Einflusses oder die Stärkung ihrer Sicherheit. Diese Ziele werden in der Regel von einer klar definierten Militärstrategie geleitet, die darauf abzielt, die Wirksamkeit des Einsatzes von Gewalt zu maximieren und gleichzeitig Verluste und Kosten zu minimieren.
Carl von Clausewitz' Ansatz zum Krieg
Carl von Clausewitz, ein preußischer Offizier aus dem frühen 19. Jahrhundert, spielte eine entscheidende Rolle bei der Theoretisierung des Krieges. Er verfasste das Werk "Vom Kriege" (Vom Kriege auf Deutsch), das zu einem der einflussreichsten Texte über Militärstrategie und Kriegstheorie wurde.
Carl von Clausewitz diente während der Napoleonischen Kriege, die von 1803 bis 1815 stattfanden, in der preußischen Armee. Während dieser Zeit sammelte er wertvolle Erfahrungen im Kampf und in der Militärstrategie, die seine Kriegstheorien beeinflussten. Clausewitz nahm an mehreren großen Schlachten gegen Napoleons Armee teil und wurde Zeuge der dramatischen Veränderungen in der Art und Weise, wie Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts geführt wurden. Während dieser Zeit begann er, seine Theorie zu entwickeln, dass der Krieg eine Erweiterung der Politik ist. Nach dem Ende der napoleonischen Kriege diente Clausewitz weiterhin in der preußischen Armee und begann, sein Hauptwerk "Vom Kriege" zu verfassen. Er starb jedoch, bevor er das Werk fertigstellen konnte, das posthum von seiner Frau veröffentlicht wurde.
Clausewitz behauptete, dass der Krieg "die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" sei. Dieses wohl bekannteste Zitat von Clausewitz drückt den Gedanken aus, dass der Krieg ein Instrument der nationalen Politik ist und dass militärische Ziele von politischen Zielen geleitet werden müssen. Mit anderen Worten: Der Krieg ist ein politisches Instrument und kein Selbstzweck. Clausewitz' Denken betont auch die Bedeutung des "Nebels des Krieges" und der "Reibung" bei der Durchführung von Militäroperationen. Er argumentiert, dass der Krieg von Natur aus unsicher und unvorhersehbar ist und dass Kommandanten und Strategen in der Lage sein müssen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Trotz seines Todes im Jahr 1831 übte Clausewitz' Denken weiterhin einen großen Einfluss auf die Militär- und Strategietheorie aus. Seine Werke werden an Militärakademien auf der ganzen Welt studiert und bleiben eine unverzichtbare Referenz im Bereich der Militärstrategie.
Clausewitz definiert Krieg als einen Gewaltakt, der den Gegner dazu zwingen soll, unseren Willen auszuführen. Dies ist ein sehr rationaler Rahmen, es handelt sich nicht um die Logik eines "Kriegsverrückten". Der Krieg wird geführt, um etwas zu erreichen. Carl von Clausewitz hat den Krieg als einen Gewaltakt konzeptualisiert, dessen Ziel es ist, den Gegner zu zwingen, unseren Willen auszuführen. Seiner Meinung nach ist der Krieg kein irrationales oder chaotisches Unterfangen, sondern vielmehr ein Instrument der Politik, ein rationales Mittel zur Verfolgung der Ziele eines Staates. In seinem Hauptwerk "Vom Kriege" entwickelt Clausewitz diesen Gedanken weiter, indem er feststellt, dass der Krieg lediglich die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Das heißt, Staaten setzen den Krieg ein, um politische Ziele zu erreichen, die sie mit friedlichen Mitteln nicht durchsetzen können.
Stellen wir uns einen Staat vor, der eine Regierung mit dem Ziel ist, fruchtbares Land zu erwerben, um seine Wirtschaft oder seine Ernährungssicherheit zu verbessern. Da sein Nachbar nicht bereit ist, dieses Land freiwillig abzutreten, entscheidet sich der Staat für den Einsatz von Krieg, um sein Ziel zu erreichen. Wenn der kriegsführende Staat siegreich ist, wird wahrscheinlich ein Friedensvertrag geschlossen, der die Landübertragung offiziell festschreibt. Dieser Vertrag könnte auch andere Bestimmungen enthalten, z. B. Kriegsentschädigungen, Regelungen für vertriebene Bevölkerungsgruppen und das Versprechen, in Zukunft keine Aggressionen zu zeigen. Das ursprüngliche Ziel (der Erwerb von fruchtbarem Land) wird also mithilfe von Krieg erreicht, der als politisches Instrument eingesetzt wird.
Diese von Clausewitz geprägte Auffassung von Krieg macht deutlich, dass der Krieg eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. In diesem Zusammenhang wird der Krieg als ein Werkzeug der Politik betrachtet, eine Option, die eingesetzt werden kann, wenn andere Methoden wie Diplomatie oder Handel bei der Lösung von Konflikten zwischen Staaten versagt haben.
Es ist entscheidend zu verstehen, dass der Krieg nach Clausewitz keine eigenständige Einheit ist, sondern vielmehr ein Instrument der Politik, das von den politischen Behörden kontrolliert und gesteuert wird. Das heißt, dass sowohl die Entscheidung, einen Krieg zu erklären, als auch die Verwaltung und Führung des Krieges in der Verantwortung der politischen Führer liegen. Die militärischen Ziele sind somit den politischen Zielen untergeordnet. Im clausewitzschen Denken ist der Krieg ein Mittel, um politische Ziele zu erreichen, die mit anderen Methoden nicht erreicht werden können. Er wird jedoch immer als vorübergehende Lösung und nicht als Dauerzustand betrachtet. Der Krieg ist also kein Zweck an sich, sondern ein Mittel zum Zweck: das vom Staat definierte politische Ziel. Sobald dieses Ziel erreicht ist oder wenn es nicht mehr möglich ist, es zu erreichen, endet der Krieg und man kehrt zu einem Zustand des Friedens zurück. Aus diesem Grund ist der Begriff des Friedens untrennbar mit dem des Krieges verbunden: Der Krieg zielt darauf ab, einen neuen, für den Staat, der ihn führt, günstigeren Friedenszustand zu schaffen.
Das westfälische System
Das Westfälische System, benannt nach dem Westfälischen Friedensvertrag, der 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete, hat die internationale politische Struktur und das Verständnis von Krieg tiefgreifend beeinflusst. Diese Reihe von Verträgen verankerte den Begriff der staatlichen Souveränität und legte die Vorstellung fest, dass jeder Staat die ausschließliche Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung ohne Einmischung von außen besitzt. Damit formalisierte es auch die Idee der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Was den Krieg betrifft, so hat das westfälische System dazu beigetragen, ihn als eine Aktivität zwischen Staaten und nicht zwischen Fraktionen oder Individuen zu formalisieren. Es förderte auch die Entwicklung von Regeln und Normen für die Kriegsführung, obwohl dieser Prozess erst in den folgenden Jahrhunderten mit der Entwicklung des humanitären Völkerrechts so richtig in Schwung kam. Während der Krieg also weiterhin als Instrument der Außenpolitik angesehen wurde, begann das westfälische System damit, Beschränkungen und Regeln für seine Anwendung einzuführen. Diese Zwänge wurden durch die Entwicklung des Völkerrechts in den folgenden Jahrhunderten noch verstärkt.
Hugo Grotius, auch bekannt als Hugo de Groot, war eine zentrale Figur bei der Entwicklung des Völkerrechts, insbesondere im Hinblick auf die Gesetze von Krieg und Frieden. Sein bekanntestes Werk, "De Jure Belli ac Pacis" ("Vom Recht des Krieges und des Friedens"), das 1625 veröffentlicht wurde, gilt als einer der grundlegenden Texte des Völkerrechts. In diesem Werk versucht Grotius, eine Reihe von Regeln für das Verhalten von Staaten in Kriegs- und Friedenszeiten festzulegen. Er untersucht ausführlich, wann ein Krieg gerechtfertigt ist (jus ad bellum), wie er geführt werden sollte (jus in bello) und wie nach einem Konflikt ein gerechter Frieden wiederhergestellt werden kann (jus post bellum).
Diese Ideen hatten einen bedeutenden Einfluss darauf, wie der Krieg wahrgenommen und geführt wird, indem sie die Vorstellung einführten, dass selbst in Kriegszeiten bestimmte Handlungen nicht akzeptabel sind und dass die Kriegsführung bestimmten ethischen und rechtlichen Grundsätzen unterliegen muss. Die von Grotius aufgestellten Grundsätze wurden im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt und ausgebaut und führten zur Formulierung detaillierterer und umfassenderer internationaler Konventionen wie den Genfer Konventionen, die heute das Verhalten in Kriegszeiten regeln.
Die Organisation des zwischenstaatlichen Systems hat dazu geführt, dass strenge Regeln zur Regulierung der Kriegsführung erlassen wurden. Ziel dieser Regeln ist es, die zerstörerischen Folgen des Krieges so weit wie möglich zu begrenzen und Personen zu schützen, die nicht direkt am Krieg beteiligt sind, wie z. B. Zivilisten oder Kriegsgefangene. Aus diesem Grund muss ein Krieg nach internationalem Recht vor seinem Beginn erklärt werden. Diese Erklärung soll allen beteiligten Parteien, einschließlich anderer Länder und internationaler Organisationen, klar signalisieren, dass ein bewaffneter Konflikt begonnen hat. Während eines Krieges müssen sich die Kombattanten an bestimmte Regeln halten. So dürfen sie beispielsweise nicht absichtlich Zivilisten oder zivile Gebäude wie Schulen oder Krankenhäuser ins Visier nehmen oder Waffen einsetzen, die nach dem Völkerrecht verboten sind, wie chemische oder biologische Waffen. Schließlich muss nach einem Krieg ein Friedensprozess in Gang gesetzt werden, um Streitigkeiten zu lösen, Kriegsverbrechen zu bestrafen und die durch den Konflikt verursachten Schäden zu beheben. Obwohl diese Regeln oft verletzt werden, ist ihre Existenz und universelle Anerkennung ein wichtiger Versuch, eine Tätigkeit zu zivilisieren, die von Natur aus gewalttätig und zerstörerisch ist.
Der Krieg wurde trotz seiner oft verheerenden Folgen als Mittel zur Lösung politischer Streitigkeiten in das zwischenstaatliche System integriert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nicht darum geht, den Krieg zu fördern oder zu verherrlichen, sondern vielmehr darum, zu versuchen, ihn einzudämmen und zu regulieren. Seit dem 17. Jahrhundert wurden zahlreiche Regeln aufgestellt, die versuchen, die Verheerungen des Krieges zu begrenzen. Dazu gehört das humanitäre Völkerrecht, das Grenzen für die Art und Weise setzt, wie Krieg geführt werden kann, und Personen schützt, die nicht oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, wie Zivilisten, Gesundheitsarbeiter und Kriegsgefangene. Darüber hinaus hat das Völkerrecht auch Regeln dafür aufgestellt, wie man einen Krieg erklärt, Feindseligkeiten führt und Frieden schließt. Dazu gehören das Kriegsrecht, das Regeln für die Durchführung von Feindseligkeiten aufstellt, und das Friedensrecht, das den Abschluss von Friedensverträgen und die Lösung internationaler Konflikte regelt. Diese Bemühungen zur Regulierung des Krieges zeugen von der Erkenntnis, dass ein Krieg zwar manchmal unvermeidlich sein kann, aber auf eine Art und Weise geführt werden muss, die menschliches Leid und materielle Zerstörung so weit wie möglich minimiert.
Der Westfälische Friedensvertrag, der 1648 zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges geschlossen wurde, bestand aus zwei verschiedenen Abkommen: dem Vertrag von Osnabrück und dem Vertrag von Münster. Der Vertrag von Osnabrück wurde zwischen dem Schwedischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation geschlossen, während der Vertrag von Münster zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und den Vereinigten Provinzen (den heutigen Niederlanden) sowie zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich geschlossen wurde. Diese Verträge sind historisch wichtig, da sie den Grundstein für die moderne internationale Ordnung legten, die auf der Souveränität der Staaten beruht. Der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten wurde ebenso festgelegt wie der Grundsatz des Machtgleichgewichts. Der Westfälische Friedensvertrag bedeutete im Grunde das Ende der Idee eines universellen christlichen Reiches in Europa und ebnete den Weg für ein System unabhängiger und souveräner Nationalstaaten.
Die Westfälischen Verträge beendeten den Dreißigjährigen Krieg, einen Religionskrieg, der Europa und insbesondere das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zwischen 1618 und 1648 auseinanderriss. In diesem Krieg standen sich vor allem katholische und protestantische Kräfte gegenüber, obwohl Politik und Machtkämpfe ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Durch die Beendigung dieses Krieges brachten die Westfälischen Verträge nicht nur einen willkommenen Frieden, sondern markierten auch einen grundlegenden Wandel in der politischen Organisation Europas. Vor diesen Verträgen war die Idee eines universellen christlichen Reiches, in dem eine höhere Autorität (entweder der Papst oder der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) eine gewisse Autorität über Königreiche und Fürstentümer haben sollte, noch lebendig. Die Westfälischen Verträge legten den Grundsatz der staatlichen Souveränität fest und besagen, dass jeder Staat die absolute und ausschließliche Autorität über sein Territorium und sein Volk besitzt. Das bedeutete, dass zum ersten Mal Staaten und nicht Kaiser oder Päpste zu den Hauptakteuren auf der internationalen Bühne wurden. Dies wird als das "westfälische System" bezeichnet, das nach wie vor die Grundlage der modernen internationalen Ordnung bildet.
Die Schweiz wurde 1648 im Westfälischen Friedensvertrag als unabhängige Einheit anerkannt, obwohl es länger dauerte, bis sich ihre heutige Form als Staat konsolidierte. Die immerwährende Neutralität der Schweiz wurde auch auf dem Wiener Kongress 1815 festgelegt, was ihren eigenständigen Status auf der internationalen Bühne stärkte. Dennoch ist zu beachten, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft als Union der Kantone bereits vor dem Westfälischen Friedensvertrag existierte. Ihre einzigartige Struktur entsprach jedoch nicht genau dem Konzept des Nationalstaats, wie er mit dem westfälischen System entstand. Daher kann man sagen, dass es lange gedauert hat, bis die Schweiz in ihrer modernen Form auftauchte.
Der Westfälische Friedensvertrag legte den Grundstein für das moderne internationale System, das auf nationaler Souveränität beruht. Mit anderen Worten: Jeder Staat hat das Recht, sein Hoheitsgebiet nach eigenem Ermessen ohne Einmischung von außen zu regieren. Dieses Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ist ein zentraler Pfeiler des internationalen Systems. Es beseitigt jedoch nicht den Konflikt oder die Meinungsverschiedenheit zwischen Staaten. Wenn eine Meinungsverschiedenheit auftritt, kann Krieg als Mittel zur Lösung eingesetzt werden. In der modernen Welt werden jedoch in der Regel andere Formen der Konfliktlösung wie Diplomatie, Dialog und Verhandlungen bevorzugt. Krieg wird oft als letztes Mittel angesehen, wenn keine andere Option praktikabel oder wirksam ist.
Die Unterscheidung zwischen dem inneren und dem äußeren Raum der Staaten ist in der internationalen Politik von grundlegender Bedeutung. Innerhalb seiner Grenzen hat ein Staat die Souveränität, seine eigenen Gesetze und Vorschriften durchzusetzen und die Ordnung so aufrechtzuerhalten, wie er es für notwendig erachtet. Dieser innere Raum ist häufig durch einen Satz klar definierter Regeln und Normen gekennzeichnet, die weithin anerkannt und eingehalten werden. Außerhalb seiner Grenzen muss sich ein Staat in einem komplexeren und oft weniger regulierten Umfeld bewegen, in dem die Interaktionen hauptsächlich zwischen souveränen Staaten stattfinden, die möglicherweise unterschiedliche Interessen haben. Dieser äußere Raum wird durch das Völkerrecht geregelt, das weniger verbindlich ist und stärker von der Zusammenarbeit zwischen Staaten abhängt.
Der Grundsatz der Souveränität begründet zwar die formale Gleichheit aller Staaten im Völkerrecht, führt aber nicht zwangsläufig zu einer tatsächlichen Gleichheit auf der internationalen Bühne. Einige Staaten können aufgrund ihrer wirtschaftlichen, militärischen oder strategischen Macht einen unverhältnismäßig großen Einfluss ausüben. Gleichzeitig hat der Aufstieg nichtstaatlicher Akteure die internationale Landschaft komplexer gemacht. Nichtregierungsorganisationen (NGOs), multinationale Unternehmen und sogar Einzelpersonen (wie Aktivisten, politische Dissidenten oder Prominente) können nun bedeutende Rollen in der internationalen Politik spielen. Diese Akteure können die globale Politik beeinflussen, indem sie die öffentliche Meinung mobilisieren, direkte Aktionen durchführen, grundlegende Dienstleistungen erbringen oder wirtschaftliche Macht ausüben. Doch trotz des wachsenden Einflusses dieser nichtstaatlichen Akteure bleiben die Staaten die wichtigsten und mächtigsten Akteure auf der internationalen Bühne.
Im zeitgenössischen internationalen System ist der Staat die grundlegende politische Einheit. Das Konzept des souveränen Nationalstaats bleibt, obwohl es kritisiert und oft durch Fragen des Transnationalismus, der Globalisierung und der interdependenten internationalen Beziehungen verkompliziert wird, der wichtigste Organisator der Weltpolitik. Von jedem Staat als souveränem Gebilde wird erwartet, dass er absolute Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung ausübt. Das internationale System beruht auf der Interaktion dieser souveränen Staaten und der Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Realität oftmals komplexer ist. Viele nichtstaatliche Akteure - von multinationalen Konzernen über terroristische Gruppen bis hin zu Nichtregierungsorganisationen und internationalen Institutionen - spielen ebenfalls eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne. Manchmal können diese Akteure sogar die Autorität und Souveränität von Staaten in Frage stellen. Doch trotz dieser Herausforderungen bleibt die Idee des Nationalstaats zentral für das Verständnis und die Strukturierung unserer politischen Welt.
Man spricht nicht von "Weltstudien" oder "globalen Studien". Der Begriff, der sich durchgesetzt hat, ist der der "Internationalen Beziehungen". Das Studienfeld "Internationale Beziehungen" konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Staaten und, im weiteren Sinne, zwischen Akteuren auf der Weltbühne. Es geht nicht einfach darum, die Welt als Ganzes zu studieren, sondern zu verstehen, wie Staaten miteinander interagieren, wie sie Macht aushandeln und herausfordern, wie sie zusammenarbeiten und in Konflikte geraten. Die Betonung liegt auf "Beziehungen", denn über diese Beziehungen definieren sich die Staaten gegenseitig, gestalten ihre Außenpolitik und beeinflussen das internationale System. Daher bleiben der Nationalstaat und die Staatsgrenze trotz der zunehmenden Interdependenz und Globalisierung Schlüsselbegriffe in der Theorie und Praxis der internationalen Beziehungen. Tatsächlich ist die Strukturierung des Raums zwischen Staaten eine grundlegende Dimension in der Analyse der internationalen Beziehungen. Es ist diese Strukturierung, die unter anderem Bündnisse, Konflikte, Handel und Bevölkerungsströme bestimmt. Sie ist es auch, die einen bedeutenden Einfluss auf die Weltordnungspolitik und die Entwicklung internationaler Normen hat.
Der 1648 unterzeichnete Westfälische Friedensvertrag legte den Grundstein für die moderne internationale Ordnung, die auf dem Prinzip der nationalen Souveränität beruht. Nach diesem Prinzip hat jeder Staat das Recht, sein eigenes Territorium und seine eigene Bevölkerung ohne Einmischung von außen zu regieren. Souveräne Gleichheit bedeutet, dass aus der Sicht des Völkerrechts alle Staaten gleich sind, unabhängig von ihrer Größe, ihrem Reichtum oder ihrer Macht. Das bedeutet, dass jeder Staat das Recht hat, in vollem Umfang an der internationalen Gemeinschaft teilzunehmen und von anderen Staaten respektiert zu werden.
Doch auch wenn der Westfälische Friedensvertrag Souveränität und souveräne Gleichheit als grundlegende Prinzipien des internationalen Systems etabliert hat, darf man daraus nicht ableiten, dass Krieg eine unvermeidliche Folge dieser Prinzipien ist. Denn auch wenn Streitigkeiten zwischen Staaten zu bewaffneten Konflikten führen können, ist der Krieg weder die einzige noch die am meisten gewünschte Art der Streitbeilegung. Die Grundsätze des Völkerrechts, wie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, sind auch für die aus Westfalen hervorgegangene internationale Ordnung zentral. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahrhunderte internationale Normen und Institutionen entwickelt, die die Kriegsführung einrahmen und regulieren und den Dialog, die Verhandlungen und die Zusammenarbeit zwischen Staaten fördern. Das Westfälische System ist daher nicht einfach eine Lizenz zum Krieg, sondern der Rahmen, in dem Staaten koexistieren, zusammenarbeiten und manchmal auch gegeneinander kämpfen.
Vom Totalen Krieg zum Institutionalisierten Krieg (Holsti)
Le XVIIe siècle a été une époque de transformations significatives dans l'organisation politique et sociale de nombreux pays, conduisant à l'émergence de l'État moderne. C'est durant cette période que les États ont commencé à consolider leur pouvoir, à centraliser l'autorité, à imposer des impôts de façon systématique et à développer des bureaucraties plus efficaces et structurées. Cette centralisation et cette bureaucratisation ont permis aux États d'amasser des ressources et de les mobiliser plus efficacement, en vue notamment de conduire des guerres. À mesure que les États devenaient plus puissants et plus efficaces, ils étaient capables de mener des guerres à plus grande échelle et avec plus d'intensité. Cela a ouvert la voie à ce qu'on appelle la "guerre totale", où tous les aspects de la société sont mobilisés pour l'effort de guerre et où la distinction entre combattants et non-combattants devient floue. Parallèlement à ces changements, le système international évoluait également, avec l'établissement du système westphalien basé sur la souveraineté des États. Ces deux processus - l'évolution de l'État et la transformation du système international - se sont renforcés mutuellement. La consolidation de l'État a contribué à l'essor du système westphalien, tandis que ce dernier a fourni un cadre permettant aux États de se développer et de se renforcer.
Alors que l'État moderne a grandement contribué à la diminution de la violence interpersonnelle en instaurant un ordre social interne et un monopole sur l'usage légitime de la force, l'augmentation de sa capacité à mobiliser et à concentrer des ressources a aussi conduit à la possibilité de conflits à plus grande échelle, souvent avec des conséquences dévastatrices. Dans un contexte de relations internationales, le système westphalien a créé un environnement où les États, en cherchant à protéger leurs intérêts et à garantir leur sécurité, peuvent recourir à la guerre comme moyen de résoudre leurs différends. Cette évolution a conduit à des guerres de plus en plus destructrices, culminant avec les deux guerres mondiales du XXe siècle.
L'évolution des normes et des règles concernant la guerre a abouti à une distinction plus claire entre les combattants et les non-combattants, avec un effort pour protéger ces derniers des effets directs de la guerre. C'est une idée qui a été codifiée dans le droit international humanitaire, en particulier dans les Conventions de Genève. Au Moyen Âge, la distinction entre civils et combattants n'était pas toujours claire, et les civils étaient souvent directement affectés par la guerre. Cependant, avec le développement de l'État moderne et la codification de la guerre, une norme a émergé selon laquelle les civils devraient être épargnés autant que possible lors des conflits. Cela dit, bien que la distinction soit maintenant largement reconnue et respectée en théorie, elle est malheureusement souvent ignorée dans la pratique. De nombreux conflits contemporains ont vu de graves violations de cette norme, avec des attaques délibérées contre des civils et une souffrance massive pour les populations non combattantes.
A partir du XVIIème siècle, avec la montée de l'État-nation et la professionnalisation des armées, il y a eu une réduction de l'impact direct des guerres sur les civils. Les combattants - généralement des soldats professionnels - sont devenus les principaux participants et victimes des guerres. Cependant, cette tendance s'est inversée au cours du XXème siècle, en particulier avec les deux Guerres mondiales et d'autres conflits majeurs, où les civils ont souvent été ciblés ou sont devenus des victimes collatérales. Cela s'est encore intensifié après la fin de la Guerre froide, avec la montée des conflits intra-étatiques et des groupes armés non étatiques. Dans ces conflits, les civils sont souvent directement ciblés et constituent la majorité des victimes.
L'apparition de la guerre moderne est intrinsèquement liée à l'émergence de l'État-nation. Au Moyen Âge, les conflits étaient caractérisés par une fluidité de structures et de factions, englobant les cités-États, les ordres religieux comme la papauté, les seigneurs de guerre, et d'autres groupes qui changeaient fréquemment d'alliances selon leurs intérêts du moment. C'était une époque où la violence était omniprésente, mais les frontières des conflits étaient souvent floues et changeantes. Avec l'essor de l'État-nation, la nature de la guerre a changé de manière significative. Les États ont commencé à lever des armées de soldats, identifiables par leurs uniformes, qui servaient en tant que représentants de l'État sur le champ de bataille. Que ces soldats soient des professionnels rémunérés ou des conscrits mobilisés pour le service militaire, ils symbolisaient la capacité et l'autorité de l'État à projeter la force et à défendre ses intérêts. La guerre est ainsi devenue une extension des relations interétatiques et des politiques de l'État, avec des règles et des conventions plus clairement définies.
De la Guerre Totale à la Guerre Institutionnalisée (Holsti)
La Paix de Westphalie a créé un nouveau système politique, connu sous le nom de système westphalien, qui a formalisé l'idée d'États-nations souverains. Dans ce système, la guerre est devenue un outil institutionnalisé pour la résolution de conflits entre États. Au lieu d'être une série d'escarmouches chaotiques et continues, la guerre est devenue un état déclaré et reconnu de conflit ouvert entre des États souverains. Cela a également conduit à l'émergence de règles et de conventions de la guerre, visant à limiter les effets destructeurs du conflit et à protéger les droits des combattants et des civils. Ces règles ont été formalisées dans des traités et des conventions internationaux, tels que les Conventions de Genève.
K. J. Holsti, dans son livre "The State, War, and the State of War" (1996), fait une distinction entre deux types de guerre. Les "guerres de type 1" qu'il définit sont les guerres traditionnelles entre États, qui ont été la norme depuis le Traité de Westphalie jusqu'à la fin de la Guerre Froide. Ces conflits sont généralement clairement définis, avec des déclarations formelles de guerre, des fronts militaires clairs et la fin des hostilités souvent marquée par des traités de paix. En revanche, les "guerres de type 2", selon Holsti, sont les guerres modernes, qui ont tendance à être beaucoup plus chaotiques et moins clairement définies. Elles peuvent impliquer des acteurs non étatiques tels que des groupes terroristes, des milices ou des gangs. Ces conflits peuvent éclater à l'intérieur des frontières d'un État, plutôt qu'entre différents États, et ils peuvent durer des décennies, avec une violence constante plutôt qu'un début et une fin clairement définis.
La période entre 1648 et 1789 est souvent appelée l'ère de la "guerre limitée" ou de la "guerre de cabinet". Ces guerres avaient généralement des objectifs clairs et limités. Elles étaient souvent combattues pour des raisons spécifiques, telles que le contrôle de territoires particuliers ou la résolution de différends spécifiques entre les États. Ces guerres étaient généralement menées par des armées professionnelles sous le contrôle direct du gouvernement de l'État, d'où le terme "guerre de cabinet". L'idée était d'utiliser la guerre comme un outil pour atteindre des objectifs politiques spécifiques, plutôt que de chercher la destruction totale de l'ennemi. Cela correspond à la conception clausewitzienne de la guerre comme la "continuation de la politique par d'autres moyens". Ces guerres étaient généralement bien structurées, avec des déclarations formelles de guerre, des règles de conduite acceptées et, en fin de compte, des traités de paix pour résoudre formellement le conflit. Cela reflète le niveau de formalisation et d'institutionnalisation du concept de guerre pendant cette période. Cependant, cela a commencé à changer avec les guerres révolutionnaires et napoléoniennes à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, qui ont été caractérisées par une mobilisation de masse et un niveau de destruction beaucoup plus grand. Ces guerres ont ouvert la voie à l'ère des "guerres totales" du XXe siècle.
Cette période de l'histoire, généralement comprise entre le Traité de Westphalie en 1648 et la Révolution française en 1789, voit une codification importante des structures militaires et des règles de la guerre. L'apparition d'uniformes distinctifs est un signe de cette codification. Les uniformes aidaient à identifier clairement les belligérants sur le champ de bataille, contribuant à une certaine mesure de discipline et d'ordre. Cette période voit également l'ascension de ce que l'on pourrait appeler une "culture militaire" professionnelle. Les armées de cette époque étaient souvent commandées par des membres de la noblesse, qui étaient formés à l'art de la guerre et qui considéraient le service militaire comme une extension de leurs obligations sociales et politiques. C'est souvent durant cette période que l'on voit l'émergence de la "noblesse d'épée", une classe de noblesse qui tirait son statut et sa réputation de son service dans l'armée. Dans le même temps, les règles de la guerre ont été codifiées, ce qui a entraîné une plus grande attention portée aux droits des prisonniers de guerre, à l'immunité diplomatique, et à d'autres aspects du droit de la guerre. Ces codes de conduite ont été renforcés par des traités et des conventions internationales, jetant les bases du droit international moderne.
Durant cette période de l'histoire, les guerres étaient généralement caractérisées par des objectifs limités et des engagements relativement courts. Les belligérants cherchaient souvent à réaliser des objectifs stratégiques spécifiques, tels que la capture d'un territoire ou d'une forteresse particulière, plutôt que la destruction totale de l'ennemi. Ces conflits étaient souvent caractérisés par une "guerre de manœuvre", où les armées cherchaient à gagner un avantage stratégique par le mouvement et la position plutôt que par le combat frontal. Les batailles étaient souvent l'exception plutôt que la règle, et de nombreux conflits se terminaient par une négociation plutôt que par une victoire militaire totale. Cette manière de faire la guerre était en partie une conséquence des contraintes logistiques de l'époque. Les armées étaient souvent limitées par leur capacité à approvisionner leurs troupes en nourriture, en eau et en munitions, ce qui limitait la durée et l'échelle des engagements militaires.
Pendant cette période de guerre limitée, l'objectif n'était pas l'anéantissement total de l'adversaire, mais plutôt l'accomplissement de buts stratégiques spécifiques. Les batailles étaient souvent soigneusement orchestrées et les armées cherchaient à minimiser les pertes inutiles de vies humaines. L'accent était mis sur la stratégie et la tactique, et non sur la destruction aveugle. Les civiles étaient généralement épargnés, en partie parce que la guerre était vue comme une affaire entre États, et non entre peuples. Cependant, cela ne veut pas dire que les civiles n'étaient jamais affectés. Les perturbations causées par les guerres pouvaient entraîner des famines, des épidémies et d'autres formes de souffrance pour les populations civiles.
La Guerre de Succession d'Espagne (1701-1714) est un bon exemple d'une guerre de cette période. Elle a été déclenchée par la mort du roi Charles II d'Espagne sans héritier direct. Ce conflit a opposé les grandes puissances européennes qui cherchaient à contrôler la succession au trône espagnol, et par extension, à augmenter leur influence et leur pouvoir en Europe. La guerre a été limitée dans le temps, et bien qu'elle ait été brutale et coûteuse en termes de vies humaines, elle était régie par des règles et des conventions acceptées qui limitaient son intensité et sa portée. Par exemple, les batailles étaient généralement menées par des armées régulières, et les civils étaient en grande partie épargnés. Cependant, cette guerre a été significative en termes de changements géopolitiques. Elle a vu la montée en puissance de la Grande-Bretagne et a marqué un tournant dans l'équilibre des puissances en Europe. Elle a également conduit au Traité d'Utrecht en 1713, qui a redéfini les frontières et a eu des conséquences durables sur la politique européenne.
La période allant de la fin du XVIIème siècle jusqu'au XVIIIème siècle est marquée par une codification progressive des armées. Cette codification couvre de nombreux aspects de la conduite militaire. La structure des armées a commencé à se formaliser avec l'introduction de hiérarchies clairement définies et de rôles militaires spécifiques. Cela a permis une meilleure organisation et coordination des forces armées. La codification des uniformes, était un autre aspect majeur. Les uniformes militaires non seulement distinguaient les soldats des civils, mais permettaient aussi de différencier les alliés des ennemis et d'identifier le rang et le rôle de chaque soldat. La conduite sur le champ de bataille a également été réglementée. Des règles spécifiques ont été établies pour régir les actions en temps de guerre, y compris le traitement des prisonniers de guerre et la conduite envers les civils. Cette codification des armées a été une partie essentielle de la formation des États-nations modernes. Elle a permis une plus grande efficacité et une meilleure organisation dans la conduite des guerres, tout en limitant certaines formes de violence et en protégeant les non-combattants dans une certaine mesure.
L'uniforme militaire joue un rôle crucial dans l'identification et l'organisation des forces armées pendant cette période. Il sert de multiples fonctions importantes. Premièrement, l'identification. Les uniformes aident à distinguer les alliés des adversaires sur le champ de bataille. Ils permettent également d'identifier le rang et la fonction de l'individu au sein de l'armée. C'est une façon de créer de la clarté lors des conflits, où les situations peuvent être chaotiques et changeantes. Deuxièmement, l'uniforme crée un sentiment d'unité parmi les soldats. En portant le même ensemble de vêtements, les soldats se sentent liés les uns aux autres, partageant une identité commune. L'uniforme symbolise leur loyauté envers l'État et leur engagement envers la cause pour laquelle ils se battent. Ensuite, l'uniforme favorise la discipline et l'ordre. En imposant une tenue uniforme, l'armée renforce son organisation hiérarchique et structurée. C'est un rappel constant de la rigueur et de la structure que requiert la vie militaire. Enfin, l'uniforme est également un outil de représentation de la puissance et du prestige de l'État. Il est souvent conçu pour impressionner ou intimider l'adversaire. C'est une déclaration visuelle de la force et du potentiel de l'État. L'uniformisation des tenues militaires a commencé à se produire à partir du XVIIe siècle, en parallèle avec le développement de l'État moderne et des armées permanentes. Ce processus a été influencé par les progrès technologiques qui ont rendu possible la production en masse de vêtements, ainsi que par la nécessité d'une discipline et d'une organisation accrues au sein des forces armées.
La Guerre du Second Type ou Guerre Totale : 1789 – 1815 et 1914 – 1945
En poursuivant la typologie de K.J. Holsti, les guerres de deuxième type émergent avec les guerres de la Révolution et de l'Empire au début du XIXème siècle. Ces conflits diffèrent considérablement des guerres de premier type du XVIIème et XVIIIème siècles.
Les guerres de deuxième type, aussi appelées guerres de masse ou guerres napoléoniennes, se caractérisent par une mobilisation de ressources humaines et matérielles sans précédent. Elles sont définies par une volonté d'annihilation de l'ennemi, contrairement aux guerres de premier type, qui cherchaient principalement à atteindre des objectifs politiques limités. Ces guerres sont souvent plus longues, plus coûteuses et plus destructrices. Les conflits ne se limitent plus à des batailles ponctuelles et délimitées, mais s'étendent à des campagnes militaires à grande échelle. De plus, la distinction entre les combattants et les civils devient moins nette, avec des populations entières impliquées dans l'effort de guerre, que ce soit par la conscription ou par le soutien à l'effort de guerre. Les guerres napoléoniennes sont un exemple classique de ce type de guerre, avec des millions de personnes mobilisées à travers l'Europe, une série de conflits qui a duré plus d'une décennie, et des changements politiques et territoriaux majeurs en résultant.
La Révolution française de 1789 marque un tournant majeur dans la manière dont les guerres sont menées. Avec l'émergence des idées révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité, la guerre devient plus qu'un simple instrument de la politique de l'État. Elle devient une expression des aspirations et des ambitions collectives de la nation. La notion de "Nation en armes" apparaît pour la première fois durant cette période. Ce concept s'inscrit dans l'idée d'une mobilisation totale de la population en vue de la guerre. Il ne s'agit plus simplement de professionnels de la guerre ou de mercenaires qui combattent, mais de l'ensemble de la population, y compris des citoyens ordinaires. Ces citoyens sont appelés à prendre les armes non seulement pour défendre leur territoire, mais aussi pour défendre l'idée même de la nation et les principes sur lesquels elle repose. Ceci est possible grâce à la levée en masse, une mesure révolutionnaire qui permet la conscription de grands nombres de citoyens dans l'armée. Cette mesure a permis à la France de mobiliser des ressources humaines considérables pour faire face à la menace des puissances européennes coalisées contre elle. La conséquence de cette nouvelle approche de la guerre est une escalade sans précédent de la violence et de la destruction, ainsi que l'implication croissante des civils dans le conflit. Cette tendance va se poursuivre et s'intensifier au cours des deux siècles suivants, notamment avec les deux guerres mondiales du XXème siècle.
La Révolution française a bouleversé l'ordre établi en Europe. Les monarchies traditionnelles, menacées par les idées révolutionnaires de la souveraineté du peuple et de la démocratie, ont formé des coalitions pour tenter de restaurer l'Ancien Régime en France. En réponse à ces menaces extérieures, les dirigeants révolutionnaires français ont décidé de lever une grande armée de citoyens. C'était une rupture majeure avec le passé, où les armées étaient composées principalement de mercenaires ou de troupes professionnelles. Le décret de la Levée en masse, adopté en 1793, a mobilisé tous les citoyens français en âge de porter les armes. L'objectif était de repousser les armées des monarchies européennes qui envahissaient la France. Cette mobilisation massive a permis de former une armée de plusieurs centaines de milliers de soldats, qui a finalement réussi à repousser les invasions et à préserver la Révolution. Cette levée en masse est considérée comme la première mobilisation nationale de l'histoire moderne. Elle a transformé la nature de la guerre, qui est passée d'un conflit limité entre professionnels de la guerre à une lutte impliquant l'ensemble de la nation. Cela a également changé le rapport des citoyens à l'État, leur rôle n'étant plus seulement d'obéir, mais aussi de défendre activement la nation et ses idéaux.
Le passage à une armée de conscription nécessitait un État moderne et organisé, capable de recenser sa population, de former et d'équiper rapidement des milliers de soldats, et de soutenir l'effort de guerre sur le long terme. La levée en masse a transformé la nature de la guerre en permettant de mobiliser des armées de très grande taille. Par exemple, sous Napoléon, l'armée française a atteint plus de 600 000 hommes, un chiffre inédit pour l'époque. Cela a également permis d'augmenter la capacité de l'armée à mener des opérations sur plusieurs fronts à la fois. Cependant, cela a également augmenté la complexité de la logistique militaire, en nécessitant un approvisionnement en nourriture, en armes et en munitions pour un nombre beaucoup plus important de soldats. Cela a donc exigé un État plus efficace et organisé, capable de planifier et de soutenir ces opérations à grande échelle. Cela a également conduit à un changement dans la nature de la guerre elle-même. Avec de si grandes armées, les batailles sont devenues plus destructrices et ont entraîné un nombre plus élevé de victimes. La guerre est devenue une affaire de nations entières, impliquant non seulement les soldats, mais aussi les civils qui soutenaient l'effort de guerre à l'arrière.
L'instauration d'une armée de conscription requiert un État moderne, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, un État moderne dispose d'une administration efficace. Cette administration est nécessaire pour recenser la population et gérer la conscription. Identifier, enregistrer, mobiliser et former les recrues est une tâche administrative énorme qui nécessite une bureaucratie efficace. Deuxièmement, l'État doit avoir la capacité logistique pour soutenir une grande armée. Cela signifie qu'il doit pouvoir fournir de la nourriture, des vêtements, des armes et des munitions à un grand nombre de soldats. Il doit également avoir la capacité de soigner les blessés. Toutes ces tâches demandent une infrastructure logistique solide. Troisièmement, un État moderne a généralement une économie suffisamment forte pour soutenir une armée de conscription. Les guerres sont coûteuses et il faut un État capable de financer ces dépenses. Enfin, la levée en masse nécessite une certaine cohésion et solidarité sociale. L'État doit avoir la légitimité nécessaire pour demander à ses citoyens de se battre et de mourir pour lui. C'est généralement plus facile dans un État-nation, où les citoyens partagent un sentiment d'appartenance commune. Finalement, le passage à une armée de conscription est une manifestation de la modernité d'un État, illustrant sa capacité à exercer le pouvoir sur ses citoyens et à mobiliser ses ressources pour atteindre ses objectifs.
Les guerres de deuxième type, selon la typologie de Holsti, sont caractérisées par des armées de conscription à grande échelle, et non plus par des armées de métier reposant sur le mercenariat. Ces guerres ont émergé après la Révolution française et ont atteint leur apogée avec les guerres napoléoniennes. L'idée sous-jacente est que la Nation tout entière, et non plus une caste guerrière ou une élite professionnelle, est mobilisée pour la guerre. Les soldats ne se battent plus pour un salaire, mais pour la défense de la Nation et de ses valeurs. C'est une transformation majeure de la nature de la guerre, qui implique un degré d'engagement et de sacrifice beaucoup plus grand de la part des citoyens. Cette nouvelle forme de guerre a permis de lever des armées beaucoup plus grandes et plus puissantes que par le passé, ce qui a contribué à la domination napoléonienne en Europe. En outre, ces armées nationalistes ont changé la manière dont la guerre était perçue et vécue par la population. La guerre n'était plus une affaire de professionnels, mais une cause pour laquelle chaque citoyen était prêt à donner sa vie. Cela a également eu un impact significatif sur la nature des conflits et sur l'ampleur des destructions et des pertes humaines qu'ils pouvaient entraîner.
La nature idéologique des guerres révolutionnaires conduit à une intensification des conflits. Contrairement aux guerres dites "traditionnelles", où les objectifs sont souvent territoriaux ou matériels, les guerres révolutionnaires ont tendance à avoir des objectifs plus abstraits et fondamentaux. Il ne s'agit plus simplement de gagner du territoire ou de s'approprier des ressources, mais de défendre une idée, un idéal, voire une identité. Dans ce contexte, l'ennemi n'est pas seulement un adversaire militaire, mais aussi une menace pour l'existence même de la nation et de ses valeurs. Par conséquent, l'objectif n'est pas seulement de vaincre l'ennemi sur le champ de bataille, mais de l'annihiler complètement, car sa simple existence est perçue comme une menace. Cela peut conduire à une escalade de la violence et à des guerres particulièrement meurtrières et destructrices. Le fait que l'ensemble de la population soit mobilisé pour la guerre contribue également à intensifier les conflits, car chacun se sent personnellement impliqué et prêt à faire des sacrifices pour la cause. En revanche, ces guerres peuvent également être perçues comme plus légitimes ou justifiées par ceux qui les mènent, car ils se battent pour une cause en laquelle ils croient profondément, et non simplement pour le pouvoir ou le profit. Cela peut contribuer à renforcer l'unité nationale et la détermination à lutter.
Lors des guerres de deuxième type, telles que les guerres révolutionnaires, la nature des objectifs change de manière significative par rapport aux conflits plus traditionnels. Les objectifs ne sont plus uniquement matériels, comme la prise d'un territoire ou le contrôle de ressources, mais deviennent idéologiques et abstraits. Ces objectifs, tels que la "libération", la "démocratie" ou la "lutte des classes", sont non seulement illimités, mais aussi flous et subjectifs. Ils ne peuvent pas être mesurés ou atteints de manière concrète, ce qui peut rendre la fin du conflit difficile à définir ou à réaliser. En outre, ces objectifs plus abstraits peuvent également mener à des conflits plus intenses et prolongés. Parce que ces objectifs sont souvent perçus comme essentiels à l'identité ou à la survie d'une nation, les combattants sont souvent prêts à aller plus loin et à prendre plus de risques pour les atteindre. Enfin, ces objectifs idéologiques peuvent aussi rendre plus difficile la conclusion d'un accord de paix. Comme ces objectifs sont souvent absolus et non négociables, ils exigent souvent une capitulation sans conditions de l'adversaire, ce qui peut rendre les négociations plus compliquées et prolonger la durée des conflits.
La Seconde Guerre mondiale illustre parfaitement la notion de "guerre de deuxième type". L'objectif principal n'était pas seulement de vaincre militairement l'Allemagne nazie, mais aussi d'éliminer l'idéologie nazie elle-même. Cette guerre n'était pas simplement une question de territoire ou de ressources, mais une lutte idéologique. Le but n'était pas une capitulation traditionnelle, où les forces ennemies déposent les armes et retournent chez elles. Au contraire, le but était d'éradication totale du nazisme en tant que système politique et idéologique. Cela a abouti à des demandes de "capitulation sans condition" de la part des Alliés, signifiant que les nazis n'avaient pas la possibilité de négocier les termes de leur reddition. C'était une exigence inhabituelle dans le contexte historique des conflits, illustrant le caractère exceptionnel et total de cette guerre. De plus, après la fin de la guerre, l'Allemagne a été occupée et divisée, et un processus de "dénazification" a été entrepris pour éliminer l'influence nazie de la société allemande. Cela a démontré l'ampleur de l'engagement des Alliés à éliminer non seulement la menace militaire nazie, mais aussi l'idéologie nazie elle-même.
La transition vers ce type de guerre totale est intimement liée à l'évolution de l'État. Avec l'apparition de l'État-nation moderne et du nationalisme au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la guerre est devenue de plus en plus une affaire de tout le peuple, pas seulement de l'armée. Dans les guerres totales du XXe siècle, comme les deux guerres mondiales, tous les aspects de la société et de l'économie ont été mobilisés pour l'effort de guerre. Les civils sont devenus des cibles de guerre, soit directement par les bombardements, soit indirectement par le blocus et la famine. En outre, la raison d'être de ces guerres a souvent été exprimée en termes idéologiques ou existentiels, comme la défense de la démocratie contre le fascisme, ou la lutte pour la survie de la nation. Dans ce contexte, une simple victoire sur le champ de bataille n'était pas suffisante - l'ennemi devait être complètement vaincu et son système politique et idéologique démantelé.
Le régime nazi a été en mesure d'accéder au pouvoir et de commettre ses atrocités à une échelle aussi massive en grande partie grâce à l'infrastructure et à l'appareil étatiques de l'Allemagne de l'époque. Les structures étatiques modernes, comprenant des institutions bureaucratiques, militaires et économiques fortement centralisées, peuvent potentiellement être détournées pour des fins malveillantes, comme ce fut le cas avec le nazisme en Allemagne. En l'absence d'un État aussi puissant et bien organisé, il aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible, pour les idéologies totalitaires telles que le nazisme de mettre en œuvre leurs projets destructeurs à une échelle aussi massive. De même, sans la puissance industrielle et militaire d'un État moderne, le régime nazi n'aurait pas été en mesure de déclencher une guerre à l'échelle mondiale.
La Deuxième Guerre mondiale marque une rupture significative dans la manière dont la guerre est menée, notamment en termes de cibles. Avec la généralisation des bombardements aériens et l'industrialisation de la guerre, les civils deviennent des cibles directes. Cette guerre a vu le déplacement de la majorité des victimes de militaires à civils. Dans ce contexte, les armes de destruction massive, comme les bombes atomiques, peuvent provoquer des destructions massives et la mort de milliers, voire de centaines de milliers, de civils en un instant. De plus, l'effort de guerre implique toute la population, et l'industrie de l'armement est souvent un objectif prioritaire, ce qui conduit à une augmentation du nombre de victimes civiles. Les guerres de deuxième type ont également vu la mise en place de politiques génocidaires et de crimes contre l'humanité à grande échelle, nécessitant des moyens industriels et une organisation étatique. Les camps de concentration et d'extermination nazis sont un exemple tragique de la manière dont la capacité industrielle et la bureaucratie étatique peuvent être utilisées à des fins inhumaines. Tout cela illustre une fois de plus à quel point l'État moderne et sa capacité d'organisation et de mobilisation des ressources peuvent avoir des conséquences dramatiques lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient.
L'histoire du 20e siècle démontre clairement que la guerre et l'industrialisation sont intrinsèquement liées. Durant les deux Guerres mondiales, les nations ont dû rapidement transformer leurs économies pour soutenir l'effort de guerre, entraînant une accélération significative de l'industrialisation. En effet, les usines qui étaient autrefois dédiées à la production de biens de consommation ont été reconverties pour produire des armes, des véhicules militaires, des munitions et d'autres matériels de guerre. Ces industries ont dû être modernisées et rationalisées pour atteindre un niveau de production sans précédent, ce qui a favorisé le développement de nouvelles technologies et de nouvelles techniques de production. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, la production d'acier et d'autres matériaux essentiels a augmenté de façon exponentielle pour répondre aux besoins de la guerre. Cette capacité de production accrue a ensuite été réutilisée après la guerre pour stimuler la croissance économique.
A partir de la fin du 18e siècle, avec l'émergence des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, on assiste à une transformation majeure dans la nature des conflits. Ces guerres du deuxième type deviennent des guerres totales, impliquant non seulement les armées, mais également l'ensemble de la société. Dans ces guerres totales, la mobilisation de la population devient essentielle. Les États mettent en place des systèmes de conscription pour recruter un grand nombre de soldats, transformant ainsi la guerre en un véritable effort national. Les ressources économiques, industrielles et technologiques de chaque pays sont mobilisées pour soutenir l'effort de guerre. Cela signifie que toute la société est touchée par la guerre. Les civils sont directement impliqués, que ce soit en tant que combattants sur le front, en tant que travailleurs dans les usines d'armement, ou en tant que soutien logistique dans les infrastructures de communication, de transport et de santé. Les populations civiles subissent également les conséquences de la guerre, notamment les destructions matérielles, les déplacements forcés, les privations et les pertes humaines. Ces guerres totales bouleversent donc profondément la vie des sociétés impliquées. Elles renforcent le lien entre l'État et la population, transformant la guerre en un engagement collectif et national. La distinction entre front et arrière s'estompe, et la guerre devient une réalité omniprésente dans la vie quotidienne des civils.
Entre 1815 et 1914, il y a eu une période de relative stabilité et de paix en Europe, souvent appelée la "paix de cent ans" ou le "long 19e siècle". Pendant cette période, les grandes puissances européennes ont évité les conflits majeurs entre elles, ce qui a permis une certaine stabilité politique, économique et sociale sur le continent. Cependant, cette période de paix relative n'était pas exempte de tensions et de conflits plus limités. Il y a eu des guerres et des crises régionales, des conflits coloniaux et des luttes pour l'indépendance nationale qui ont éclaté pendant cette période. De plus, les rivalités et les tensions entre les puissances européennes se sont accumulées au fil du temps, notamment en raison de l'impérialisme, des rivalités coloniales et des tensions nationalistes. La stabilité apparente de cette période a été brisée par le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Ce conflit majeur a été un tournant dans l'histoire et a marqué la fin de la paix relative en Europe. Il a été suivi par une série de bouleversements politiques, sociaux et économiques majeurs qui ont marqué le 20e siècle.
Après les guerres napoléoniennes, le Congrès de Vienne s'est tenu en 1814-1815. Il a réuni les principales puissances européennes de l'époque dans le but de réorganiser l'Europe après les bouleversements causés par les guerres napoléoniennes et de prévenir de nouveaux conflits. Le Congrès de Vienne a établi le principe du "Concert des Nations", également connu sous le nom de "système de Vienne". C'était un système de diplomatie multilatérale où les grandes puissances européennes se réunissaient régulièrement pour discuter des questions internationales et maintenir la paix en Europe. L'idée était de créer un équilibre des pouvoirs et d'éviter les guerres destructrices qui avaient caractérisé la période napoléonienne. Le Concert des Nations a été une tentative de mettre en place un système de relations internationales basé sur la coopération, la concertation et la diplomatie. Cependant, malgré ses efforts, le système a montré ses limites au fil du temps, notamment lorsqu'il s'est agi de faire face aux changements politiques et aux aspirations nationalistes qui ont émergé au cours du 19e siècle. La période qui a suivi le Congrès de Vienne a été marquée par des tensions et des conflits, y compris la montée du nationalisme, les révolutions de 1848 et les rivalités coloniales. Ces développements ont finalement conduit à la fin de la "paix de cent ans" et au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914.
Le Concert des Nations, également connu sous le nom de Système de Metternich, a été institué après la chute de Napoléon en 1815 lors du Congrès de Vienne. Les gagnants de la guerre contre Napoléon – à savoir la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, qui étaient les principales puissances de l'époque – ont défini de nouvelles règles pour la gestion des relations internationales. Ces règles ont mis en place un système de concertation pour la gestion des différends entre les États, fondé sur l'équilibre des puissances, le respect des traités et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. L'idée était d'éviter la récurrence des guerres dévastatrices qui avaient marqué l'ère napoléonienne. Par conséquent, bien qu'il n'ait pas été un système de sécurité collective à part entière, le Concert des Nations a favorisé la coopération entre les puissances et a contribué à maintenir la stabilité en Europe pendant une grande partie du 19ème siècle. En effet, ce système a fonctionné relativement bien pendant un certain temps, avec une diminution notable du nombre de grandes guerres en Europe. Cependant, il a également été critiqué pour avoir soutenu et renforcé le statu quo, entravant ainsi le progrès social et politique. De plus, il a finalement échoué à empêcher l'éclatement des guerres mondiales au 20ème siècle. Le Concert des Nations a marqué une étape importante dans l'histoire des relations internationales, car il a posé les bases de la diplomatie multilatérale moderne et a servi de précurseur à des organisations internationales comme la Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies.
L'ère Post-1945
Bien qu'il y ait eu des tensions considérables pendant la Guerre froide, notamment entre l'Union soviétique et les États-Unis, l'Europe a vécu une période de paix sans précédent depuis 1945. Cette période, souvent appelée la "Pax Europaea" ou la paix européenne, a marqué la période la plus longue de paix sur le continent dans l'histoire moderne. Après les guerres napoléoniennes, l'Europe a vécu une période relativement paisible connue sous le nom de "Paix de cent ans" entre 1815 et 1914, malgré quelques conflits notables tels que la Guerre de Crimée et la Guerre franco-prussienne. Cette période a été marquée par la stabilité générale assurée par le Concert des Nations, qui promouvait l'équilibre des puissances et la résolution diplomatique des conflits. De même, malgré les tensions de la Guerre froide et la menace d'une destruction nucléaire après 1945, l'Europe a connu une période de paix extraordinairement longue. Cette "Pax Europaea" peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont la dissuasion nucléaire, la création et l'expansion de l'Union européenne, la présence de forces de l'OTAN et le Pacte de Varsovie, ainsi que l'aide économique substantielle apportée par le Plan Marshall. Ces éléments ont contribué à une interdépendance accrue entre les nations européennes, ce qui a rendu les conflits directs non seulement indésirables, mais aussi de plus en plus impensables. Ainsi, malgré les défis et les tensions du monde de l'après-guerre, l'Europe a pu maintenir une paix durable et significative.
Jusqu'aux conflits récents en Ukraine, la paix en Europe a été largement maintenue. Le conflit en Ukraine, qui a commencé en 2014, représente une rupture significative de cette paix. Cependant, il est important de noter que ce conflit est plus localisé et n'a pas entraîné une guerre à grande échelle impliquant de nombreux pays européens, comme ce fut le cas pour les deux guerres mondiales. La crise ukrainienne a mis en évidence certaines des tensions qui existent toujours en Europe, en particulier entre la Russie et les nations occidentales. La situation en Ukraine est complexe et a soulevé de nombreux défis pour la stabilité et la sécurité en Europe. Cela a remis en question l'efficacité de certaines des structures et accords qui ont contribué à maintenir la paix en Europe pendant des décennies. Néanmoins, même avec le conflit en Ukraine, la période depuis 1945 reste une des plus pacifiques de l'histoire européenne, en particulier en comparaison avec les siècles précédents qui ont été marqués par de fréquentes et dévastatrices guerres.
Alors que l'Europe et d'autres régions du monde développé ont connu une période de paix relative depuis la Seconde Guerre mondiale, de nombreux autres endroits ont souffert de conflits violents pendant la Guerre froide et après. Cette période a été marquée par un certain nombre de guerres par procuration, où les grandes puissances ont soutenu des parties opposées dans des conflits locaux sans s'engager directement dans la guerre. Des exemples de ces guerres par procuration comprennent la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre civile angolaise, et les guerres en Afghanistan, parmi d'autres. Ces conflits ont souvent entraîné de lourdes pertes civiles et ont eu des impacts à long terme sur la stabilité et le développement des régions concernées. C'est un rappel important que, bien que la "Pax Europaea" et la paix entre les grandes puissances soient importantes, elles ne représentent pas toute l'histoire de la guerre et de la paix au XXe siècle et au-delà. Les conflits continuent d'affecter de nombreuses parties du monde, souvent avec des conséquences dévastatrices pour les populations locales.
Historiquement, les conflits majeurs étaient souvent le résultat de guerres directes entre grandes puissances. Cependant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, ces puissances ont largement évité de s'engager dans des conflits directs les unes avec les autres. Cette transition peut être attribuée à plusieurs facteurs. Le développement et la prolifération des armes nucléaires ont créé une dissuasion mutuelle, où le coût d'un conflit direct serait la destruction totale. Par ailleurs, l'augmentation de l'interdépendance économique a rendu la guerre moins attractive pour les grandes puissances, car elle perturberait le commerce mondial et les marchés financiers. De plus, la création d'institutions internationales comme l'Organisation des Nations Unies a fourni des mécanismes pour la résolution pacifique des différends. Enfin, la diffusion de la démocratie a également pu contribuer à cette tendance, étant donné que les démocraties ont tendance à éviter de faire la guerre entre elles, un concept connu sous le nom de "paix démocratique".
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une tendance croissante vers l'idée de la guerre comme étant illégale ou, en tout cas, quelque chose qui doit être évité. C'est une évolution majeure de la façon dont la guerre a été perçue historiquement. La création de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale a été un premier pas vers cette idée. Bien que la Société des Nations n'ait pas réussi à empêcher la Seconde Guerre mondiale, son successeur, l'Organisation des Nations Unies, a été fondé sur des principes similaires de résolution pacifique des différends et de prévention de la guerre. De plus, l'évolution du droit international humanitaire et des conventions de Genève a établi certaines règles sur la conduite de la guerre, avec l'idée d'en minimiser les effets néfastes. Plus récemment, l'idée de la "Responsabilité de protéger" (R2P) a été développée pour justifier une intervention internationale dans les situations où un État est incapable ou refuse de protéger sa propre population.
Le philosophe Emmanuel Kant a esquissé un projet pour une "paix perpétuelle" dans un traité qu'il a publié en 1795. Kant a formulé l'idée que les démocraties libérales sont moins susceptibles d'entrer en guerre les unes avec les autres, une théorie qui a été reprise par d'autres penseurs politiques et qui est devenue connue sous le nom de "paix démocratique". Selon cette théorie, les démocraties sont moins enclines à la guerre parce que leur gouvernement est responsable devant ses citoyens, qui ont à subir les coûts humains et économiques des conflits. Kant a également promu l'idée d'une fédération de nations libres, une sorte d'ancêtre des organisations internationales actuelles comme les Nations Unies. Cette "fédération de la paix" aurait pour but de résoudre les conflits par la négociation et le droit international plutôt que par la guerre.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les nations du monde ont cherché à établir des structures pour maintenir la paix et prévenir de futurs conflits. Cela a conduit à la création de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui a pour objectif de faciliter la coopération internationale et de prévenir les conflits. L'ONU est un exemple de ce que l'on appelle un système de sécurité collective. Dans un tel système, les États s'engagent à coopérer pour assurer la sécurité de tous. Si un État attaque un autre, les autres États sont censés se ranger du côté de l'État attaqué et prendre des mesures pour dissuader ou arrêter l'agresseur. Outre l'ONU, d'autres organisations et traités ont également été établis pour promouvoir la sécurité collective, comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et l'Union européenne. Ces mécanismes ont contribué à la prévention des conflits majeurs entre grandes puissances depuis 1945. Cependant, ils ont aussi leurs limites et ne sont pas toujours efficaces pour prévenir les conflits, comme on peut le voir dans les nombreux conflits régionaux et guerres civiles qui ont eu lieu depuis 1945.
La Charte des Nations Unies, mise en place en 1945, a établi des règles essentielles pour réguler l'usage de la force entre les États. En général, elle interdit l'usage de la force dans les relations internationales, sauf sous deux circonstances spécifiques. Premièrement, l'article 51 de la Charte consacre le droit inhérent des États à la légitime défense, individuelle ou collective, en cas d'attaque armée. Cela signifie qu'un État est en droit de se défendre si lui-même, ou un autre État avec lequel il a conclu un accord de défense, est attaqué. Deuxièmement, le chapitre VII de la Charte permet au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des mesures pour préserver ou restaurer la paix et la sécurité internationales. Cela peut inclure le recours à la force et a servi de base à l'autorisation de plusieurs interventions militaires, comme celle de la Guerre du Golfe en 1991. Bien que ces principes aient été conçus pour limiter le recours à la force et encourager la résolution pacifique des conflits, ils ont également été sujets à controverse, en particulier en ce qui concerne leur interprétation et application dans des situations concrètes.
Depuis 1945, il y a eu une tendance croissante vers la régulation et l'interdiction de la guerre. La Charte des Nations Unies a été un jalon important dans cette évolution, en interdisant le recours à la force dans les relations internationales, sauf en cas de légitime défense ou d'autorisation par le Conseil de sécurité. Outre la Charte des Nations Unies, d'autres traités et conventions ont également contribué à cette tendance. Par exemple, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels ont établi des règles strictes pour la conduite de la guerre, dans le but de limiter les souffrances humaines. De même, les traités de contrôle des armements, comme le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ont cherché à limiter la prolifération des armes les plus destructrices. En même temps, il y a eu un mouvement croissant vers la résolution pacifique des conflits. Les mécanismes de résolution pacifique des différends, comme la médiation, l'arbitrage et le règlement judiciaire, sont de plus en plus utilisés pour résoudre les différends internationaux. Cependant, bien que ces efforts aient contribué à limiter et réguler la guerre, ils n'ont pas réussi à l'éliminer complètement. Les conflits continuent de se produire dans de nombreuses régions du monde, soulignant le défi persistant de la réalisation d'une paix durable et universelle.
Les transformations contemporaines de la guerre
La fin de la Guerre froide en 1989, marquée par la chute du mur de Berlin, a représenté un tournant majeur dans l'histoire de la guerre moderne. Durant cette période de tension bipolaire entre l'Est et l'Ouest, le monde avait été divisé entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Bien que ces deux superpuissances n'aient jamais été en conflit direct, elles ont soutenu des guerres par procuration dans le monde entier, menant à des conflits prolongés et coûteux. La fin de la Guerre froide a changé la dynamique de la guerre moderne de plusieurs façons. Tout d'abord, elle a signifié la fin de la bipolarité qui avait caractérisé la politique mondiale pendant près d'un demi-siècle. En conséquence, la nature des conflits a changé, passant de guerres entre États à des guerres civiles et à des conflits non étatiques. Deuxièmement, la fin de la Guerre froide a également ouvert la voie à une nouvelle vague d'optimisme concernant la possibilité d'une paix mondiale durable. Il y a eu un espoir que, sans la tension constante de la Guerre froide, le monde pourrait faire des progrès significatifs vers la résolution des conflits et la prévention de la guerre. Enfin, la fin de la Guerre froide a également conduit à un certain nombre de nouveaux défis, notamment la prolifération des armes nucléaires, la montée du terrorisme international et le problème croissant des États défaillants. Ces défis ont influencé la nature de la guerre moderne et continuent d'être des problèmes majeurs pour la sécurité mondiale.
La fin de la Guerre froide en 1989 a marqué un tournant significatif dans l'histoire mondiale, qui a eu des implications profondes pour la nature de la guerre et de l'État moderne. Jusqu'à cette date, l'évolution de la guerre moderne était étroitement liée à l'émergence et à la consolidation de l'État-nation moderne. Cet État était caractérisé par une souveraineté territoriale clairement définie, le monopole de la violence légitime, et une structure de gouvernance centralisée. Les guerres étaient principalement des affrontements entre ces États-nations. Cependant, après 1989, de nombreux chercheurs ont observé une transformation significative de cette dynamique. Les guerres devenaient moins fréquemment des confrontations directes entre États-nations, et plus souvent des conflits internes, des guerres civiles, ou des guerres impliquant des acteurs non étatiques tels que des groupes terroristes ou des milices. En outre, la notion même de souveraineté de l'État a commencé à être remise en question. Les interventions humanitaires, les opérations de maintien de la paix et la doctrine de la "responsabilité de protéger" ont toutes remis en question l'idée traditionnelle de la non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Par conséquent, on peut dire que la fin de la Guerre froide a inauguré une nouvelle ère dans laquelle la relation entre la guerre et l'État est en train d'évoluer. Les contours précis de cette nouvelle ère sont encore l'objet de débats parmi les chercheurs et les analystes.
Depuis la fin de la Guerre froide, de nombreux chercheurs et experts militaires suggèrent que la guerre a connu une transformation significative. Ces transformations ont été attribuées à divers facteurs, notamment l'évolution des technologies militaires, la mondialisation, les changements dans la nature de l'État et le déclin relatif de la guerre interétatique. Les guerres d'aujourd'hui sont souvent décrites comme "postmodernes", pour refléter leur différence avec les guerres traditionnelles des siècles précédents. Les guerres postmodernes se caractérisent souvent par leur complexité, impliquant une multitude d'acteurs étatiques et non étatiques, et parfois même des entreprises privées et des organisations non gouvernementales. Elles ont souvent lieu en milieu urbain, plutôt que sur des champs de bataille traditionnels, et peuvent impliquer des acteurs asymétriques, comme des groupes terroristes ou des cyber-attaquants. Ces guerres postmodernes ont également remis en question les normes et les règles traditionnelles de la guerre. Par exemple, comment appliquer les principes du droit international humanitaire, conçus pour les guerres entre États, à des conflits impliquant des acteurs non étatiques ou à des cyberattaques ? Cela ne signifie pas que les anciennes formes de guerre ont complètement disparu. Il existe toujours des conflits qui ressemblent à des guerres traditionnelles. Cependant, ces nouvelles formes de conflit ont ajouté une couche de complexité à l'art de la guerre, et exigent une réflexion constante et une adaptation aux nouvelles réalités du XXIe siècle.
Le Nouveau (Dés)Ordre Mondial
La chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l'Union soviétique en 1991 ont marqué la fin de la Guerre froide et du système bipolaire qui avait dominé la politique mondiale pendant près d'un demi-siècle. Pendant cette période, les États-Unis et l'Union soviétique, en tant que superpuissances, avaient établi deux blocs d'influence globale distincts. Malgré des tensions constantes et de nombreuses crises, un conflit ouvert entre ces deux puissances a été évité, en grande partie en raison de la menace de la destruction mutuelle assurée (MAD) en cas de guerre nucléaire. Cependant, la fin de la Guerre froide n'a pas conduit à un "nouvel ordre mondial" de paix et de stabilité comme certains l'avaient espéré. Au lieu de cela, de nouveaux défis et conflits ont émergé. Les États faillis, les guerres civiles, le terrorisme international et la prolifération des armes de destruction massive sont devenus des problèmes majeurs. La nature des conflits a également changé, avec une augmentation des guerres asymétriques et des conflits impliquant des acteurs non étatiques.
La fin de la Guerre froide a initié une nouvelle ère dans la politique mondiale, marquée par une certaine dose d'optimisme. De nombreux experts et décideurs politiques espéraient que la fin de la rivalité entre les superpuissances conduirait à une ère de paix et de coopération internationales accrues. Le philosophe politique Francis Fukuyama a même décrit cette période comme "la fin de l'histoire", suggérant que la démocratie libérale avait finalement émergé comme le système de gouvernement incontesté et définitif. Avec la disparition de l'Union soviétique, les États-Unis se sont retrouvés comme la seule superpuissance mondiale, inaugurant ce que certains ont appelé l'"hyperpuissance" américaine. Beaucoup pensaient que cette nouvelle ère unipolaire permettrait une plus grande stabilité et paix dans le monde. Dans le même temps, la fin de la rivalité entre les deux superpuissances a permis aux Nations Unies de jouer un rôle plus efficace dans la prévention des conflits et la promotion de la paix. L'obstruction systématique par l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui avait souvent paralysé l'organisation pendant la Guerre froide, a été largement levée. Cela a donné lieu à une augmentation significative des opérations de maintien de la paix de l'ONU au cours des années 1990.
Avec la fin de la Guerre froide, les années 1990 ont été marquées par une augmentation significative des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Les Casques bleus de l'ONU ont été déployés dans des conflits du monde entier, dans le but de maintenir ou de rétablir la paix et de promouvoir la réconciliation et la reconstruction. L'idée était que ces opérations de maintien de la paix pourraient aider à prévenir l'escalade des conflits, protéger les civils, faciliter la fourniture de l'aide humanitaire et soutenir le processus de paix. En d'autres termes, ces missions étaient censées aider à "récolter les dividendes de la paix" après la fin de la Guerre froide.
La fin de la Guerre froide et l'émergence d'un nouveau système international ont été accompagnées par un discours croissant sur le "désordre mondial". Ce terme fait référence à l'idée que le monde post-Guerre froide est caractérisé par une incertitude accrue, des défis mondiaux complexes et interconnectés, et l'absence d'un cadre clair et stable pour la gouvernance internationale. Plusieurs facteurs ont contribué à cette perception de "désordre mondial". Tout d'abord, la fin de la bipolarité de la Guerre froide a éliminé le cadre clair qui avait auparavant structuré les relations internationales. Au lieu d'un monde divisé entre deux superpuissances, nous avons assisté à un paysage plus complexe et multipolaire avec plusieurs acteurs importants, y compris non seulement les États-nations, mais aussi les organisations internationales, les entreprises multinationales, les groupes non gouvernementaux et autres. Ensuite, le monde post-Guerre froide a été marqué par une série de défis mondiaux, notamment le terrorisme transnational, les crises financières, le changement climatique, les pandémies, la cybersécurité, et d'autres problèmes qui ne respectent pas les frontières nationales et ne peuvent pas être résolus par un seul pays ou même par un groupe de pays. Enfin, il y a eu une prise de conscience croissante des limites et des contradictions des institutions internationales existantes. Par exemple, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, et d'autres organisations ont été critiquées pour leur manque de représentativité, leur inefficacité, et leur incapacité à répondre efficacement aux défis mondiaux. Dans ce contexte, la question de savoir comment gérer ce "désordre mondial" et construire un système international plus juste, efficace et résilient est devenue un enjeu central de la politique mondiale.
Dans son livre très discuté "Le Choc des civilisations", l'analyste politique Samuel P. Huntington a proposé une nouvelle manière de voir le monde post-Guerre froide. Il a argumenté que les futures sources de conflit international n'impliqueraient pas tant les idéologies politiques ou économiques, mais plutôt les différences entre les diverses grandes civilisations du monde. Selon Huntington, le monde pourrait être divisé en environ huit civilisations majeures, basées sur la religion et la culture. Il prévoyait que les conflits les plus importants du 21e siècle auraient lieu entre ces civilisations, en particulier entre la civilisation occidentale et les civilisations islamique et confucianiste (cette dernière principalement représentée par la Chine).
La fin de la Guerre froide a marqué une transition significative dans la nature des conflits. Alors que la période de la Guerre froide était dominée par des conflits interétatiques et des guerres par procuration entre les deux superpuissances, l'ère post-Guerre froide a vu une augmentation significative des guerres civiles et des conflits internes. Ces conflits ont souvent impliqué une variété d'acteurs non étatiques, tels que les groupes rebelles, les milices, les groupes terroristes et les gangs criminels. De plus, ils ont souvent été marqués par une violence intense et prolongée, des violations massives des droits de l'homme, et de graves crises humanitaires. Ces tendances ont posé de sérieux défis pour la communauté internationale. D'une part, il a été plus difficile de gérer et de résoudre ces conflits, car ils impliquent souvent des problèmes profondément enracinés tels que l'identité ethnique ou religieuse, la gouvernance, l'inégalité et l'accès aux ressources. D'autre part, ces conflits ont souvent des effets déstabilisateurs qui dépassent les frontières nationales, tels que les flux de réfugiés, la propagation de groupes extrémistes, et la déstabilisation régionale.
Historiquement, l'État-nation était le principal acteur des conflits armés, et la plupart des guerres se produisaient entre États. Cependant, avec l'effondrement de l'ordre mondial bipolaire à la fin de la Guerre froide, la nature de la guerre a commencé à changer. La guerre civile, qui était autrefois un type de conflit relativement rare, est devenue de plus en plus courante. Ces conflits internes ont souvent impliqué une variété d'acteurs non étatiques, tels que les groupes rebelles, les milices, les groupes terroristes et les gangs criminels. La montée des guerres civiles a posé de nouveaux défis pour la gestion des conflits et la sécurité internationale. Contrairement aux guerres interétatiques, les guerres civiles sont souvent plus complexes et difficiles à résoudre. Elles peuvent impliquer des problèmes profondément enracinés tels que les divisions ethniques ou religieuses, la gouvernance, l'inégalité et l'accès aux ressources. De plus, ces conflits ont souvent des conséquences déstabilisatrices qui dépassent les frontières nationales, comme les flux de réfugiés, la propagation de groupes extrémistes et la déstabilisation régionale
Depuis la fin de la Guerre froide en 1989, la nature des conflits a changé de manière significative. Alors que les guerres interétatiques étaient autrefois la forme dominante de conflit, l'ère post-Guerre froide a été marquée par une augmentation des guerres civiles et des conflits internes. Ces guerres civiles ont souvent impliqué un éventail d'acteurs non étatiques, y compris des groupes armés, des milices, des groupes terroristes et des gangs. Par conséquent, on a souvent l'impression que l'État n'est plus l'acteur principal dans les conflits armés. Cela représente un défi significatif pour le système international, qui a été construit sur le principe de la souveraineté de l'État et qui est conçu pour gérer les conflits entre États. Les guerres civiles sont souvent plus complexes, plus difficiles à résoudre et plus susceptibles de provoquer des crises humanitaires que les guerres interétatiques.
L'ère post-Guerre froide a été marquée par l'émergence et la prolifération d'une variété d'acteurs non étatiques qui sont devenus des acteurs clés dans de nombreux conflits à travers le monde. Les groupes terroristes, les milices, les organisations criminelles telles que les mafias et les gangs sont devenus des acteurs importants dans la violence et les conflits. Ces acteurs ont souvent réussi à exploiter les faiblesses de l'État, notamment dans les pays où l'État est faible ou fragile, où il n'a pas la capacité de contrôler efficacement son territoire ou de fournir des services de base à sa population. Ils ont souvent utilisé la violence pour atteindre leurs objectifs, que ce soit pour saper l'autorité de l'État, pour contrôler un territoire ou des ressources, ou pour faire avancer une cause politique ou idéologique. Cela a eu de nombreuses implications pour la sécurité internationale. D'une part, cela a rendu les conflits plus complexes et plus difficiles à résoudre. D'autre part, cela a entraîné une augmentation de la violence et de l'instabilité, avec des conséquences dévastatrices pour les populations civiles.
Le concept de souveraineté, qui a longtemps été fondamental pour structurer le système interétatique et réguler la violence, a été sérieusement remis en question dans le contexte post-Guerre froide. La montée des acteurs non étatiques violents, tels que les groupes terroristes et les organisations criminelles, a souvent eu lieu dans des zones où l'autorité de l'État est faible ou absente, ce qui a mis en évidence les limites de la souveraineté en tant que moyen de maintenir l'ordre et la sécurité. En outre, la prolifération des conflits internes et des guerres civiles a soulevé des questions importantes sur la responsabilité de l'État de protéger sa propre population et sur le droit de la communauté internationale d'intervenir dans les affaires d'un État souverain pour prévenir ou mettre fin à de graves violations des droits de l'homme. Ces défis ont conduit à des discussions et des débats importants sur la nature et la signification de la souveraineté au XXIe siècle. Parmi les concepts qui ont émergé de ces débats figure le principe de la "responsabilité de protéger", qui stipule que la souveraineté n'est pas seulement un droit, mais aussi une responsabilité, et que si un État est incapable ou refuse de protéger sa population de crimes de masse, la communauté internationale a la responsabilité d'intervenir.
Les "États faillis", ou États défaillants, sont des États qui n'arrivent plus à maintenir l'ordre et à assurer la sécurité sur l'ensemble de leur territoire, à fournir des services essentiels à leur population ou à représenter un pouvoir légitime aux yeux de leurs citoyens. Ces États, bien que toujours reconnus comme souverains sur la scène internationale, sont souvent confrontés à une perte de contrôle sur une partie significative de leur territoire, à des insurrections ou à des conflits internes violents, ainsi qu'à la corruption et à une mauvaise gouvernance. Depuis les années 1990, un grand nombre de conflits, en particulier en Afrique, mais aussi dans d'autres régions du monde, ont eu lieu dans ces États faillis. Ces conflits sont souvent caractérisés par des violences massives à l'encontre des civils, des violations généralisées des droits de l'homme et du droit humanitaire international, et ont souvent des répercussions déstabilisantes sur les pays et les régions environnants.
L'augmentation des conflits internes et des guerres civiles à partir des années 1990 a suscité une réévaluation du concept traditionnel de souveraineté dans le discours international. Alors que la souveraineté était auparavant considérée comme une garantie d'ordre et de stabilité, protégeant les États de l'interférence extérieure, elle a commencé à être perçue de manière plus problématique. Dans ce contexte, la souveraineté a parfois été considérée comme une barrière à l'intervention internationale dans les situations où des populations étaient menacées par des violences massives, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Cela a donné lieu à des débats sur la "responsabilité de protéger" et sur la question de savoir quand et comment la communauté internationale devrait intervenir pour protéger les populations civiles, même en violation du principe traditionnel de non-ingérence dans les affaires internes d'un État souverain. En outre, la souveraineté a également été mise en question en tant que source de légitimité, lorsque des régimes autoritaires ou despotiques s'en sont prévalus pour justifier des violations des droits de l'homme ou pour résister aux demandes de réforme démocratique. Ainsi, bien que la souveraineté reste un principe fondamental du système international, sa signification et son application sont devenues de plus en plus contestées dans le contexte contemporain.
L'Emergence des Nouvelles Guerres
Mary Kaldor, une spécialiste des relations internationales et de la théorie de la guerre, a présenté l'idée des "nouvelles guerres" dans son ouvrage "New and Old Wars: Organised violence in a global era" (1999). Selon elle, les conflits qui ont émergé après la fin de la Guerre froide présentent des caractéristiques distinctes des "anciennes guerres" traditionnelles, en grande partie en raison de l'impact de la mondialisation et des changements politiques, économiques et technologiques.
Les "nouvelles guerres", selon Kaldor, sont typiquement caractérisées par :
- La dégradation de la guerre en violences diffuses et souvent décentralisées, impliquant une variété d'acteurs non étatiques, tels que des milices, des groupes terroristes, des gangs criminels et des seigneurs de guerre.
- La focalisation sur l'identité plutôt que sur l'idéologie comme moteur de conflit, avec souvent un recours à des discours ethniques, religieux ou nationalistes pour mobiliser le soutien et justifier la violence.
- L'importance accrue des crimes contre l'humanité et des attaques contre les civils, plutôt que des combats conventionnels entre forces armées.
- L'implication croissante des acteurs internationaux et transnationaux, à la fois en termes de financement et de soutien aux parties en conflit, et en termes d'efforts pour résoudre les conflits ou atténuer leurs impacts humanitaires.
Ces "nouvelles guerres" présentent des défis distincts en termes de prévention, de résolution et de reconstruction après conflit, et nécessitent des stratégies et des approches différentes de celles qui étaient efficaces dans les "anciennes guerres".
Dans son analyse des nouvelles guerres, Mary Kaldor soutient que l'ère post-1989 est marquée par trois éléments clés. Le premier est la globalisation. La fin du XXe siècle a été caractérisée par une accélération de la mondialisation, transformant en profondeur les relations économiques, politiques et culturelles au niveau global. Cette globalisation a des répercussions directes sur la nature des conflits. Le financement transnational de groupes armés, la diffusion d'idéologies extrémistes par le biais des médias numériques, ou encore l'implication de forces internationales dans des opérations de maintien de la paix sont autant de phénomènes qui en sont issus. Deuxièmement, l'époque post-1989 est marquée par une transformation majeure des structures politiques. Avec la fin de la Guerre froide, de nombreux régimes communistes et autoritaires se sont effondrés, donnant naissance à de nouvelles démocraties. Parallèlement, les interventions internationales dans les affaires internes des États se sont multipliées, souvent justifiées par la nécessité de protéger les droits de l'homme ou de prévenir les génocides. Enfin, Kaldor met en évidence un changement fondamental dans la nature de la violence. Les conflits sont devenus plus diffus et décentralisés, impliquant une multitude d'acteurs non étatiques. Les attaques délibérées contre les civils, l'exploitation de l'identité ethnique ou religieuse à des fins de mobilisation, et l'utilisation de tactiques de terreur sont devenues monnaie courante. Ainsi, selon Kaldor, ces trois éléments interagissent pour créer un nouveau type de guerre, profondément différent des guerres interétatiques traditionnelles du passé.
Selon Mary Kaldor, l'ère moderne a vu un glissement des idéologies vers les identités comme principaux moteurs des conflits. Dans ce contexte, les batailles ne sont plus menées pour des idéaux politiques, mais pour l'affirmation et la défense d'identités particulières, souvent ethniques. Cette évolution marque un pas vers l'exclusion, car elle peut entraîner une polarisation et une division accrues dans la société. Contrairement à un débat idéologique où il peut y avoir compromis et consensus, la défense de l'identité peut créer une dynamique de "nous contre eux", qui peut être extrêmement destructrice.
Mary Kaldor met en évidence ce changement crucial dans les motifs de conflit. Lorsque les luttes étaient centrées sur des idéologies, comme le socialisme international par exemple, elles avaient un caractère plus inclusif. Le but était de convaincre et de rallier le plus grand nombre à une cause, à un système de pensée ou à une vision du monde. En revanche, lorsque les conflits sont basés sur l'identité, en particulier sur l'identité ethnique, ils ont tendance à être plus exclusifs. En se battant pour une identité ethnique spécifique, on délimite un groupe particulier comme étant le "nous", ce qui implique inévitablement un "eux" qui est distinct et différent. Cela crée une dynamique d'exclusion qui peut être profondément divisante et conduire à des violences intercommunautaires. C'est un changement profond par rapport aux conflits idéologiques du passé.
D’autre part, selon Kaldor, la guerre n’est plus pour le peuple, mais contre le peuple, c’est-à-dire que nous sommes de plus en plus face à des acteurs qui ne représentent pas l’État et qui n’aspirent même pas à être l’État. Auparavant, les conflits étaient généralement menés par des États ou des acteurs qui aspiraient à contrôler l'État. La guerre était donc menée "pour le peuple", dans le sens où l'objectif était de gagner le contrôle du gouvernement pour, théoriquement, servir les intérêts du peuple. Dans le contexte actuel, elle affirme que la guerre est souvent menée "contre le peuple". Cela signifie que les acteurs non étatiques tels que les groupes terroristes, les milices ou les gangs sont de plus en plus impliqués dans les conflits. Ces groupes ne cherchent pas nécessairement à contrôler l'État et peuvent en fait s'engager dans des actes de violence principalement dirigés contre les populations civiles. Ainsi, la nature de la guerre a évolué pour devenir moins une lutte pour le contrôle de l'État et davantage une source de violence contre le peuple.
Il y a de plus en plus une guerre de bandits où l’objectif est d’extraire les ressources naturelles des pays pour l’enrichissement personnel de certains groupes. Mary Kaldor décrit cette transformation comme une forme de "guerre de banditisme". Dans ce contexte, la guerre n'est pas menée pour atteindre des objectifs politiques traditionnels, comme le contrôle de l'État ou la défense d'une idéologie, mais plutôt pour l'enrichissement personnel ou de groupe. Cette nouvelle forme de conflit est souvent caractérisée par l'extraction et l'exploitation de ressources naturelles dans des régions en proie à des conflits Ces "guerres de banditisme" peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les populations locales, non seulement en raison de la violence directe qu'elles impliquent, mais aussi à cause de la déstabilisation économique et sociale qu'elles engendrent. Souvent, les ressources qui pourraient être utilisées pour le développement économique et social sont plutôt détournées au profit d'intérêts privés ou de groupes, ce qui peut exacerber la pauvreté et l'inégalité.
L'ère post-Guerre Froide a vu l'émergence d'une économie mondiale de la guerre, où des acteurs non étatiques comme des organisations criminelles, des groupes terroristes et des milices privées jouent un rôle de plus en plus important. Ces groupes s'appuient souvent sur des réseaux transnationaux pour financer leurs opérations, par le biais du trafic de drogues, du commerce illégal d'armes, de la contrebande de biens, et d'autres formes de criminalité organisée. Cette économie de la guerre a pour effet de prolonger les conflits, en offrant aux groupes armés un moyen de financer leurs activités sans le besoin d'un soutien étatique ou populaire. En même temps, elle contribue à l'instabilité régionale, car les profits de ces activités illégales sont souvent utilisés pour financer d'autres formes de violence et de désordre. En outre, ces réseaux transnationaux rendent plus difficile le contrôle et la résolution des conflits par les autorités étatiques et les organisations internationales. Ils opèrent souvent en dehors des cadres juridiques traditionnels et peuvent s'étendre à travers plusieurs pays ou régions, compliquant ainsi les efforts pour les combattre. Enfin, l'implication d'acteurs non étatiques dans les conflits peut également avoir des effets déstabilisateurs sur les États, en sapant leur autorité et leur capacité à maintenir l'ordre et la sécurité. Cela peut à son tour aggraver les tensions et les conflits, créant un cercle vicieux de violence et d'instabilité.

L'approche de Mary Kaldor sur la guerre peut être considérée comme dépolitisante. Elle soutient que les conflits contemporains sont principalement motivés par des facteurs ethniques, religieux ou identitaires plutôt que par des idéologies politiques. Cela marque une rupture avec les guerres du passé, qui étaient souvent menées au nom d'une idéologie politique, comme le communisme ou le fascisme. Dans cette perspective, la guerre n'est plus une continuation de la politique par d'autres moyens, comme l'a dit le théoricien militaire Carl von Clausewitz, mais plutôt un acte de violence motivé par des différences identitaires. Cela suggère que les solutions traditionnelles, comme les négociations politiques ou les accords de paix, pourraient ne pas être suffisamment efficaces pour résoudre ces conflits.
La vision traditionnelle de la guerre, comme le décrivait Carl von Clausewitz, la considère comme "la continuation de la politique par d'autres moyens". Dans cette perspective, la guerre est vue comme un outil que les Etats utilisent pour atteindre des objectifs politiques spécifiques. Cependant, selon l'approche de Mary Kaldor et d'autres chercheurs similaires, cette dynamique aurait changé. Ils soutiennent que dans les conflits contemporains, les objectifs politiques traditionnels sont souvent éclipsés par d'autres motivations, telles que l'identité ethnique ou religieuse, ou le désir d'accéder à des ressources économiques. Dans ces cas, la guerre n'est plus au service de la politique, mais semble plutôt être motivée par des intérêts économiques ou identitaires.
Nous sommes confronté à des États issus de la décolonisation, principalement dans les régions du sud, qui ont eu des processus de construction nationale difficiles. Ces États n'ont souvent pas reçu les outils nécessaires pour une structuration solide et durable. Par conséquent, ils sont devenus fragiles et instables, une situation qui favorise l'émergence de conflits et de violences. Lorsque ces États commencent à se désagréger, ils laissent place à un certain chaos où des groupes ethniques peuvent se retrouver en conflit les uns avec les autres. Parallèlement, des bandits et d'autres acteurs non étatiques profitent de cette instabilité pour leurs propres intérêts. L'absence d'une autorité étatique forte et efficace contribue à perpétuer ce désordre et empêche l'établissement d'une paix durable.
La perspective proposée par Mary Kaldor, qui suggère une disparition des conflits politiques au profit d'une forme de désordre mondial, a eu un impact significatif sur notre compréhension des transformations contemporaines de la guerre. Selon cette vision, les États faibles ou en déliquescence seraient incapables d'assurer une stabilité sur leur territoire, ce qui ouvrirait la porte à un ensemble de menaces et de dangers. En l'absence de la structure et du contrôle de l'État, un certain chaos peut émerger, générant des conflits souvent ethniques, des activités criminelles et un accès illimité à des ressources naturelles par divers groupes non étatiques. C'est dans ce contexte que l'on voit une augmentation des guerres civiles et des conflits internes, alimentés par des réseaux transnationaux tels que les mafias. L'absence d'un État stable et fort conduit donc à un paysage conflictuel complexe, où les conflits politiques classiques cèdent la place à une multitude de menaces plus diffuses et décentralisées. Cette approche a joué un rôle clé dans la façon dont nous comprenons les conflits modernes et les défis de la paix et de la sécurité mondiale.
Le désordre observé au Moyen-Orient a suscité de nombreuses inquiétudes, souvent en lien avec le concept de l'État et son rôle en tant qu'entité stabilisatrice. Lorsque l'État semble incapable de maintenir le contrôle et l'ordre, cela peut mener à une multitude de menaces et de risques. Dans le cas du Moyen-Orient, ces menaces sont diverses. Elles vont de l'instabilité sociale et économique à l'intérieur des pays, à l'augmentation des conflits sectaires et ethniques, en passant par le risque de terrorisme international. Ces conflits peuvent également entraîner des crises humanitaires, des déplacements massifs de populations et des problèmes de réfugiés à l'échelle mondiale. L'absence d'un contrôle étatique efficace peut également permettre à des acteurs non étatiques, tels que les groupes terroristes, de gagner en influence et en pouvoir. Par exemple, l'État islamique (EI) a pu émerger et prendre le contrôle de vastes territoires en Irak et en Syrie en profitant de la faiblesse des États locaux et du chaos ambiant. Cela illustre bien la complexité des enjeux liés à l'absence de contrôle étatique et à l'instabilité, et les défis qu'ils posent pour la sécurité internationale.
Notre conception du système international est fortement ancrée dans le concept de l'État. L'État est généralement considéré comme l'acteur principal en politique internationale, assurant la sécurité, l'ordre et la stabilité au sein de ses frontières. Lorsqu'un État s'effondre ou est incapable d'exercer efficacement son autorité, cela peut entraîner des conséquences déstabilisantes à la fois pour le pays concerné et pour la communauté internationale. L'effondrement d'un État peut générer un vide de pouvoir, créant ainsi un terrain propice à l'émergence de groupes armés non étatiques, de conflits internes et de violence généralisée. Cette situation peut également entraîner une crise humanitaire, avec des réfugiés fuyant la violence et la pauvreté, ce qui peut à son tour créer des tensions dans les pays voisins et au-delà. Par ailleurs, l'incapacité d'un État à contrôler son territoire peut également représenter une menace pour la sécurité internationale. Cela peut créer un espace où le terrorisme, la criminalité organisée et d'autres activités illicites peuvent prospérer, avec des conséquences potentiellement graves au-delà des frontières de l'État concerné. C'est pour ces raisons que l'effondrement des États est souvent perçu comme une source majeure d'instabilité et d'insécurité dans le système international. Il est donc crucial pour la communauté internationale de travailler ensemble pour prévenir l'effondrement des États et aider à rétablir la stabilité lorsque cela se produit.
Dans l'histoire des relations internationales, il y a eu des cas où des puissances étrangères ont soutenu des régimes autoritaires ou dictatoriaux dans le but de préserver la stabilité régionale, de contenir une idéologie concurrente, d'accéder à des ressources ou pour des raisons stratégiques. Cependant, cette pratique pose des problèmes éthiques significatifs et peut être en contradiction avec les principes démocratiques et les droits de l'homme que ces puissances étrangères prétendent souvent défendre. Dans le contexte de la politique internationale, le soutien à un régime autoritaire peut parfois refléter une préférence pour un État qui contrôle fermement son pays, même si cela se fait au détriment des droits de l'homme ou de la démocratie. C'est une tendance qui découle souvent d'une préoccupation pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. L'idée est que, bien que ces régimes puissent être répressifs et antidémocratiques, ils peuvent aussi assurer un certain degré de stabilité et de prévisibilité. Ils peuvent empêcher le chaos ou la violence qui pourrait autrement émerger en l'absence d'un contrôle étatique fort, et ils peuvent également servir de contrepoids à d'autres forces régionales ou internationales perçues comme une menace.
L'État-nation reste une structure fondamentale pour organiser et comprendre nos sociétés et le monde dans lequel nous vivons. C'est par l'État que nous définissons généralement notre identité nationale, c'est l'État qui représente les citoyens sur la scène internationale, et c'est à travers les États que nous structurons le plus souvent nos interactions et relations internationales. L'État-nation est aussi un outil clé pour maintenir l'ordre public, garantir les droits et libertés des citoyens, fournir des services publics essentiels et assurer la sécurité nationale. Il représente donc une certaine stabilité et prévisibilité dans un monde par ailleurs complexe et en constante évolution.
La notion de "guerre postmoderne" renvoie à une évolution fondamentale de l'art de la guerre, s'éloignant des paradigmes traditionnels liés à des États-nations en conflit pour des raisons politiques ou territoriales. Au cœur de la guerre postmoderne, nous observons une dépolitisation des conflits, où les motifs politiques ou le contrôle territorial sont remplacés par une multitude de facteurs tels que les différends ethniques, religieux, économiques ou environnementaux. Cette nouvelle ère de la guerre se caractérise également par une déterritorialisation, où les conflits ne sont plus restreints à des régions spécifiques mais peuvent devenir transnationaux ou globaux, à l'image du terrorisme international ou des cyberconflits. L'un des aspects les plus perturbants de la guerre postmoderne est la privatisation de la violence, où les acteurs non étatiques, tels que les groupes terroristes, les milices privées ou les organisations criminelles, jouent un rôle de plus en plus prééminent. Parallèlement, l'impact des conflits sur les civils s'est intensifié, avec des effets dévastateurs directs, tels que la violence, et indirects, tels que le déplacement de population, la famine ou la maladie.
Bien que les démocraties soient moins susceptibles d'entrer en guerre entre elles - un concept connu sous le nom de "paix démocratique" - elles continuent d'être impliquées dans des conflits militaires. Ces conflits impliquent souvent des pays non démocratiques ou s'inscrivent dans le cadre de missions internationales de maintien de la paix ou de la lutte contre le terrorisme. Les pays du Nord ont également tendance à utiliser des moyens autres que la guerre conventionnelle pour atteindre leurs objectifs de politique étrangère. Par exemple, ils peuvent utiliser la diplomatie, les sanctions économiques, l'aide au développement, et d'autres outils de "soft power" pour influencer les autres nations. De plus, la technologie a changé la nature de la guerre. Les pays du Nord, en particulier, ont tendance à dépendre fortement de la technologie avancée dans leur conduite de la guerre. L'usage des drones, des cyberattaques, et d'autres formes de guerre non conventionnelle est de plus en plus courant. En fin de compte, bien que la nature et la conduite de la guerre puissent changer, le recours à la force militaire reste malheureusement une caractéristique de la politique internationale. Il est donc crucial de continuer à chercher des moyens de prévenir les conflits et de promouvoir la paix et la sécurité mondiales.
Vers une Guerre Postmoderne
Les modes de guerre ont changé de façon significative, surtout pour les pays occidentaux. Cette évolution s'est principalement matérialisée par un plus grand recours à la technologie, une professionnalisation accrue des armées et une aversion grandissante pour les pertes humaines, souvent appelée "allergie au risque". Le concept du "Western Way of War" met l'accent sur la préférence pour la technologie avancée et la supériorité aérienne dans la conduite de la guerre. La technologie est devenue un élément clé de la conduite de la guerre, avec le développement d'armes toujours plus sophistiquées, l'utilisation de drones, et l'importance croissante de la cyberguerre. En outre, la professionnalisation accrue des armées s'est traduite par une formation plus poussée et une spécialisation accrue des militaires. Les armées de métier sont de plus en plus courantes, et les conscriptions ou les drafts sont de moins en moins fréquents dans les pays occidentaux. L' "allergie au risque" a été exacerbée par le fait que les sociétés occidentales ont de plus en plus de mal à accepter les pertes humaines en temps de guerre. Cela a conduit à une préférence pour les frappes aériennes et l'utilisation de drones, qui permettent de mener des opérations militaires sans mettre en danger les vies des soldats.
A l'époque actuelle, il y a une nette diminution de l'acceptation sociale de la perte de vies humaines dans les guerres menées à l'étranger. Les populations sont de moins en moins disposées à soutenir des conflits qui entraînent des pertes de vies, notamment de leurs propres citoyens. Cette situation est en partie alimentée par une couverture médiatique omniprésente et instantanée des conflits, qui rend les coûts humains de la guerre plus visibles et plus réels pour la population générale. En même temps, les avancées technologiques ont permis de mener des guerres de manière plus éloignée. L'utilisation de drones, de missiles de précision et d'autres technologies de pointe permet de mener des attaques à distance, sans risque direct pour les troupes sur le terrain. Cette forme de guerre technologique est en grande partie le fruit des développements technologiques facilités par les États.
L'utilisation des drones dans les conflits modernes a radicalement changé la nature de la guerre. Le pilotage de drones permet de mener des opérations militaires, y compris des frappes meurtrières, depuis des milliers de kilomètres. Le personnel qui contrôle ces drones le fait souvent depuis des bases situées en dehors du champ de bataille, parfois même dans un autre pays. Cela soulève un certain nombre de questions éthiques et morales. D'une part, cela permet de minimiser le risque pour les forces militaires qui contrôlent ces drones. D'autre part, cela peut créer une déconnexion entre l'acte de tuer et la réalité de la guerre, qui peut à son tour entraîner des conséquences psychologiques pour les opérateurs de drones. En outre, cela peut rendre la prise de décision sur l'usage de la force moins immédiate et moins personnelle, ce qui peut potentiellement abaisser le seuil de l'utilisation de la force. Par ailleurs, l'utilisation des drones a également des implications stratégiques. Il permet de mener des frappes précises avec un risque minimal pour les forces militaires, mais il peut également conduire à des pertes civiles et à des dommages collatéraux. L'utilisation de drones soulève donc des questions importantes en matière de droit international humanitaire et de responsabilité.
La question est de savoir si cette mise à distance change la nature de la guerre, est-ce que cela est une évolution, une révolution des affaires militaires avec le concept de guerre « zéro mort », doit-on dépasser Clausewitz lorsqu’on parle de Mary Kaldor par exemple. La mise à distance de la guerre grâce à la technologie, notamment les drones, soulève la question de savoir si la nature même de la guerre est en train de changer. La possibilité de mener des opérations militaires sans mettre directement en danger la vie de ses propres soldats modifie indéniablement l'expérience de la guerre et peut influencer la prise de décisions concernant l'usage de la force. Le concept de "guerre zéro mort" peut certes sembler attrayant du point de vue de ceux qui mènent la guerre, mais il ne doit pas faire oublier que même une guerre menée à distance peut avoir des conséquences dévastatrices pour les civils et entraîner des pertes de vies humaines. La question de savoir si nous devons "dépasser Clausewitz" est un sujet de débat parmi les théoriciens militaires. Clausewitz a soutenu que la guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Même si la technologie a changé la façon dont la guerre est menée, il peut être argumenté que l'objectif ultime reste le même : atteindre des objectifs politiques. Dans cette perspective, la pensée de Clausewitz reste toujours pertinente. Cela dit, les travaux de chercheurs comme Mary Kaldor ont souligné que les formes contemporaines de violence organisée peuvent différer des modèles traditionnels de guerre envisagés par Clausewitz. Les "nouvelles guerres", selon Kaldor, se caractérisent par des violences intra-étatiques, l'implication d'acteurs non étatiques, et l'importance croissante des identités plutôt que des idéologies. Ces transformations pourraient nous pousser à repenser certaines des théories classiques de la guerre.
La guerre est-elle vraiment en train de se transformer ? Est-ce quelque chose qui se dépolitise de plus en plus dans les pays du Sud et qui est quelque chose en fin de compte d’éminemment technologique où il n’y a plus aucun rapport avec ce qui se passe sur le terrain ? La perception de la guerre comme quelque chose de distant et technologique, particulièrement en Occident, peut être un phénomène croissant. Cependant, affirmer que la guerre est en train de se "dépolitiser" nécessite une analyse plus nuancée.
Dans les pays du Sud, bien qu'il y ait une augmentation des conflits intra-étatiques et de la violence perpétrée par des acteurs non-étatiques, ces conflits restent profondément politiques. Ils peuvent être liés à des luttes pour le contrôle des ressources, des différences ethniques ou religieuses, des aspirations à l'autodétermination, ou des réactions à la corruption et à la mauvaise gouvernance. De plus, la violence organisée peut avoir des implications politiques majeures, influençant les structures de pouvoir, modifiant les relations entre les groupes et façonnant l'avenir politique d'un pays. Dans les pays du Nord, l'utilisation de technologies telles que les drones peut donner l'impression d'une "déshumanisation" de la guerre, où les actes de violence sont commis à distance et de manière apparemment détachée. Cependant, cette approche de la guerre peut avoir ses propres implications politiques. Par exemple, la facilité apparente avec laquelle la violence peut être infligée à distance peut influencer les décisions sur quand et comment utiliser la force. De plus, la manière dont ces technologies sont utilisées et réglementées peut susciter des débats politiques importants. Il est donc crucial de comprendre que même si la nature et la conduite de la guerre peuvent évoluer, la guerre reste une entreprise profondément politique, et ses conséquences se font ressentir bien au-delà du champ de bataille.
On parle de toutes ces guerres que nous voyons à travers les écrans avec par exemple la Guerre du Golf dans les années 1990 qui parait éloignées parce qu’on ne l’expérimente même plus au travers de nos familles ou de nos propres expériences. La Guerre du Golfe dans les années 1990 a marqué un tournant dans la manière dont la guerre est perçue par le public. Cette guerre a été largement médiatisée, avec des images de la guerre diffusées en direct à la télévision. Cela a contribué à créer une certaine distance entre le public et le conflit réel. En regardant la guerre à travers l'écran de la télévision, elle peut sembler lointaine et déconnectée de notre quotidien. Cette distance peut également être accentuée par le fait que de moins en moins de personnes dans les pays occidentaux ont une expérience directe du service militaire. Alors que le service militaire était autrefois une expérience commune pour de nombreux hommes (et certaines femmes), de nombreux pays ont aujourd'hui des armées entièrement professionnelles. Cela signifie que la guerre est vécue directement par un plus petit pourcentage de la population. Bien que la guerre puisse sembler lointaine pour de nombreuses personnes dans les pays occidentaux, elle a des conséquences très réelles pour ceux qui y sont directement impliqués, que ce soit les militaires déployés en zones de conflit ou les populations locales touchées. De plus, même si un conflit peut sembler éloigné géographiquement, il peut avoir des conséquences indirectes à travers des phénomènes tels que les flux de réfugiés, les impacts économiques ou les menaces pour la sécurité internationale.
Anhänge
- Leander, Anna. Wars and the Un-Making of States: Taking Tilly Seriously in the Contemporary World
- Goldstone , Jack A. States Making Wars Making States Making Wars... in Contemporary Sociology, Vol. 20, No. 2 (Mar., 1991), pp. 176-178. Url: https://www.jstor.org/stable/pdf/2072886.pdf?acceptTC=true
- Kaldor, Mary. New & Old Wars. Stanford, CA: Stanford UP, 2007. Print.
- La naissance de la guerre moderne : war-making et state-making dans une perspective occidentale
- Tilly, Charles. War Making and State Making as Organized Crime. url: http://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/q3/28/02/reading_response_4_2.pdf
- NATO StratCom COE; Mark Laity. (2018, August 10). What is War?. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Gj-wsdGL4-M