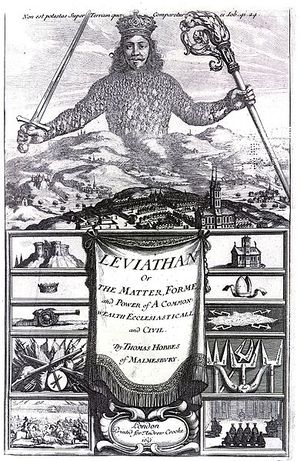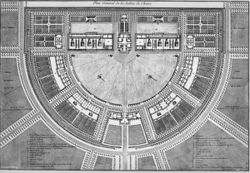Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen
Das soziale Denken von Émile Durkheim und Pierre Bourdieu ● Zu den Ursprüngen des Untergangs der Weimarer Republik ● Das soziale Denken von Max Weber und Vilfredo Pareto ● Der Begriff des "Konzepts" in den Sozialwissenschaften ● Geschichte der Disziplin Politikwissenschaft: Theorien und Konzepte ● Marxismus und Strukturalismus ● Funktionalismus und Systemismus ● Interaktionismus und Konstruktivismus ● Die Theorien der politischen Anthropologie ● Die Debatte der drei I: Interessen, Institutionen und Ideen ● Die Theorie der rationalen Wahl und die Interessenanalyse in der Politikwissenschaft ● Analytischer Ansatz der Institutionen in der Politikwissenschaft ● Die Untersuchung von Ideen und Ideologien in der Politikwissenschaft ● Theorien des Krieges in der Politikwissenschaft ● Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen ● Die Staatsraison ● Staat, Souveränität, Globalisierung, Multi-Level-Governance ● Gewalttheorien in der Politikwissenschaft ● Welfare State und Biomacht ● Analyse demokratischer Regime und Demokratisierungsprozesse ● Wahlsysteme: Mechanismen, Herausforderungen und Konsequenzen ● Das Regierungssystem der Demokratien ● Morphologie der Anfechtungen ● Handlung in der politischen Theorie ● Einführung in die Schweizer Politik ● Einführung in das politische Verhalten ● Analyse der öffentlichen Politik: Definition und Zyklus einer öffentlichen Politik ● Analyse der öffentlichen Politik: Agendasetzung und Formulierung ● Analyse der öffentlichen Politik: Umsetzung und Bewertung ● Einführung in die Unterdisziplin Internationale Beziehungen ● Einführung in die politische Theorie
Krieg ist ein komplexes Phänomen, das im Laufe der Geschichte viele verschiedene Auffassungen und Entwicklungen durchlaufen hat. Verschiedene Epochen und Gesellschaften hatten unterschiedliche Perspektiven auf den Krieg, und diese Auffassungen haben sich als Reaktion auf politische, wirtschaftliche, technologische und soziale Veränderungen weiterentwickelt.
Krieg ist ein bewaffneter Konflikt zwischen Staaten oder Gruppen, der oft durch extreme Gewalt, soziale Störungen und wirtschaftliche Unterbrechungen gekennzeichnet ist. Er beinhaltet in der Regel den Einsatz und die Verwendung von militärischen Kräften und die Anwendung von Strategien und Taktiken, um den Gegner zu besiegen. Krieg kann viele Ursachen haben, u. a. territoriale, politische, wirtschaftliche oder ideologische Meinungsverschiedenheiten. Es wird allgemein angenommen, dass der moderne Krieg mit der Entstehung des Nationalstaats im 17. Der Westfälische Friedensvertrag von 1648 markierte das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Europa und etablierte das Konzept der nationalen Souveränität. Dadurch wurde ein internationales System geschaffen, das auf unabhängigen Nationalstaaten beruhte, die rechtmäßig auf Krieg zurückgreifen konnten. Die Vergrößerung der Armeen, die Verbesserung der Militärtechnologie und die Entwicklung von Taktiken und Strategien trugen ebenfalls zur Entstehung des modernen Krieges bei. Im Zeitalter des Terrorismus und der Globalisierung verändert sich das Wesen des Krieges. Wir sind nun mit asymmetrischen Konflikten konfrontiert, in denen nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus hat der Aufstieg der Kybernetik zur Entstehung des Cyberkriegs geführt. Schließlich ist der Informationskrieg, bei dem Informationen zur Manipulation oder Täuschung der öffentlichen Meinung oder des Gegners eingesetzt werden, zu einer gängigen Taktik geworden.
Die Vorstellung vom Ende des Krieges ist umstritten. Einige argumentieren, dass die Globalisierung, die wirtschaftliche Interdependenz und die Verbreitung demokratischer Werte den Krieg weniger wahrscheinlich gemacht haben. Andere argumentieren, dass der Krieg nicht so schnell verschwinden wird, und verweisen auf die Existenz laufender bewaffneter Konflikte, anhaltende internationale Spannungen und die Möglichkeit künftiger Konflikte um begrenzte Ressourcen oder aufgrund von Klimainstabilität. Hinzu kommt, dass traditionelle Konflikte zwischen Staaten zwar möglicherweise abnehmen, neue Formen von Konflikten wie Terrorismus oder Kybernetik jedoch fortbestehen. Die Zukunft des Krieges ist ungewiss, aber sicher ist, dass die Fortsetzung von Diplomatie, Dialog und Abrüstung entscheidend ist, um Krieg zu verhindern und einen dauerhaften Frieden zu fördern.
Zunächst werden wir die grundlegende Natur des Krieges erforschen, bevor wir uns mit der Entstehung des modernen Krieges beschäftigen. Wir werden feststellen, dass Krieg über bloße Gewalt hinausgeht und als regulierendes Element in unserem seit Jahrhunderten geformten internationalen System fungiert. Anschließend untersuchen wir die zeitgenössischen Entwicklungen des Krieges, insbesondere im Zusammenhang mit Terrorismus und Globalisierung, und fragen uns, ob sich das Wesen des Krieges wandelt und ob sich seine Grundprinzipien weiterentwickeln. Abschließend werden wir uns die Frage nach der Zukunft des Krieges stellen: Sind wir Zeugen seines Endes oder besteht er in anderen Formen fort?
Was ist Krieg?[modifier | modifier le wikicode]
Definition von Krieg[modifier | modifier le wikicode]
Wir werden uns fragen, was Krieg ist, und uns mit den Warnungen und Missverständnissen über den Krieg auseinandersetzen. Es gibt sehr viele Definitionen des Begriffs Krieg, aber eine der treffendsten ist die von Hedley Bull, dem Begründer der englischen Schule, der in seinem 1977 erschienenen Buch The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics folgende Definition gibt: "an organized violence carried on by political units against each other" (eine organisierte Gewalttätigkeit von politischen Einheiten gegeneinander).
Hedley Bulls Definition von Krieg hebt mehrere Schlüsselaspekte dieses komplexen Phänomens hervor.
1. "Organisierte Gewalt": Die Verwendung dieses Satzes legt nahe, dass Krieg keine zufällige oder chaotische Folge von Gewaltakten ist. Sie ist organisiert und geplant, oftmals in sehr detaillierter Weise. Diese Organisation kann die Mobilisierung von Truppen, die Entwicklung von Strategien und Taktiken, die Produktion und Beschaffung von Waffen und viele andere logistische Aspekte beinhalten. Die betreffende Gewalt ist ebenfalls extrem und beinhaltet in der Regel Tod und schwere Verletzungen, Zerstörung von Eigentum und soziale Instabilität.
2. "Von politischen Einheiten geführt": Hier betont Bull, dass der Krieg eine Handlung ist, die von politischen Akteuren begangen wird - typischerweise von Nationalstaaten, aber potenziell auch von nichtstaatlichen Gruppen mit einer politischen Organisation. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass Krieg oft das Produkt politischer Entscheidungen ist und eingesetzt wird, um politische Ziele zu erreichen. Dazu können Ziele wie die Eroberung von Territorium, ein Regimewechsel, die Behauptung nationaler Macht oder die Verteidigung gegen eine wahrgenommene Bedrohung gehören.
3. "Gegeneinander": Dieser Teil der Definition betont, dass Krieg einen Konflikt beinhaltet. Es handelt sich nicht um einseitige Gewaltakte, sondern um eine Situation, in der sich mehrere Parteien aktiv gegeneinander stellen. Dies impliziert eine interaktive Dynamik, bei der die Handlungen jeder Partei die Handlungen der anderen beeinflusst, wodurch ein Kreislauf der Gewalt entsteht, der schwer zu durchbrechen sein kann.
Diese Definition ist zwar einfach, umfasst also viele Aspekte des Krieges. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Krieg ein komplexes Phänomen ist, das nicht vollständig durch eine einzige Definition verstanden oder erklärt werden kann. Auch viele andere Perspektiven und Theorien können wertvolle Informationen über das Wesen des Krieges, seinen Ursprung, seinen Verlauf und seine Folgen liefern.
Die Unterscheidung zwischen zwischen zwischenmenschlicher Gewalt, wie Kriminalität und Aggressionen, und Krieg als organisierte Gewalt, die von politischen Einheiten ausgeübt wird, ist von entscheidender Bedeutung :
- Zwischenmenschliche Gewalt: Diese bezieht sich auf Gewalttaten von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen, die häufig im Zusammenhang mit Verbrechen wie Diebstahl, Körperverletzung, Mord usw. begangen werden. Sie wird in der Regel nicht in großem Umfang koordiniert oder organisiert und dient nicht der Erreichung politischer Ziele. Die Motive können vielfältig sein und von persönlichen Konflikten bis hin zum Streben nach materiellen Gewinnen reichen.
- Krieg: Im Gegensatz zu zwischenmenschlicher Gewalt ist Krieg eine groß angelegte Form der Gewalt, die von politischen Einheiten, in der Regel Nationalstaaten oder strukturierten politischen Gruppen, sorgfältig organisiert und geplant wird. Im Krieg sollen bestimmte, oftmals politische Ziele durch den Einsatz von Gewalt erreicht werden. Die Kämpfer sind in der Regel ausgebildete und ausgerüstete Soldaten oder Militante, und die Konflikte werden oft nach bestimmten Regeln oder Konventionen ausgetragen.
Der von Hedley Bull angesprochene Punkt des offiziellen Charakters des Krieges ist ein entscheidendes Element, um sein Wesen zu verstehen. Seiner Meinung nach wird der Krieg von politischen Einheiten, in der Regel Staaten, geführt und findet gegen andere politische Einheiten statt. Er ist eine Handlung, die offiziell sanktioniert und im Namen des Staates geführt wird. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie den Begriff des Krieges von dem der Verbrechensbekämpfung trennt, die ebenfalls eine Form der organisierten Gewalt ist, aber in einem anderen Rahmen operiert. Während Krieg in der Regel ein Konflikt zwischen Staaten oder politischen Gruppen ist, handelt es sich bei der Verbrechensbekämpfung um Maßnahmen, die der Staat innerhalb seiner eigenen Grenzen ergreift, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Die Verbrechensbekämpfung wird in der Regel von Ordnungskräften wie der Polizei durchgeführt, deren Aufgabe es ist, Verbrechen zu verhindern und zu unterdrücken. Sie dient nicht dazu, politische oder strategische Ziele zu erreichen, wie es bei einem Krieg der Fall ist, sondern vielmehr dazu, die Bürger zu schützen und das Gesetz durchzusetzen. Diese Differenzierung unterstreicht den Ausnahmecharakter des Krieges als Akt organisierter Gewalt, der politische Grenzen überschreitet, im Gegensatz zu innerstaatlicher Gewalt steht und von einem Staat oder einer politischen Einheit sanktioniert wird. Krieg ist seinem Wesen nach ein politisches Phänomen, das auf die Veränderung des Status quo abzielt, häufig durch den Einsatz von Waffengewalt, und stellt daher eine eigene Dimension der Gewalt in der Gesellschaft dar.
Die von Hedley Bull formulierte Definition des Krieges ist recht umfassend und präzise. Sie beschreibt das Wesen des modernen Krieges gut, indem sie seine Schlüsselaspekte hervorhebt: Er ist organisierte Gewalt, die von politischen Einheiten untereinander ausgeübt wird und in der Regel außerhalb dieser politischen Einheiten gerichtet ist. Diese Definition deckt gut ab, was viele Menschen unter "Krieg" verstehen, auch diejenigen, die ihn in einem akademischen oder militärischen Rahmen untersuchen. Sie erfasst die Vorstellung, dass Krieg ein strukturiertes Phänomen ist, mit bestimmten Akteuren (politischen Einheiten), einem offiziellen Charakter und einer externen Ausrichtung. Diese Definition dient auch als Grundlage, um die Komplexität moderner Konflikte zu verstehen, bei denen die Grenzen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren verschwimmen können und Konflikte internationale Akteure einbeziehen und nationale Grenzen überschreiten können.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass diese Definition zwar nützlich ist, aber nur eine von vielen möglichen Arten ist, Krieg zu definieren und zu verstehen. Andere Perspektiven können den Schwerpunkt auf andere Aspekte des Krieges legen, wie z. B. seine soziale, wirtschaftliche oder psychologische Dimension. Wie bei jedem komplexen Phänomen erfordert ein umfassendes Verständnis des Krieges einen mehrdimensionalen Ansatz, der seine zahlreichen Facetten und Auswirkungen berücksichtigt.
Dekonstruieren von Vorurteilen[modifier | modifier le wikicode]
Krieg als Konzept ist durch die Geschichte, die Medien, die Literatur und andere Formen der kulturellen Kommunikation in unser kollektives Bewusstsein eingedrungen. Unsere intuitiven Wahrnehmungen des Krieges können jedoch von vorgefassten Meinungen geprägt sein, die nicht unbedingt die Komplexität der Realität widerspiegeln.
L'approche de Thomas Hobbes : « la guerre de tous contre tous »[modifier | modifier le wikicode]
Für Thomas Hobbes in seinem 1651 veröffentlichten Buch Der Leviathan ist Krieg "der Krieg aller gegen alle". In diesem Buch beschreibt Hobbes den Naturzustand, einen hypothetischen Zustand, in dem es keine Regierung oder zentrale Autorität gibt, die die Ordnung durchsetzt. Er definiert den Naturzustand als einen "Krieg aller gegen alle" (lateinisch bellum omnium contra omnes), in dem die Individuen in ständiger Konkurrenz zueinander um das Überleben und die Ressourcen stehen. Hobbes zufolge würden die Menschen ohne eine zentrale Autorität, die für Ordnung sorgt, ständig miteinander in Konflikt geraten, was zu einem Leben führen würde, das "einsam, arm, unangenehm, brutal und kurz" wäre. Aus diesem Grund seien die Menschen bereit, einen Teil ihrer Freiheit zugunsten einer Regierung oder eines Herrschers (des Leviathan) aufzugeben, der in der Lage sei, Frieden und Ordnung zu erzwingen.
In "Der Leviathan" argumentiert Hobbes, dass sich das Leben der Individuen ohne einen Staat oder eine zentrale Autorität in einem ständigen Zustand des "Krieges aller gegen alle" befinden würde. Dies ist laut Hobbes die Anarchie, die in Abwesenheit des Staates herrscht. Anarchie bedeutet in diesem Zusammenhang nicht unbedingt Chaos oder Desorganisation, sondern vielmehr das Fehlen einer zentralen Autorität, die Regeln und Verhaltensnormen durchsetzt. Für Hobbes ist der Staat daher ein notwendiges Instrument, um die interindividuellen Beziehungen zu regulieren, Konflikte zu verhindern und die Sicherheit der Individuen zu gewährleisten. Die Individuen sind Hobbes zufolge bereit, einen Teil ihrer Freiheit aufzugeben, um im Gegenzug die Sicherheit und Stabilität zu erhalten, die der Staat ihnen bieten kann.
In Wirklichkeit neigen die Menschen selbst in Situationen extremer sozialer oder politischer Instabilität dazu, Strukturen und Organisationen zu bilden, um die Ordnung zu wahren und das Überleben zu erleichtern. Ein ewiger Krieg, wie ihn Hobbes im Naturzustand beschreibt, ist aus empirischer Sicht praktisch unmöglich. Darüber hinaus erfordert die Führung eines Krieges ein Maß an Organisation und Koordination, das Individuen im Zustand der Anarchie nur schwer erreichen könnten. Individuen schließen sich eher zu ihrer eigenen Verteidigung oder zur Erreichung gemeinsamer Ziele zusammen, was an sich schon als eine primitive Form des Staates oder der Staatsführung angesehen werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass Hobbes den Naturzustand und den "Krieg aller gegen alle" als begriffliche Werkzeuge verwendet, um für die Bedeutung des Staates und des Gesellschaftsvertrags zu argumentieren. Er legt nicht unbedingt nahe, dass dieser Naturzustand jemals wortwörtlich existiert hat.
Bewaffnete Konflikte, insbesondere solche, die auf die Ebene des Krieges aufsteigen, beinhalten weitaus komplexere Dynamiken als einfache Aggressionen oder individuelle Konflikte. Sie erfordern eine bedeutende Organisation, strategische Planung und erhebliche Ressourcen.
An Kriegen sind in der Regel politische Akteure beteiligt - Staaten oder Gruppen, die versuchen, bestimmte politische Ziele zu erreichen. Somit ist Krieg nicht nur eine Ausweitung individueller Aggression oder Egoismus, sondern auch stark mit Politik, Ideologie und Machtstrukturen verbunden. Darüber hinaus haben Kriege oft weitreichende soziale und politische Folgen. Sie können Grenzen umgestalten, Regierungen stürzen, große gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen und nachhaltige Auswirkungen auf Einzelpersonen und Gemeinschaften haben. Aus diesem Grund erfordert das Studium des Krieges ein umfassendes Verständnis vieler verschiedener Aspekte der menschlichen Gesellschaft, einschließlich Politik, Psychologie, Wirtschaft, Technologie und Geschichte.
Hobbes' Vision vom "Krieg aller gegen alle" konzentriert sich auf Egoismus und Konflikt als inhärente Aspekte der menschlichen Natur. Der Krieg, wie wir ihn kennen, ist jedoch nicht einfach das Produkt von Egoismus oder individueller Aggression. Er ist vielmehr eine komplexe soziale Schöpfung, die eine substanzielle Organisation und Koordination erfordert. Der Gedanke, dass der Krieg tatsächlich ein Produkt unserer Sozialität und nicht unseres Egoismus ist, ist sehr erhellend. Um einen Krieg zu führen, braucht man nicht nur Ressourcen, sondern auch eine Organisationsstruktur, um die Anstrengungen zu koordinieren, eine Ideologie oder ein Ziel, um die Teilnehmer zu vereinen, und Normen oder Regeln, um das Verhalten zu regulieren. All diese Elemente sind ein Produkt des gesellschaftlichen Lebens. Diese Perspektive legt nahe, dass wir, um den Krieg zu verstehen, über bloße Instinkte oder individuelles Verhalten hinausblicken und die sozialen, politischen und kulturellen Strukturen betrachten müssen, die den bewaffneten Konflikt ermöglichen und prägen. Sie betont auch, dass die Verhinderung von Kriegen eine besondere Aufmerksamkeit für diese Strukturen und nicht nur für die menschliche Natur erfordert.
Obwohl Hobbes' Theorie des "Krieges aller gegen alle" nahelegt, dass der Krieg in der egoistischen Natur des Einzelnen verwurzelt ist, ist die Realität viel komplexer. Krieg erfordert ein gewisses Maß an Organisation, Planung und Koordination, die alle eher Merkmale menschlicher Gesellschaften als isolierter Individuen sind. Daher kann Krieg besser als ein soziales Phänomen verstanden werden und nicht nur als eine Erweiterung des Egoismus oder der Aggression des Einzelnen. Krieg wird häufig von einer Vielzahl sozialer Strukturen und Prozesse beeinflusst und hat wiederum Einfluss auf diese, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und soziale Normen und Werte. Bewaffnete Konflikte entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind tief in den spezifischen sozialen und historischen Kontexten verwurzelt.
Krieg ist weit mehr als eine bloße Manifestation menschlicher Aggression oder Selbstsucht. Er ist vielmehr das Ergebnis eines breiten Spektrums an sozialen und organisatorischen Faktoren, die einen groß angelegten Konflikt ermöglichen, erleichtern und motivieren. Um einen Krieg zu entfachen, bedarf es weit mehr als nur des Willens oder des Wunsches zu kämpfen. Es bedarf organisatorischer Strukturen, die in der Lage sind, Ressourcen zu mobilisieren, Strategien zu koordinieren und Streitkräfte zu führen. Zu diesen Strukturen gehören unter anderem bürokratische Verwaltungen, militärische Befehlsketten und logistische Unterstützungssysteme. Diese Organisationen können nicht ohne den sozialen Rahmen existieren, der sie unterstützt. Darüber hinaus bedarf es auch einer bestimmten Art von Kultur und Ideologie, die den Krieg rechtfertigt und aufwertet. Soziale Überzeugungen, Werte und Normen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung und Aufrechterhaltung dieser Organisationen sowie bei der Motivation des Einzelnen, sich am Krieg zu beteiligen. Somit ist der Krieg ein zutiefst soziales und strukturelles Phänomen. Er ist das Produkt unserer Fähigkeit, in einer Gesellschaft zusammenzuleben, und nicht unseres Egoismus oder unserer individuellen Aggression. Diese Perspektive kann wichtige Ansatzpunkte für die Konfliktprävention und Friedensförderung bieten.
Heraklits Ansatz: Der Krieg ist der Vater aller Dinge, und von allen Dingen ist er König[modifier | modifier le wikicode]
Wir haben gerade gesehen, wie man Krieg führt und ihn ermöglicht, nun wollen wir uns mit dem zweiten Mythos mit dem "Wann" beschäftigen. Der zweite Mythos ist der des ewigen Krieges von Heraklit, der postuliert: "Der Krieg ist der Vater aller Dinge, und von allen Dingen ist er König". Diese Ansicht vereinfacht die Realität jedoch zu sehr.
Der Krieg, wie wir ihn heute kennen, ist ein spezifisches Phänomen, das ein gewisses Maß an sozialer und organisatorischer Struktur erfordert, wie wir zuvor erörtert haben. Mit anderen Worten: Krieg ist nicht einfach eine Manifestation menschlicher Gewalt, sondern vielmehr eine organisierte und strukturierte Form des Konflikts, die sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von sozialen, politischen, wirtschaftlichen und technologischen Faktoren entwickelt hat. Das Vorhandensein von organisierter Gewalt ist kein universelles Merkmal aller menschlichen Gesellschaften im Laufe der Geschichte. Einige Gesellschaften erlebten längere Zeiträume des Friedens, während andere ein höheres Maß an Gewalt und Konflikten aufwiesen. Darüber hinaus hat sich auch das Wesen des Krieges selbst im Laufe der Zeit erheblich verändert. Die Kriege der Antike beispielsweise unterschieden sich in Bezug auf Strategie, Technologie, Taktik und Folgen erheblich von den modernen Kriegen.
Wenn man einen etwas soziologischeren Blick hat, könnte man sagen, dass Krieg ein relativ junges Phänomen in der menschlichen Geschichte ist, zumindest ist es ein Merkmal, das nicht zeitlos ist. Archäologische und anthropologische Beweise deuten darauf hin, dass der Krieg, so wie wir ihn heute als organisierten Großkonflikt zwischen politischen Einheiten verstehen, ein relativ junges Phänomen in der Menschheitsgeschichte ist. Erst mit der Entstehung komplexerer und hierarchischerer Gesellschaften, die oft mit Sesshaftigkeit und Landwirtschaft einherging, beginnen wir, klare Anzeichen für organisierten Krieg zu sehen. Davor gab es zwar sicherlich zwischenmenschliche Gewalt und kleinere Konflikte, aber keine überzeugenden Beweise für groß angelegte Konflikte, die eine komplexe Koordination und politische Ziele beinhalten. Das bedeutet nicht, dass die menschlichen Gesellschaften friedlich oder gewaltfrei waren, sondern vielmehr, dass die Art dieser Gewalt anders war und nicht dem entsprach, was wir üblicherweise als "Krieg" bezeichnen.
Die Vorstellung, dass der Krieg in der Geschichte der Menschheit ein neues Phänomen ist, wird durch zahlreiche Forschungsergebnisse aus der Anthropologie und Archäologie gestützt. Vor dem Aufkommen der Landwirtschaft während der neolithischen Revolution, die auf etwa 7000 v. Chr. datiert wird, lebten die Menschen in der Regel in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern. Diese Gruppen hatten zwar Konflikte, aber diese waren in der Regel klein und ähnelten nicht den organisierten Kriegen, die wir heute kennen. Man kann nicht wirklich von Krieg sprechen. Krieg, wie wir ihn heute definieren, erfordert eine gewisse soziale Organisation und Arbeitsspezialisierung, einschließlich der Bildung von Gruppen, die sich den Kämpfen widmen. Außerdem beinhaltet Krieg oft Konflikte um die Kontrolle von Ressourcen, was mit dem Aufkommen der Landwirtschaft und der Sesshaftigkeit der Menschen relevanter wird, als die Ressourcen lokalisierter und begrenzter werden. Aus diesem Grund sind sich die meisten Forscher einig, dass es Krieg als strukturiertes und organisiertes Phänomen wahrscheinlich erst seit der neolithischen Revolution vor etwa 10.000 Jahren gibt. Das bedeutet, dass es während des größten Teils der Menschheitsgeschichte den Krieg, wie wir ihn kennen, nicht gab, was die Vorstellung in Frage stellt, dass er ein natürlicher und unvermeidlicher Aspekt der menschlichen Gesellschaft ist. Wenn man also davon ausgeht, dass der Mensch vor 200.000 Jahren entstanden ist, würde der Krieg also nur 5% unserer Geschichte betreffen. Wir sind weit entfernt von einem ahistorischen und universellen Phänomen, das es schon immer gegeben hätte.
Es ist wichtig zu vermeiden, den Krieg als etwas zu essentialisieren, das in uns steckt. Wenn wir uns die Tatsachen empirisch ansehen, hat es Krieg nicht immer gegeben und er ist mit einer entwickelten sozialen Organisation verbunden. Diese Form der sozialen Organisation trat ab der Jungsteinzeit auf und fiel mit einer funktionalen Spezialisierung zusammen, nämlich mit dem Aufkommen der ersten Städte. Somit ist der Krieg als organisiertes und institutionalisiertes Phänomen intrinsisch mit der Entstehung komplexerer Gesellschaften verbunden, insbesondere mit der Entstehung der ersten Städte. Das Leben in der Stadt führte zu einer viel stärkeren Arbeitsteilung, bei der sich Individuen auf bestimmte Berufe spezialisierten, von denen einige mit Verteidigung und Krieg zu tun hatten. In Jäger- und Sammlergesellschaften gab es oft eine Arbeitsteilung auf der Grundlage von Geschlecht und Alter, aber die Vielfalt der Rollen war im Allgemeinen begrenzt im Vergleich zu dem, was man in komplexeren landwirtschaftlichen Gesellschaften sieht. Mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der ersten Städte wurde die Arbeitsteilung erheblich ausgeweitet, was die Bildung von Klassen spezialisierter Krieger ermöglichte. Dies fiel auch mit der Entstehung der ersten Staaten zusammen, die über die Ressourcen und die Organisation verfügten, um groß angelegte Kriege zu führen. In dieser Zeit entstanden Formen organisierter und lang anhaltender Gewalt, die wir als Kriege erkennen.
Dies ist ein Gedanke, der ziemlich grundlegend für die Idee des Staatsaufbaus und die Entwicklung unserer Gesellschaften ist. Die Fähigkeit, Kriege zu organisieren und zu führen, ist zu einem Schlüsselelement bei der Bildung von Staaten geworden. In vielen Fällen hat die Androhung von Gewalt oder Krieg dazu beigetragen, verschiedene Gruppen unter einer zentralen Autorität zu vereinen, was zur Gründung von Nationalstaaten führte. Dies spiegelt sich in Hobbes' Theorie des Gesellschaftsvertrags wider, in der er postuliert, dass die Menschen im Austausch für Sicherheit und Ordnung bereit sind, auf bestimmte Freiheiten zu verzichten und einer höchsten Instanz (dem Staat) Autorität zu verleihen. In diesem Sinne kann der Krieg (oder die Kriegsgefahr) als Katalysator für die Bildung von Staaten dienen. Darüber hinaus ist die Verwaltung des Krieges durch die Aufstellung von Armeen, die Verteidigung des Territoriums, die Durchsetzung des Völkerrechts und die Diplomatie zu einem wesentlichen Teil der Verantwortlichkeiten moderner Staaten geworden. Dies zeigt sich in der Entwicklung dedizierter Bürokratien, von Steuersystemen zur Finanzierung militärischer Anstrengungen und einer Innen- und Außenpolitik, die sich auf Militär- und Sicherheitsfragen konzentriert. So sind Krieg und Staatsbildung zutiefst miteinander verbunden, wobei jede die andere im Laufe der Menschheitsgeschichte beeinflusst und gestaltet.
Die berufliche Spezialisierung war ein Schlüsselfaktor in der Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Dies wird als Arbeitsteilung bezeichnet, ein Konzept, das von Denkern wie Adam Smith und Emile Durkheim umfassend erforscht wurde. Die Arbeitsteilung kann als ein Prozess beschrieben werden, bei dem die Aufgaben, die für das Überleben und Funktionieren einer Gesellschaft notwendig sind, unter ihren Mitgliedern aufgeteilt werden. Zum Beispiel können sich einige Menschen auf die Landwirtschaft spezialisieren, während andere sich auf das Bauwesen, den Handel, das Bildungswesen oder die Sicherheit spezialisieren. Diese Spezialisierung ermöglicht es jedem Einzelnen, rollenspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, was in der Regel die Effizienz und Produktivität der Gesellschaft als Ganzes erhöht. Im Gegenzug sind die Individuen voneinander abhängig, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, wodurch ein komplexes Netz gegenseitiger Abhängigkeiten entsteht. Im Hinblick auf Sicherheit und Gewaltanwendung hat die Spezialisierung zur Schaffung von Polizeikräften und Armeen geführt. Diese Einheiten sind für die Aufrechterhaltung der Ordnung, den Schutz der Gesellschaft und die Durchsetzung von Gesetzen und Vorschriften zuständig. Diese Spezialisierung hatte auch bedeutende Auswirkungen auf die Kriegsführung und die Strukturierung moderner Gesellschaften.
Der Krieg, wie wir ihn heute verstehen, fällt mit der neolithischen Revolution zusammen, einer Zeit, in der die Menschen begannen, sesshaft zu werden und komplexere soziale Strukturen zu schaffen. Davor gab es zwar Konflikte zwischen Gruppen, aber sie hatten wahrscheinlich nicht die gleiche Größenordnung oder den gleichen Organisationsgrad wie das, was wir heute als "Krieg" klassifizieren. In der neolithischen Revolution entwickelten sich die Menschen von einem Leben als nomadische Jäger und Sammler zu einem Leben als sesshafte Landwirte. Dies führte zur Entstehung der ersten nennenswerten Bevölkerungsdichte - der Städte - sowie zu neuen Formen der sozialen und politischen Struktur. Diese höhere Bevölkerungsdichte und die komplexeren Strukturen erhöhten wahrscheinlich den Wettbewerb um Ressourcen, was zu einem besser organisierten Konflikt geführt haben könnte. Außerdem begann sich mit dem Aufkommen der Städte eine Spezialisierung der Berufe zu entwickeln. Diese Spezialisierung umfasste Rollen, die sich dem Schutz und der Verteidigung der Gemeinschaft widmeten, wie z. B. Krieger oder Soldaten, die sich ganz diesen Aufgaben widmen konnten, anstatt sich auch noch um die Landwirtschaft oder die Jagd kümmern zu müssen. Diese Spezialisierung ermöglichte die Entstehung besser organisierter und effektiverer militärischer Kräfte und trug so zur Eskalation des Krieges als soziales Phänomen bei.
Nach der neolithischen Revolution erleben wir einen raschen Anstieg der sozialen und politischen Komplexität. Sesshaftigkeit und Landwirtschaft führten zu stabileren und wohlhabenderen Gesellschaften, die in der Lage waren, eine wachsende Bevölkerung zu unterstützen. Mit dieser Zunahme der Bevölkerung und des Wohlstands verschärfte sich der Wettbewerb um die Ressourcen, was zu mehr Konflikten führte. Die ersten Stadtstaaten, wie die von Sumer in Mesopotamien um 5000 v. Chr., sind ein hervorragendes Beispiel für diese Zunahme der Komplexität. Diese Stadtstaaten waren hoch organisierte hierarchische Gesellschaften mit einer klaren Arbeitsteilung, einschließlich der militärischen Rollen. Sie hatten ihre eigenen Regierungen, Rechtssysteme und Religionen und besaßen und kontrollierten sehr oft ihr eigenes Territorium. Diese Stadtstaaten konkurrierten um die Kontrolle der Ressourcen und des Territoriums, und dieser Wettbewerb wurde oft in Kriegen ausgetragen. Die Kriege der damaligen Zeit waren oft offizielle Angelegenheiten, die von Königen oder ähnlichen Herrschern geführt wurden, und sie waren ein wichtiger Teil der damaligen Politik. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese Stadtstaaten zu größeren und komplexeren Königreichen und Imperien, wie dem Ägyptischen Reich, dem Assyrischen Reich und später dem Persischen, Griechischen und Römischen Reich. Diese Reiche führten zu noch größeren und komplexeren Kriegen, an denen oft Tausende oder sogar Zehntausende von Soldaten beteiligt waren.
Die Phalanx: Ursprünge moderner organisierter Gewalt[modifier | modifier le wikicode]
Während der klassischen Antike und vor allem während der Zeit des Römischen Reiches machte der Krieg einen qualitativen Sprung in Bezug auf die organisatorische und technologische Komplexität.
In organisatorischer Hinsicht entwickelte sich die römische Armee zu einer wahren Kriegsmaschine mit einer klaren Hierarchie, strenger Disziplin, rigoroser Ausbildung und ausgeklügelter Logistik. Das Modell der römischen Armee, das auf der Legion als Grundeinheit basierte, ermöglichte es den Römern, ihre Streitkräfte schnell und effizient über ein großes Gebiet zu verteilen. In technologischer Hinsicht wurden in dieser Zeit auch neue Waffen und Kriegsgeräte eingeführt und verbreitet. Die Römer entwickelten z. B. das Pilum, eine Art Speer, der dazu gedacht war, Schilde und Rüstungen zu durchdringen. Auch bei der Konstruktion von Belagerungsmaschinen wie Katapulten und Rammböcken gingen sie neue Wege.
Die technologische Dimension des Krieges beschränkte sich nicht auf Waffen und Ausrüstung. Die Römer waren besonders effektiv in der Nutzung von Technik zur Unterstützung ihrer militärischen Bemühungen. Sie bauten zum Beispiel ein ausgedehntes Netz von Straßen und Brücken, um die schnelle Bewegung ihrer Truppen zu erleichtern. Außerdem nutzten sie ihr Ingenieurwissen zum Bau von Forts und Befestigungen und zur Durchführung komplexer Belagerungsoperationen. Diese organisatorischen und technologischen Innovationen machten den Krieg zu einem immer komplexeren und kostspieligeren Unterfangen. Sie haben jedoch auch dazu beigetragen, die Macht von Imperien wie Rom zu stärken, indem sie es ihnen ermöglichten, große Gebiete zu erobern und zu kontrollieren.
Die Entwicklung des Krieges ist eng mit der zunehmenden Komplexität der Gesellschaften verknüpft. Die Phalanx ist ein Paradebeispiel dafür. Die Phalanx war eine Kampfformation, die von den Armeen des antiken Griechenlands verwendet wurde. Sie war eine schwere Infanterieeinheit, die aus Soldaten (Hopliten) bestand, die Seite an Seite in dichten Reihen standen. Jeder Soldat trug einen Schild und war mit einem Langspeer (Sarisse) ausgestattet, mit dem er den Feind angriff, während er hinter dem Schild seines Nachbarn geschützt blieb. Die Phalanx war eine hoch organisierte und disziplinierte Formation, die intensives Training und präzise Koordination erforderte. Ihr Hauptziel war es, den Feind beim ersten Aufprall zu zerschmettern, indem sie die kollektive Kraft der Soldaten nutzte, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen.
Dies war ein großer Fortschritt im Vergleich zu den zuvor verwendeten unordentlicheren Kampfmethoden. Diese komplexere Kampforganisation spiegelt die komplexere Struktur der griechischen Gesellschaft zu dieser Zeit wider. Die Armeen der Bürgersoldaten mussten gut diszipliniert und gut ausgebildet sein, um die Phalanx effektiv einsetzen zu können. Alexander der Große perfektionierte auf seinen militärischen Feldzügen den Einsatz der Phalanx und fügte Elemente der Kavallerie und der leichten Infanterie hinzu, um eine flexiblere und anpassungsfähigere Streitmacht zu schaffen. Dies trug zu seinen militärischen Erfolgen und der Expansion seines Reiches bei.
Die Entwicklung der Kriegsführung wurde maßgeblich durch den technologischen Fortschritt beeinflusst. Als sich die Gesellschaften weiterentwickelten und komplexer wurden, spielte die Technologie eine immer größere Rolle bei der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Von den Phalanxen im antiken Griechenland über den Einsatz von Katapulten und anderen Belagerungsmaschinen im Mittelalter bis hin zur Verwendung von Schießpulver in China und Europa hat die Technologie stets zur Gestaltung militärischer Strategien beigetragen. Dieser Trend setzte sich in der Neuzeit mit der Entwicklung von Artillerie, dampfbetriebenen Kriegsschiffen, U-Booten, Flugzeugen, Panzern und schließlich Atomwaffen fort. In jüngerer Zeit sind Cyberwar und bewaffnete Drohnen zu Schlüsselelementen des zeitgenössischen Schlachtfelds geworden. Die Technologie hat nicht nur Taktiken und Kampfstrategien beeinflusst, sondern auch die Logistik, die Kommunikation und die militärische Aufklärung verändert. Sie hat schnellere, effektivere und großflächigere Militäraktionen ermöglicht.
Das Mittelalter war geprägt von einem Wandel in der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Mit dem Untergang des Römischen Reiches gingen die fortschrittliche Militärorganisation und -technologie der Römer verloren. Die Konflikte dieser Zeit waren oft eher feudaler Natur, an denen Ritter und lokale Herrscher beteiligt waren, und die Schlachten waren oft kleiner und weiter verstreut. Der Krieg konzentrierte sich eher auf die Belagerung von Burgen und Überfälle als auf große, gereihte Schlachten.
Im 15. Jahrhundert, mit dem Beginn der Renaissance und der Bildung der ersten modernen Nationalstaaten, erleben wir einen weiteren Wandel des Krieges. Technologische Innovationen, insbesondere die Einführung von Artillerie und Feuerwaffen, veränderten die Dynamik des Krieges. Die militärische Organisation ist zentralisierter und strukturierter geworden, mit stehenden Armeen unter staatlichem Kommando.
Der moderne Staat spielte auch eine große Rolle bei der Umgestaltung des Krieges. Die Nationalstaaten begannen, die Verantwortung für die Verteidigung und die Sicherheit ihrer Bürger zu übernehmen. Dies führte zur Schaffung von Militärbürokratien, Rekrutierungs- und Ausbildungssystemen sowie einer logistischen Infrastruktur zur Unterstützung stehender Armeen. Der moderne Staat ermöglichte auch die Mobilisierung von Ressourcen in viel größerem Umfang, als dies in früheren feudalen Systemen möglich war. Diese Veränderungen hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wesen des Krieges und legten den Grundstein für den Krieg, wie wir ihn heute kennen.
Der Einfluss des Krieges auf die politische Moderne[modifier | modifier le wikicode]
Betrachtet man die lange Geschichte der Menschheit, so ist der Krieg, wie wir ihn heute verstehen, ein relativ junges Phänomen. Sein Vorkommen ist eng mit der Entstehung und Entwicklung komplexerer sozialer und politischer Strukturen verbunden. Wenn wir bis in die Steinzeit zurückgehen, finden wir nur wenige Hinweise auf organisierte Gewalt in großem Maßstab. Das Aufkommen des Krieges wird in der Regel mit dem Aufkommen der Zivilisation in Verbindung gebracht, das mit der neolithischen Revolution begann, als die Menschen begannen, sesshaft zu werden und organisiertere Gesellschaften zu schaffen. Mit dem Aufkommen der ersten Stadtstaaten um 5000 v. Chr. wurde der Krieg zu einem häufigeren Phänomen, da diese politischen Einheiten um Territorium und Ressourcen konkurrierten. Der Krieg nimmt eine organisiertere und strukturiertere Form an, mit stehenden Armeen und einer Militärstrategie. Die Entwicklung der modernen Kriegsführung ab dem 17. Jahrhundert fällt mit der Entstehung des modernen Staates zusammen. Mit größeren Ressourcen und einer zentralisierten Verwaltungsstruktur waren die Nationalstaaten in der Lage, Kriege in einem nie dagewesenen Ausmaß und mit einer nie dagewesenen Intensität zu führen.
Die Geschichte des Krieges ist auch die Geschichte des Staates. Einerseits kann die Bedrohung durch den Krieg die Gründung von Staaten fördern. Angesichts feindseliger Nachbarn können sich Gemeinschaften dafür entscheiden, sich unter einer einzigen politischen Autorität zu vereinen, um sich zu verteidigen. Der moderne Staat ist häufig aus diesem Prozess hervorgegangen, wie das berühmte Zitat von Thomas Hobbes veranschaulicht: "Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf". Andererseits erfordert die Kriegsführung eine groß angelegte Organisation und Koordination. Staaten haben diese Struktur bereitgestellt, indem sie Armeen aufstellten, Steuern zur Finanzierung von Militärkampagnen erhoben und Militärstrategien und -politiken festlegten. In Kriegszeiten haben Staaten oft ihre Macht und Reichweite vergrößert, sowohl über ihre eigenen Bürger als auch über das von ihnen kontrollierte Gebiet. Schließlich haben Kriege oft die Form und das Wesen von Staaten verändert. Konflikte können zur Auflösung oder zur Gründung neuer Staaten führen, wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, in der viele Kolonialreiche untergingen und neue Nationalstaaten entstanden. Es ist schwierig, die Geschichte des Staates zu verstehen, ohne die Rolle des Krieges zu berücksichtigen, und umgekehrt.
Der Krieg und der moderne Staat sind in der politischen Geschichte tief miteinander verbunden. Diese Beziehung ist zentral, um die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften und die Form, die bewaffnete Konflikte annehmen, zu verstehen. Der moderne Staat, wie er sich in Europa ab dem 17. Jahrhundert entwickelte, ist durch eine Zentralisierung der Macht und ein Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt gekennzeichnet. Die Bildung von Nationalstaaten und die Entstehung des westfälischen Systems fielen mit einer bedeutenden Veränderung des Wesens des Krieges zusammen. Erstens hat der moderne Staat den Krieg institutionalisiert. Der Staat hat das Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt, und der Krieg wurde zur Staatsangelegenheit. Diese Entwicklung ermöglichte die Einführung von Regeln und Strukturen rund um die Kriegsführung. Zweitens hat der moderne Staat den Krieg professionalisiert. Mit der Zentralisierung der Macht waren die Staaten in der Lage, stehende Armeen zu unterhalten. Dies führte zu zunehmend organisierten und technologisch fortschrittlichen Kriegen. Drittens: Der moderne Staat hat den Krieg verstaatlicht. In vormodernen Gesellschaften wurden Kriege oft von Fürsten oder Häuptlingen geführt, die in ihrem eigenen Namen handelten. Mit dem modernen Staat wurde der Krieg zu einer Angelegenheit der gesamten Nation. Der Krieg, so wie wir ihn heute verstehen, ist eine Schöpfung des modernen Staates. Er ist das Produkt der Entwicklung der menschlichen politischen Organisation und der Konzentration der Macht in den Händen des Staates.
Der Staat, wie wir ihn heute verstehen, ist eine spezifische Form der politischen Organisation, die sich in einer bestimmten Periode der Geschichte herausgebildet hat. Es gibt viele andere politische Organisationsformen, die es im Laufe der Geschichte gegeben hat und die in einigen Teilen der Welt auch heute noch existieren. Imperien zum Beispiel waren in der Antike und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eine gängige Form der politischen Organisation. Sie zeichneten sich durch eine zentrale Autorität (meist ein Kaiser oder König) aus, die über eine Reihe unterschiedlicher Gebiete und Völker herrschte. Stadtstaaten waren eine andere Form der politischen Organisation, die besonders im antiken Griechenland und im Italien der Renaissance verbreitet war. In diesem System bildeten eine Stadt und ihr umliegendes Gebiet eine unabhängige politische Einheit. Auch Kolonien sind eine Form der politischen Organisation, wenn auch häufig unter der Herrschaft einer anderen politischen Einheit (wie einem Reich oder einem Staat). Besonders häufig waren Kolonien in der Ära des europäischen Imperialismus vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Davon abgesehen ist der Staat zwar eine spezifische und relativ neue Form der politischen Organisation, doch hatte er einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wesen des Krieges und die Art und Weise, wie er geführt wird. Deshalb ist das Studium des Staates so wichtig, um den modernen Krieg zu verstehen.
Der Staat wird häufig als eine Struktur wahrgenommen, die notwendig ist, um soziale Stabilität, Sicherheit, die Einhaltung von Gesetzen und die Bereitstellung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit, Transport usw. zu gewährleisten. Diese positive Wahrnehmung des Staates sollte uns jedoch nicht davon abhalten, die komplexeren und manchmal problematischen Aspekte der Existenz des Staates zu verstehen. Einer dieser Aspekte hängt mit dem Monopol legitimer Gewalt zusammen, das der Staat nach der klassischen soziologischen Theorie von Max Weber besitzt. Dieses Monopol ermöglicht es dem Staat, die Ordnung aufrechtzuerhalten und das Gesetz durchzusetzen, aber es ermöglicht dem Staat auch, Krieg zu führen. Die Tatsache, dass Krieg in der Regel von Staaten geführt wird und untrennbar mit der Entstehung und Entwicklung des modernen Staates verbunden ist, ist eine Erinnerung daran, dass der Staat nicht nur eine Kraft der Stabilität und des Wohlstands ist, sondern auch eine Quelle der Gewalt und des Konflikts sein kann. Dies ist ein Aspekt, den wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir über den Staat und seine Rolle in der Gesellschaft nachdenken. Krieg, Gewalt und Konflikt sind nicht einfach nur Abnormitäten, sondern ein integraler Bestandteil der Natur des Staates. Deshalb ist das Verständnis des Krieges so entscheidend für das Verständnis des Staates.
Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist es, innerhalb seiner Grenzen für Frieden und Ordnung zu sorgen. Diese Aufgabe wird durch eine Reihe von Institutionen wie die Polizei und das Justizsystem erfüllt, deren Aufgabe es ist, das Gesetz durchzusetzen und Konflikte zwischen den Bürgern zu verhindern oder zu lösen. Der Staat wird oft als Garant für Sicherheit und Stabilität angesehen, und das ist einer der Gründe, warum die Bürger bereit sind, einen Teil ihrer Freiheit und Macht an ihn abzutreten. Jenseits der Staatsgrenzen sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Auf internationaler Ebene gibt es keine mit einem Staat vergleichbare Einheit, die in der Lage wäre, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Beziehungen zwischen Staaten werden oft als ein Zustand der "Anarchie" in dem Sinne beschrieben, dass es keine übergeordnete zentrale Autorität gibt. Dies kann zu Konflikten und Kriegen führen, da jeder Staat die Freiheit hat, so zu handeln, wie er es für richtig hält, um seine Interessen zu verteidigen.
Der Staat spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrung des internationalen Friedens. Als Teilnehmer an internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der WTO, der NATO und anderen hilft der Staat bei der Formulierung und Einhaltung internationaler Normen und Regeln, die für die Vermeidung und Bewältigung von Konflikten zwischen Nationen von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus beteiligen sich Staaten durch die Unterzeichnung und Einhaltung internationaler Verträge aktiv an der Schaffung einer regelbasierten Weltordnung, die zu Stabilität und Sicherheit auf internationaler Ebene beiträgt. In diesem Sinne wird der Staat als ein wesentlicher Akteur der modernen Zivilisation gesehen, der in der Lage ist, Ordnung zu schaffen und aufrechtzuerhalten, Zusammenarbeit zu fördern und Chaos und Anarchie zu verhindern. Dies wird im Allgemeinen als positive Entwicklung im Vergleich zu früheren historischen Perioden gesehen, in denen Gewalt und Krieg die gängigeren Mittel zur Lösung von Konflikten waren.
Eine der wichtigsten Rechtfertigungen für die Existenz des Staates liegt in seiner Fähigkeit, die Ordnung aufrechtzuerhalten und Chaos zu verhindern. Das Konzept des "Monopols der legitimen Gewalt" ist hier von grundlegender Bedeutung. Nach diesem Konzept, das von dem deutschen Soziologen Max Weber formuliert wurde, hat der Staat das ausschließliche Recht, innerhalb der Grenzen seines Hoheitsgebiets physische Gewalt anzuwenden, anzudrohen oder zuzulassen. In diesem Sinne wird der Staat oft als Gegenmittel zum Hobbes'schen "Naturzustand" betrachtet, in dem das Leben in Abwesenheit einer zentralisierten Macht "einsam, arm, brutal und kurz" wäre. Daher wird der Staat häufig als der Akteur betrachtet, der für Ordnung sorgt, Chaos und Anarchie verhindert und die Sicherheit seiner Bürger gewährleistet.
Ein effizienter Staat ist in der Regel in der Lage, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und grundlegende öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen, wodurch er zur sozialen Stabilität und zum sozialen Frieden beiträgt. In Gebieten, in denen der Staat schwach, abwesend oder ineffizient ist, kann es jedoch zu chaotischen Zuständen kommen. Konfliktgebiete sind beispielsweise häufig durch das Fehlen eines funktionierenden Staates gekennzeichnet, der in der Lage ist, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ebenso kann in zerfallenen oder gescheiterten Staaten die Unfähigkeit, Sicherheit zu gewährleisten und grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen, zu einem hohen Maß an Gewalt, Kriminalität und Instabilität führen.
Massengewalt wie Völkermorde sind Phänomene, die durch die Entstehung des modernen Staates und der industriellen Technologie erheblich erleichtert wurden. Bürokratische Effizienz, Mobilisierungsfähigkeit und die Kontrolle über große Ressourcen, die typische Merkmale moderner Staaten sind, können leider für zerstörerische Zwecke missbraucht werden. Nehmen wir als Beispiel die Shoah während des Zweiten Weltkriegs. Die systematische und groß angelegte Vernichtung der Juden und anderer Gruppen durch die Nationalsozialisten wurde durch den modernen Industriestaat und seinen bürokratischen Apparat ermöglicht. Auch der Völkermord in Ruanda 1994, bei dem innerhalb weniger Monate rund 800.000 Tutsi getötet wurden, wurde in großem Maßstab und mit erschreckender Effizienz größtenteils durch die Mobilisierung staatlicher Strukturen und Ressourcen durchgeführt.
Die beiden Weltkriege sind typische Beispiele für den totalen Krieg, ein Konzept, das einen Konflikt beschreibt, in dem die beteiligten Nationen alle ihre wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ressourcen mobilisieren, um den Krieg zu führen, und in dem die Unterscheidung zwischen Zivilisten und militärischen Kombattanten verwischt wird, wodurch die gesamte Bevölkerung den Schrecken des Krieges ausgesetzt wird. Der Erste Weltkrieg führte eine Industrialisierung und Mechanisierung des Krieges in einem nie dagewesenen Ausmaß ein, mit dem massiven Einsatz neuer Technologien wie schwerer Artillerie, Flugzeugen, Panzern und Giftgas. Die Gewalt dieses Krieges wurde durch die totale Beteiligung der kriegführenden Nationen verstärkt, wobei ihre Wirtschaft und Gesellschaft vollständig für die Kriegsanstrengungen mobilisiert wurden. Der Zweite Weltkrieg intensivierte das Konzept des totalen Krieges noch weiter. Er war durch die massive Bombardierung ganzer Städte, die systematische Ausrottung der Zivilbevölkerung und den Einsatz von Atomwaffen gekennzeichnet. In diesem Krieg wurden auch Propaganda in großem Stil eingesetzt, die Kriegswirtschaft ausgenutzt und Arbeitskräfte in großem Umfang mobilisiert. Somit ist der totale Krieg ein weiterer Ausdruck dafür, wie die Moderne und der moderne Staat die Entstehung neuer Formen der Gewalt in großem Maßstab ermöglicht haben.
Das 20. Jahrhundert war aufgrund der beiden Weltkriege, zahlreicher regionaler Konflikte, Völkermorde und totalitärer Regime von beispielloser Gewalt geprägt. Dieses Ausmaß an Gewalt wird häufig auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt, darunter die Entstehung mächtiger moderner Staaten, die Verfügbarkeit von Massenvernichtungswaffen und extreme Ideologien. Die Weltkriege haben zig Millionen Menschenleben gefordert. Darüber hinaus haben andere Konflikte wie der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der Völkermord an den Armeniern, der Holocaust, der Völkermord in Ruanda sowie die stalinistischen und maoistischen Säuberungen den Tod von weiteren Millionen Menschen verursacht. Auch interne politische Gewalt, die häufig von totalitären Regimen ausgeübt wurde, war im 20. Jahrhundert eine wichtige Quelle der Gewalt. Regime wie Stalin in der Sowjetunion, Mao in China, Pol Pot in Kambodscha und viele andere setzten politische Gewalt ein, um Gegner auszuschalten, ideologische Ziele zu erreichen oder ihre Macht zu erhalten. Alles in allem zeigt die Gewalt des 20. Jahrhunderts, wie zweischneidig die Moderne und der moderne Staat waren: Einerseits ermöglichten sie ein beispielloses Maß an Entwicklung, Wohlstand und Stabilität in vielen Teilen der Welt; andererseits ermöglichten sie ein beispielloses Maß an Gewalt und Zerstörung.
Der moderne Staat, der durch seine Souveränität, sein definiertes Territorium, seine Bevölkerung und seine Regierung gekennzeichnet ist, soll seinen Bürgern Schutz vor Gewalt bieten. Er soll Ordnung und Stabilität durch Rechtsstaatlichkeit, eine effiziente Verwaltung und den Schutz der Rechte und Freiheiten seiner Bürger gewährleisten. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt jedoch, dass der moderne Staat auch eine Hauptquelle der Gewalt sein kann. Weltkriege, regionale Konflikte, Völkermord und politische Säuberungen wurden weitgehend von modernen Staaten verübt oder erleichtert. Diese Formen der Gewalt stehen häufig im Zusammenhang mit der Ausübung staatlicher Macht, der Verteidigung der bestehenden Ordnung oder der Durchsetzung bestimmter Ideologien oder Politiken. Der moderne Staat hat also zwei Seiten. Einerseits kann er Ordnung, Sicherheit und Stabilität garantieren und einen Rahmen für Wohlstand und Entwicklung bieten. Andererseits kann er eine Hauptquelle von Gewalt und Unterdrückung sein, insbesondere wenn er für Kriegszwecke, politische Unterdrückung oder zur Durchsetzung bestimmter ideologischer Ziele eingesetzt wird. Es ist wichtig, dieses Paradoxon zu verstehen, um die Komplexität der politischen und sozialen Herausforderungen zu erfassen, mit denen wir in der modernen Welt konfrontiert sind.
Entwicklung des Krieges im Laufe der Geschichte[modifier | modifier le wikicode]
Der Krieg als Konstrukteur des modernen Staates[modifier | modifier le wikicode]
Um den Krieg zu untersuchen, muss man sich vor allem auf seine Verbindungen zum modernen Staat als politische Organisation konzentrieren. Wir werden sehen, wie der Krieg heute durch und durch die Entstehung des modernen Staates ist. Wir werden zunächst feststellen, dass der Krieg eine Angelegenheit des Staates ist. Um die Idee einzuführen, dass der Krieg mit dem Aufbau des Staates selbst und der Entstehung des Staates als politische Organisationsform in Europa ab dem Ausgang des Mittelalters verbunden ist, dafür ist der beste Weg und wie von dem Soziohistoriker Charles Tilly in seinem Artikel War Making and State Making as Organized Crime gebracht, der die Idee von war making/state making entwickelt hat: Durch das Führen von Kriegen wurde der Staat gemacht und umgekehrt.
In "War Making and State Making as Organized Crime" bietet Charles Tilly eine provokante sozio-historische Analyse des Aufbaus des modernen Staates in Westeuropa. Er argumentiert, dass die Prozesse der Staatsbildung und des Krieges intrinsisch miteinander verbunden sind, und er vergleicht Staaten sogar mit kriminellen Organisationen, um die Zwangs- und Ausbeutungsaspekte ihrer Entstehung hervorzuheben. Tilly zufolge wird die Bildung moderner Staaten weitgehend von den Bemühungen der herrschenden Eliten angetrieben, die für den Krieg notwendigen Ressourcen zu mobilisieren. Zu diesem Zweck greifen diese Eliten auf Mittel wie Besteuerung, Einberufung und Enteignung zurück, die mit Formen von Erpressung und Schutzgelderpressung gleichgesetzt werden können. Darüber hinaus argumentiert Tilly, dass der Aufbau des Staates auch durch die Monopolisierung der Anwendung legitimer Gewalt erleichtert wurde. Mit anderen Worten: Die Herrscher waren bestrebt, alle anderen Quellen von Macht und Autorität in ihrem Gebiet zu beseitigen oder unterzuordnen, darunter Feudalherren, Zünfte, Gilden und bewaffnete Banden. Dieser Prozess war häufig mit der Anwendung von Gewalt, Zwang und politischer Manipulation verbunden. Schließlich betont Tilly, dass der Aufbau des Staates auch die Herstellung eines sozialen Konsenses oder zumindest die Zustimmung der Bevölkerung erforderte, und zwar durch die Entwicklung einer nationalen Identität, die Schaffung sozialer und politischer Institutionen und die Bereitstellung von Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen. Diese Analyse bietet eine kritische und entlarvende Perspektive auf den Aufbau moderner Staaten, beleuchtet ihre gewalttätigen und zwanghaften Wurzeln und unterstreicht gleichzeitig ihre Schlüsselrolle bei der Strukturierung unserer heutigen Gesellschaften.
Die Vorstellung vom modernen Staat, wie wir ihn heute kennen, basiert hauptsächlich auf dem europäischen Modell, das sich während der Renaissance und der Neuzeit zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert herausbildete. Diese Entwicklung war gekennzeichnet durch die Zentralisierung der politischen Macht, die Bildung definierter nationaler Grenzen, die Entwicklung einer Verwaltungsbürokratie und die Monopolisierung der Anwendung legitimer Gewalt durch den Staat. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es in anderen Teilen der Welt auch andere politische Modelle gibt, die auf unterschiedlichen historischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Verläufen beruhen. Beispielsweise kann die politische Struktur in manchen Gesellschaften stärker dezentralisiert sein oder auf anderen Prinzipien wie Gegenseitigkeit, Hierarchie oder Gleichheit beruhen. Darüber hinaus ist der Prozess des Exports des europäischen Staatsmodells, insbesondere durch die Kolonialisierung und in jüngerer Zeit durch Staatsaufbau oder Nation-Building, häufig auf Widerstand gestoßen und konnte zu Konflikten und Spannungen führen. Dies ist häufig darauf zurückzuführen, dass diese Prozesse möglicherweise die lokalen Gegebenheiten nicht berücksichtigen und manchmal als Formen der kulturellen oder politischen Auferlegung wahrgenommen werden können.
Charles Tilly schlägt in seinem Artikel "War Making and State Making as Organized Crime" einen Denkrahmen vor, um den Prozess der Staatenbildung zu verstehen, wobei er sich insbesondere auf Europa zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert konzentriert. Tilly sieht den Prozess der Staatsentstehung als ein Produkt zweier miteinander verbundener Dynamiken: war making (Krieg) und state making (Staatsbildung).
- War making: Tilly postuliert, dass Staaten durch die ständige Notwendigkeit geformt wurden, sich auf Kriege vorzubereiten, sie zu führen und zu finanzieren. Kriege, insbesondere im europäischen Kontext, waren Schlüsselfaktoren für die Entwicklung staatlicher Strukturen, vor allem aufgrund der Ressourcen, die für die Durchführung von Kriegen benötigt wurden.
- State making: Hierbei handelt es sich um den Prozess, durch den die Zentralgewalt eines Staates gefestigt wird. Für Tilly bedeutet dies, dass er seine internen Rivalen (insbesondere die Feudalherren) kontrolliert und neutralisiert und seine Autorität über das gesamte von ihm kontrollierte Gebiet durchsetzt.
Diese beiden Prozesse sind eng miteinander verknüpft, da Kriege den Anstoß für die Konsolidierung des Staates liefern und gleichzeitig selbst durch diese Konsolidierung ermöglicht werden. Um Kriege zu finanzieren, mussten die Staaten beispielsweise effizientere Steuer- und Verwaltungssysteme einführen, was ihre Autorität stärkte.
Krieg und der moderne Staat[modifier | modifier le wikicode]
Das Feudalsystem war eine komplexe Struktur der Beziehungen zwischen den Grundherren und dem König, die auf Landbesitz (oder "Lehen") und Loyalität beruhte. Die Lehnsherren hatten eine große Autonomie über ihr Land und waren in der Regel für die Sicherheit und Gerechtigkeit auf ihrem Land verantwortlich. Als Gegenleistung für ihr Lehen mussten sie dem König Treue schwören und ihm militärische Unterstützung gewähren, wenn er sie brauchte. Dieses Vasallensystem bildete die Grundlage der Macht während des Mittelalters. Mit dem Aufkommen des modernen Staates wurde dieses System jedoch allmählich abgelöst. Die Konsolidierung des Staates ging mit dem Bestreben einher, die Macht zu zentralisieren, was häufig mit der Beseitigung oder Reduzierung der Macht der Feudalherren einherging. Ein Schlüsselelement in diesem Prozess war die Notwendigkeit, den Krieg zu finanzieren und zu unterstützen. Die Könige begannen, Verwaltungs- und Steuerstrukturen zu entwickeln, um Gelder zu beschaffen und Armeen direkt zu rekrutieren, anstatt sich auf die Feudalherren zu verlassen. Dies stärkte ihre Autorität und ermöglichte die Bildung von Staaten, die stärker zentralisiert und bürokratisiert waren.
Laut Charles Tilly war der Krieg eine starke Triebfeder für die Entstehung des modernen Staates. Im Mittelalter führte der Wettbewerb zwischen den Fürsten, ihr Territorium zu vergrößern und ihre Macht zu steigern, oft zu Konflikten. Die Fürsten kämpften ständig gegeneinander und versuchten, die Kontrolle über das Land und die Ressourcen der anderen zu erlangen. Außerdem waren diese Konflikte auf lokaler Ebene oft mit größeren Konflikten zwischen den Königreichen verbunden. Die Könige brauchten eine starke Machtbasis, um ihre Kriegsanstrengungen zu unterstützen, was dazu führte, dass sie versuchten, ihre Kontrolle über ihre Fürsten zu stärken. Diese Dynamiken erzeugten einen ständigen Druck zu einer stärkeren Zentralisierung und effizienteren Organisation. Die Könige entwickelten ausgefeiltere Verwaltungen und effizientere Steuersysteme, um ihre Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Gleichzeitig versuchten sie, die Macht der Feudalherren zu beschränken und ihre eigene Autorität zu behaupten. Diese Prozesse legten den Grundstein für den modernen Staat.
Norbert Elias, ein deutscher Soziologe, entwickelte in seinem Werk "The Civilizing Process" den Begriff des "eliminatorischen Kampfes". In diesem Zusammenhang bezeichnet er einen Wettbewerb, bei dem sich die Akteure gegenseitig eliminieren, bis nur noch wenige oder sogar nur noch einer übrig ist. Im Zusammenhang mit der Staatsbildung kann dies als Metapher für die Art und Weise gesehen werden, wie Feudalherren im Mittelalter um Macht und Territorium kämpften. Im Laufe der Zeit wurden einige Fürsten eliminiert, entweder durch militärische Niederlagen oder durch Assimilation in größere Einheiten. Dieser Prozess des eliminatorischen Kampfes trug zur Zentralisierung der Macht und zur Bildung des modernen Staates bei.
Im Laufe der Jahrhunderte bauten viele französische Könige ihre Macht schrittweise aus, übernahmen die Gebiete des Feudaladels und festigten die zentrale Autorität. Diese Bemühungen wurden häufig durch strategische Heiratsbündnisse, militärische Eroberungen, politische Absprachen und in einigen Fällen durch das natürliche oder erzwungene Aussterben bestimmter Adelslinien unterstützt. Vor allem Ludwig XI. spielte in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Als König von 1461 bis 1483 wurde er aufgrund seiner klugen und manipulativen Politik als "Universelle Aragne" oder "Universelle Spinne" bezeichnet. Ludwig XI. arbeitete hart daran, die königliche Macht zu zentralisieren, den Einfluss der großen Feudalherren zu verringern und eine effizientere und direktere Verwaltung im gesamten Königreich einzuführen. Dies trug zur Bildung des modernen Staates mit einer zentralisierten Macht und einer organisierten Verwaltung bei, der im Laufe der Jahrhunderte weiter ausgebaut wurde, insbesondere durch Franz I. und Ludwig XIV, den "Sonnenkönig".
Frankreich und Großbritannien werden oft als typische Beispiele für die Entstehung des modernen Staates angeführt. In Frankreich zentralisierten die Könige nach und nach die Macht und führten eine direktere und effizientere Verwaltung ein. Der Höhepunkt dieser Zentralisierung wurde wahrscheinlich unter der Herrschaft Ludwigs XIV. erreicht, der erklärte "L'Etat, c'est moi" und direkt von seinem Palast in Versailles aus regierte. Dieser Prozess wurde jedoch von Zeiten des Konflikts und der Revolte unterbrochen, wie der Fronde und später der Französischen Revolution. Großbritannien hingegen ging einen etwas anderen Weg zur Bildung des modernen Staates. König Heinrich VIII. festigte die königliche Macht, indem er die Kirche von England einrichtete und die Klöster auflöste, aber in Großbritannien gab es auch eine starke Bewegung für die Einschränkung der königlichen Macht. Dies gipfelte in der Glorious Revolution von 1688 und der Einführung eines Verfassungssystems, in dem die Macht zwischen dem König und dem Parlament geteilt wurde. In beiden Fällen spielte der Krieg eine große Rolle bei der Staatsbildung. Die Notwendigkeit, Armeen aufzustellen, Steuern zur Finanzierung von Kriegen zu erheben und die innere Ordnung aufrechtzuerhalten, trug wesentlich zur Zentralisierung der Macht und zur Schaffung effizienter Verwaltungsstrukturen bei.
Der externe Wettbewerb, insbesondere ab der Renaissance und während der Neuzeit, war eine wichtige Triebkraft bei der Bildung von Staaten und der Strukturierung des internationalen Systems, wie wir es heute kennen. Dies lässt sich an der Entwicklung von Diplomatie, Bündnissen und Verträgen, Kriegen zur Eroberung und Kontrolle von Territorien und sogar an der kolonialen Expansion ablesen. Dies führte auch zu einer klareren Festlegung von Staatsgrenzen und zur Anerkennung der Souveränität von Staaten. Insbesondere die Beteiligung Ludwigs XI. und seiner Nachfolger an den Kriegen in Italien und gegen England spielte eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung Frankreichs als Staat und bei der Festlegung seiner nationalen Grenzen und Interessen. In ähnlicher Weise hat auch der Wettbewerb zwischen den europäischen Mächten um Gebiete im Ausland während der Ära der Kolonialisierung das internationale System mitgeprägt.
Die imperialen Ambitionen von Herrschern wie Ludwig XI. waren zum Teil von dem Wunsch getrieben, ihre Macht und Autorität sowohl intern als auch extern zu festigen. Sie brauchten Ressourcen, um Kriege zu führen, was oft bedeutete, dass sie von ihren Untertanen höhere Steuern verlangten. Diese Kriege hatten oft auch eine religiöse Dimension, mit der Idee, die christliche Welt wieder zu vereinen. Als sich diese Königreiche entwickelten und begannen, miteinander zu kollidieren, begann sich ein internationales System herauszubilden. Dies war ein langsamer und oft konfliktreicher Prozess mit vielen Kriegen und politischen Konflikten. Doch im Laufe der Zeit begannen diese Staaten, die Souveränität anderer anzuerkennen, Regeln für internationale Interaktionen aufzustellen und Institutionen zu entwickeln, die diese Interaktionen erleichtern sollten.
All dies hat zur Bildung eines Systems miteinander verbundener Nationalstaaten geführt, in dem jeder Staat seine eigenen Interessen und Ziele verfolgt, aber auch eine gewisse Verpflichtung hat, die Souveränität anderer Staaten zu respektieren. Dies ist die Grundlage des internationalen Systems, das wir heute haben, auch wenn sich die Besonderheiten im Laufe der Zeit verändert haben.
Die Rolle des Krieges im zwischenstaatlichen System[modifier | modifier le wikicode]
Um einen Krieg zu führen (war-making), muss ein Staat erhebliche Ressourcen mobilisieren. Dazu gehören materielle Ressourcen wie Geld, um die Armee zu finanzieren und Waffen zu kaufen, Nahrungsmittel, um die Armee zu ernähren, und Materialien, um Befestigungen und andere militärische Infrastrukturen zu bauen. Es erfordert auch menschliche Ressourcen, wie Soldaten, um zu kämpfen, und Arbeiter, um die benötigten Güter zu produzieren. Um diese Ressourcen zu erhalten, muss der Staat in der Lage sein, eine wirksame Kontrolle über sein Territorium und seine Bewohner auszuüben. Hier kommt der Staatsaufbau (state-making) ins Spiel. Der Staat muss wirksame Steuersysteme einrichten, um das Geld für die Finanzierung des Krieges einzutreiben. Er muss auch in der Lage sein, Soldaten zu rekrutieren oder einzuziehen, was möglicherweise Anstrengungen erfordert, um ein Gefühl der Loyalität oder Pflicht gegenüber dem Staat zu schaffen. Außerdem muss er in der Lage sein, innerhalb seiner Grenzen für Ordnung zu sorgen und Konflikte zu lösen, damit er sich auf den Krieg außerhalb der Grenzen konzentrieren kann. Somit sind Krieg und Staatsaufbau eng miteinander verbunden. Das eine erfordert das andere, und beide verstärken sich gegenseitig. Wie Charles Tilly schrieb: "Staaten führen Kriege und Kriege führen Staaten".
Die Notwendigkeit, Kriege zu führen, hat die Staaten dazu veranlasst, eine effiziente Bürokratie zu entwickeln, die in der Lage ist, Ressourcen zu sammeln und eine Armee zu organisieren. Dieser Prozess stärkte die Fähigkeit des Staates, sein Territorium und seine Einwohner zu regieren, d. h. seine Souveränität. Um die Bevölkerung zu erfassen, Steuern einzutreiben und Soldaten zu rekrutieren, musste der Staat eine Verwaltung aufbauen, die diese Aufgaben bewältigen konnte. Dies bedeutete die Entwicklung von Systemen zur Erfassung von Informationen über die Einwohner, die Einführung von Gesetzen über Steuern und Einberufung und die Schaffung von Stellen, die diese Gesetze durchsetzen sollten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese bürokratischen Systeme weiter und wurden immer effizienter und ausgefeilter. Sie trugen auch dazu bei, die Autorität des Staates zu stärken, indem die Einwohner seine Legitimität akzeptierten. Die Menschen waren eher bereit, Steuern zu zahlen und in der Armee zu dienen, wenn sie glaubten, dass der Staat das Recht hatte, dies von ihnen zu verlangen. Der Krieg spielte eine zentrale Rolle im Prozess des Staatsaufbaus, nicht nur, weil er die Entwicklung einer effizienten Bürokratie förderte, sondern auch, weil er die Autorität und Legitimität des Staates stärkte.
Charles Tilly zufolge entwickelte sich der moderne Staat aus einem langfristigen Prozess, der als "war making" (Krieg) und "state making" (Staatsaufbau) bezeichnet wird. Diese Theorie behauptet, dass Kriege die Hauptantriebskräfte für die Zunahme der Macht und Autorität des Staates in der Gesellschaft waren. Tillys Theorie legt nahe, dass sich der moderne Staat in einem Kontext von Konflikt und Gewalt gebildet hat, in dem die Fähigkeit, Kriege zu führen und ein Gebiet effektiv zu kontrollieren, Schlüsselfaktoren für das Überleben und den Erfolg des Staates waren.
Nach dem Ende des Mittelalters trat Europa in eine Zeit des intensiven Wettbewerbs zwischen den aufstrebenden Nationalstaaten ein. Diese Staaten versuchten, ihren Einfluss auszuweiten und ihre Vorherrschaft über andere zu behaupten, was häufig zu Kriegen führte. Eines der symbolträchtigsten Beispiele für diese Zeit ist Napoleon Bonaparte. Als Kaiser von Frankreich strebte Napoleon eine französische Herrschaft auf dem europäischen Kontinent an und schuf ein Reich, das sich von Spanien bis Russland erstreckte. Sein Versuch, ein grenzenloses und inklusives Imperium zu schaffen, war in Wirklichkeit ein Versuch, andere Nationen dem Willen Frankreichs zu unterwerfen. Diese Zeit der Rivalitäten und Kriege ermöglichte jedoch auch die Konsolidierung des Nationalstaats als wichtigste Form der politischen Organisation. Die Staaten verstärkten die Kontrolle über ihr Territorium, zentralisierten ihre Autorität und entwickelten bürokratische Institutionen, um ihre Angelegenheiten zu verwalten. Die Entstehung des modernen Nationalstaats in der nachmittelalterlichen Zeit war zum großen Teil das Produkt imperialer Ambitionen und zwischenstaatlicher Rivalitäten. Diese Faktoren führten zur Etablierung eines zwischenstaatlichen Systems, das auf Souveränität und Krieg als Mittel zur Konfliktlösung basierte. Und diese Entwicklung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf unsere heutige Welt.
Nach einer Zeit intensiver Kriege und Konflikte hat sich zwischen den europäischen Nationalstaaten ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte eingestellt. Dieses Gleichgewicht, das häufig als "Gleichgewicht der Mächte" bezeichnet wird, ist zu einem Grundprinzip der internationalen Politik geworden. Das Gleichgewicht der Kräfte geht davon aus, dass die nationale Sicherheit gewährleistet ist, wenn die militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten so verteilt sind, dass kein Staat in der Lage ist, die anderen zu dominieren. Dies fördert die Zusammenarbeit, den friedlichen Wettbewerb und hilft theoretisch, Kriege zu verhindern, indem es von Aggressionen abhält. Darüber hinaus hat dieser Prozess auch zu einer Stabilisierung der Grenzen geführt. Die Staaten erkannten schließlich die Grenzen des jeweils anderen an und respektierten sie, was dazu beitrug, Spannungen abzubauen und den Frieden zu erhalten.
Von da an entstand die Idee der Souveränität, d. h. die Idee der Autorität über das Territorium wurde in Räume aufgeteilt, über die Souveränität ausgeübt wird, die sich untereinander ausschließen. Souveränität ist ein Grundprinzip des modernen internationalen Systems, das auf der Vorstellung beruht, dass jeder Staat die höchste und ausschließliche Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung besitzt. Diese Autorität umfasst das Recht, Gesetze zu erlassen, diese Gesetze anzuwenden und diejenigen zu bestrafen, die gegen sie verstoßen, die Grenzen zu kontrollieren, diplomatische Beziehungen zu anderen Staaten zu pflegen und gegebenenfalls den Krieg zu erklären. Souveränität ist untrennbar mit dem Begriff des Nationalstaats verbunden und grundlegend für das Verständnis der Dynamik der internationalen Beziehungen. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Staat das Recht hat, seine eigenen inneren Angelegenheiten ohne Einmischung von außen zu regeln, was von anderen Staaten im internationalen System als Recht anerkannt wird.
Langfristig entwickelt sich um das Souveränitätsprinzip herum ein Universalismus des Nationalstaats, der nicht der des Imperiums ist, da das Souveränitätsprinzip von allen als organisierendes Prinzip des internationalen Systems anerkannt wird. Das Prinzip der Souveränität und der Gleichheit aller Staaten ist eine Grundlage des internationalen Systems und der Vereinten Nationen. Das bedeutet, dass theoretisch jeder Staat, ob groß oder klein, reich oder arm, z. B. in der Generalversammlung der Vereinten Nationen nur eine Stimme hat. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der souveränen Gleichheit, der in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist. In Artikel 2 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen heißt es, dass die Organisation auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder beruht.
Die Idee der Vereinten Nationen entspringt der Idee des Prinzips der Souveränität als Organisator des internationalen Systems. Dieses sich entwickelnde zwischenstaatliche System ist um die Idee herum organisiert, dass es eine Logik des internen Gleichgewichts gibt, bei der der Staat ein Gebiet verwaltet, d. h. die "Polizei"; und extern, bei der die Staaten untereinander ihre Angelegenheiten regeln. Diese Unterscheidung ist ein zentraler Aspekt des Konzepts der staatlichen Souveränität. Es ist der Staat, der das Vorrecht und die Pflicht hat, die inneren Angelegenheiten zu regeln, einschließlich der Durchsetzung von Gesetzen, der Gewährleistung der öffentlichen Ordnung, der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und der Rechtspflege. Dies wird als interne Souveränität bezeichnet. In Bezug auf die externe Souveränität ist dies das Recht und die Fähigkeit eines Staates, auf der internationalen Bühne autonom zu handeln. Dazu gehört das Recht, mit anderen Staaten in Beziehung zu treten, internationale Verträge zu unterzeichnen, sich an internationalen Organisationen zu beteiligen und seine Außenpolitik nach seinen eigenen Interessen zu betreiben.
In dem Moment, in dem es all diese Staaten gibt, die gebildet werden, müssen sie auch miteinander kommunizieren. Da jeder als Staat überleben muss und es noch andere Staaten gibt, wie sollen wir da kommunizieren? Wenn wir davon ausgehen, dass der Krieg eine Institution ist, dient er genau diesem Zweck. Der Krieg als Institution war ein Mittel für Staaten, um miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Krieg wünschenswert oder unvermeidbar ist, aber er hat sicherlich eine Rolle bei der Bildung von Staaten und bei der Definition der Beziehungen zwischen ihnen gespielt. In der europäischen Geschichte wurden Kriege beispielsweise häufig dazu genutzt, Konflikte über Territorium, Macht, Ressourcen oder Ideologie zu lösen. Die Ergebnisse dieser Kriege führten oft zu Veränderungen der Grenzen, Bündnisse und Machtverhältnisse zwischen den Staaten.
Laut John Vasquez ist Krieg eine erlernte Modalität der politischen Entscheidungsfindung, durch die zwei oder mehr politische Einheiten auf der Grundlage eines gewalttätigen Wettbewerbs materielle Güter oder Güter von symbolischem Wert zuteilen. Die Definition von John Vasquez hebt den Aspekt des gewaltsamen Wettbewerbs im Krieg hervor. Nach dieser Sichtweise ist Krieg ein Mechanismus, mit dem politische Einheiten, in der Regel Staaten, ihre Meinungsverschiedenheiten oder Rivalitäten lösen. Dabei kann es um Macht, Territorium, Ressourcen oder Ideologien gehen. Diese Definition unterstreicht eine Sichtweise des Krieges, die fest in einer realistischen Denktradition in den internationalen Beziehungen verankert ist, die die internationale Politik als einen Kampf aller gegen alle sieht, bei dem Konflikte unvermeidlich sind und der Krieg ein natürliches Mittel der Politik ist.
Wir entfernen uns von der Vorstellung des Krieges als etwas Anarchischem oder Gewalttätigem. Krieg ist etwas, das in seinem modernen Verständnis entwickelt wurde, um Streitigkeiten zwischen Staaten beizulegen, er ist ein Mechanismus zur Konfliktlösung. Dies erscheint kontraintuitiv, da Krieg im Allgemeinen mit Anarchie und Gewalt in Verbindung gebracht wird. Im Kontext der internationalen Beziehungen und der politischen Theorie kann der Krieg jedoch trotz seiner tragischen Folgen als ein Mechanismus zur Lösung von Konflikten zwischen Staaten verstanden werden. Diese Perspektive versucht nicht, die durch den Krieg verursachte Gewalt und Zerstörung zu verharmlosen, sondern vielmehr zu verstehen, wie und warum sich Staaten für den Einsatz militärischer Gewalt entscheiden, um ihre Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Aus dieser Perspektive ist Krieg kein chaotischer Zustand, sondern eine Form des politischen Verhaltens, die von bestimmten Normen, Regeln und Strategien bestimmt wird. Aus diesem Grund wird der Krieg oft als "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" beschrieben - ein berühmter Satz des Militärtheoretikers Carl von Clausewitz. Das bedeutet, dass der Krieg von Staaten als Instrument eingesetzt wird, um politische Ziele zu erreichen, wenn andere Mittel versagen.
Krieg kann als ultimativer Konfliktlösungsmechanismus verstanden werden, der eingesetzt wird, wenn Meinungsverschiedenheiten nicht mit anderen Mitteln gelöst werden können. Dieser Prozess erfordert die Mobilisierung bedeutender Ressourcen, wie z. B. Streitkräfte, die aus den Steuereinnahmen der kriegführenden Staaten finanziert werden. Das Endziel ist eine Einigung, die oft durch den Ausgang der Kämpfe bestimmt wird. Ein Sieg führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer endgültigen Beilegung des Konflikts zugunsten des Siegers. Der Ausgang eines Krieges kann zu Kompromissen, politischen und territorialen Veränderungen und manchmal sogar zur Entstehung neuer Streitigkeiten führen.
Krieg kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Aus einer humanitären Perspektive wird er häufig im Hinblick auf das Leid und die Verluste an Menschenleben gesehen, die er verursacht. Aus dieser Perspektive ergeben sich Fragen zum Schutz der Zivilbevölkerung, zu den Menschenrechten und den Auswirkungen auf die sozioökonomische Entwicklung der betroffenen Gebiete. Aus rechtlicher Sicht ist der Krieg mit einer komplexen Reihe von internationalen Regelungen und Gesetzen verbunden, darunter das humanitäre Völkerrecht, das Kriegsrecht und verschiedene internationale Abkommen und Verträge. Diese Regelungen zielen darauf ab, die Auswirkungen des Krieges zu begrenzen, insbesondere durch den Schutz von Zivilisten und das Verbot bestimmter Praktiken und Waffen. Trotz dieser Regelungen bleiben die rechtlichen Herausforderungen jedoch hoch, insbesondere wenn es darum geht, die Legitimität einer bewaffneten Intervention zu bestimmen, die Verantwortlichkeiten bei Verstößen gegen das Völkerrecht zu bewerten oder die Folgen nach einem Konflikt, wie Übergangsjustiz und Wiederaufbau, zu bewältigen.
Alles in allem ist Krieg als Konfliktlösungsmechanismus ein komplexes Phänomen, das sowohl humanitäre als auch politische, wirtschaftliche und rechtliche Fragen aufwirft. Der Blickwinkel dieses Kurses ist der der Politikwissenschaft, um zu sehen, woher dieses Phänomen kommt und wozu es dient. Wir beschäftigen uns hier nicht mit der normativen Dimension des Krieges.
Wir kommen zu der Idee, dass Krieg ein Konfliktlösungsmechanismus ist und dass daher, wenn die Strategie ein Ende hat, das Ende und das Ziel dieser Strategie der Frieden ist. Das ultimative Ziel der Militärstrategie ist oft die Schaffung oder Wiederherstellung des Friedens, auch wenn der Weg dorthin die Anwendung von Gewalt beinhaltet. Diese Idee hat ihren Ursprung in den Schriften verschiedener militärischer Denker, von denen Carl von Clausewitz vielleicht der bekannteste ist. In seinem Werk "Vom Kriege" beschrieb Clausewitz den Krieg als die "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Diese Perspektive legt nahe, dass der Krieg kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel zur Erreichung politischer Ziele, zu denen auch die Schaffung von Frieden gehören kann. Darüber hinaus wird Krieg in der Tradition der Theorie der internationalen Beziehungen häufig als ein Instrument betrachtet, das Staaten zur Lösung von Streitigkeiten einsetzen können, wenn sie es nicht schaffen, mit friedlichen Mitteln eine Einigung zu erzielen. Obwohl Krieg also ein gewalttätiger und zerstörerischer Akt ist, kann er als Teil eines umfassenderen Prozesses zur Wiederherstellung von Stabilität und Frieden betrachtet werden.
Beide sind miteinander verbunden. Wir befinden uns in einem Verständnis, in dem Frieden eng mit Krieg verbunden ist und vor allem, dass die Definition von Frieden eng mit Krieg verbunden ist. Frieden wird als die Abwesenheit von Krieg verstanden. Es ist interessant zu sehen, wie das Ziel der Strategie darin besteht, zu gewinnen und zu einem Zustand des Friedens zurückzukehren. Es ist wirklich der Krieg, der diesen Zustand bestimmt. Es gibt eine sehr starke Dialektik zwischen den beiden. Wir beschäftigen uns mit der Beziehung zwischen Krieg und Staat, aber auch zwischen Krieg und Frieden. Diese Beziehung ist von grundlegender Bedeutung, mit der wir uns heute nicht befassen werden. In vielen theoretischen Rahmen wird Frieden im Gegensatz zu Krieg definiert. Das heißt, Frieden wird häufig als die Abwesenheit eines bewaffneten Konflikts konzeptualisiert. Diese Sichtweise wird als "negativer Frieden" bezeichnet, in dem Sinne, dass Frieden eher durch das definiert wird, was er nicht ist (d. h. Krieg), als durch das, was er ist. Die Militärstrategie zielt oft darauf ab, diesen Zustand des "negativen Friedens" wiederherzustellen, indem man den Krieg gewinnt oder günstige Bedingungen für das Ende des Konflikts erreicht.
Wir sprechen von Frieden, denn wichtig ist, dass in der Konzeption des Krieges, die sich mit der Entstehung dieses zwischenstaatlichen Systems herausbildet, d. h. mit Staaten, die sich im Inneren bilden und nach außen miteinander konkurrieren, der Krieg kein Ziel an sich ist, das Ziel ist nicht die Kriegsführung selbst, sondern der Frieden; man führt Krieg, um etwas zu erreichen. Dies ist die Auffassung von Raymon Aron. Raymond Aron ist ein französischer Philosoph und Soziologe, der für seine Arbeiten zur Soziologie der internationalen Beziehungen und zur politischen Theorie berühmt ist. Seiner Meinung nach ist der Krieg kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck des Friedens. Das bedeutet, dass der Krieg ein politisches Instrument ist, ein Werkzeug, das von Staaten eingesetzt wird, um bestimmte Ziele zu erreichen, in der Regel mit dem Ziel, Konflikte zu lösen und Frieden zu erreichen. Aus dieser Perspektive ist der Krieg eine extreme Form der Diplomatie und der Verhandlungen zwischen Staaten. Er ist eine Erweiterung der Politik und wird geführt, wenn friedliche Mittel bei der Lösung von Streitigkeiten versagen. Aus diesem Grund erklärte Aron: "Frieden ist der Zweck, Krieg ist das Mittel".
Die Auffassung vom Krieg als Konfliktlösungsmechanismus beruht auf der Idee, dass der Krieg ein Instrument der Politik ist, eine Form des Dialogs zwischen Staaten. Er wird eingesetzt, wenn friedliche Mittel zur Konfliktlösung versagt haben oder wenn die Ziele nicht mit anderen Mitteln erreicht werden können. In dieser Perspektive setzen Staaten den Krieg ein, um ihre strategischen Ziele zu erreichen, sei es der Schutz ihrer territorialen Interessen, die Ausweitung ihres Einflusses oder die Stärkung ihrer Sicherheit. Diese Ziele werden in der Regel von einer klar definierten Militärstrategie geleitet, die darauf abzielt, die Wirksamkeit des Einsatzes von Gewalt zu maximieren und gleichzeitig Verluste und Kosten zu minimieren.
Carl von Clausewitz' Ansatz zum Krieg[modifier | modifier le wikicode]
Carl von Clausewitz, ein preußischer Offizier aus dem frühen 19. Jahrhundert, spielte eine entscheidende Rolle bei der Theoretisierung des Krieges. Er verfasste das Werk "Vom Kriege" (Vom Kriege auf Deutsch), das zu einem der einflussreichsten Texte über Militärstrategie und Kriegstheorie wurde.
Carl von Clausewitz diente während der Napoleonischen Kriege, die von 1803 bis 1815 stattfanden, in der preußischen Armee. Während dieser Zeit sammelte er wertvolle Erfahrungen im Kampf und in der Militärstrategie, die seine Kriegstheorien beeinflussten. Clausewitz nahm an mehreren großen Schlachten gegen Napoleons Armee teil und wurde Zeuge der dramatischen Veränderungen in der Art und Weise, wie Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts geführt wurden. Während dieser Zeit begann er, seine Theorie zu entwickeln, dass der Krieg eine Erweiterung der Politik ist. Nach dem Ende der napoleonischen Kriege diente Clausewitz weiterhin in der preußischen Armee und begann, sein Hauptwerk "Vom Kriege" zu verfassen. Er starb jedoch, bevor er das Werk fertigstellen konnte, das posthum von seiner Frau veröffentlicht wurde.
Clausewitz behauptete, dass der Krieg "die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" sei. Dieses wohl bekannteste Zitat von Clausewitz drückt den Gedanken aus, dass der Krieg ein Instrument der nationalen Politik ist und dass militärische Ziele von politischen Zielen geleitet werden müssen. Mit anderen Worten: Der Krieg ist ein politisches Instrument und kein Selbstzweck. Clausewitz' Denken betont auch die Bedeutung des "Nebels des Krieges" und der "Reibung" bei der Durchführung von Militäroperationen. Er argumentiert, dass der Krieg von Natur aus unsicher und unvorhersehbar ist und dass Kommandanten und Strategen in der Lage sein müssen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Trotz seines Todes im Jahr 1831 übte Clausewitz' Denken weiterhin einen großen Einfluss auf die Militär- und Strategietheorie aus. Seine Werke werden an Militärakademien auf der ganzen Welt studiert und bleiben eine unverzichtbare Referenz im Bereich der Militärstrategie.
Clausewitz definiert Krieg als einen Gewaltakt, der den Gegner dazu zwingen soll, unseren Willen auszuführen. Dies ist ein sehr rationaler Rahmen, es handelt sich nicht um die Logik eines "Kriegsverrückten". Der Krieg wird geführt, um etwas zu erreichen. Carl von Clausewitz hat den Krieg als einen Gewaltakt konzeptualisiert, dessen Ziel es ist, den Gegner zu zwingen, unseren Willen auszuführen. Seiner Meinung nach ist der Krieg kein irrationales oder chaotisches Unterfangen, sondern vielmehr ein Instrument der Politik, ein rationales Mittel zur Verfolgung der Ziele eines Staates. In seinem Hauptwerk "Vom Kriege" entwickelt Clausewitz diesen Gedanken weiter, indem er feststellt, dass der Krieg lediglich die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Das heißt, Staaten setzen den Krieg ein, um politische Ziele zu erreichen, die sie mit friedlichen Mitteln nicht durchsetzen können.
Stellen wir uns einen Staat vor, der eine Regierung mit dem Ziel ist, fruchtbares Land zu erwerben, um seine Wirtschaft oder seine Ernährungssicherheit zu verbessern. Da sein Nachbar nicht bereit ist, dieses Land freiwillig abzutreten, entscheidet sich der Staat für den Einsatz von Krieg, um sein Ziel zu erreichen. Wenn der kriegsführende Staat siegreich ist, wird wahrscheinlich ein Friedensvertrag geschlossen, der die Landübertragung offiziell festschreibt. Dieser Vertrag könnte auch andere Bestimmungen enthalten, z. B. Kriegsentschädigungen, Regelungen für vertriebene Bevölkerungsgruppen und das Versprechen, in Zukunft keine Aggressionen zu zeigen. Das ursprüngliche Ziel (der Erwerb von fruchtbarem Land) wird also mithilfe von Krieg erreicht, der als politisches Instrument eingesetzt wird.
Diese von Clausewitz geprägte Auffassung von Krieg macht deutlich, dass der Krieg eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. In diesem Zusammenhang wird der Krieg als ein Werkzeug der Politik betrachtet, eine Option, die eingesetzt werden kann, wenn andere Methoden wie Diplomatie oder Handel bei der Lösung von Konflikten zwischen Staaten versagt haben.
Es ist entscheidend zu verstehen, dass der Krieg nach Clausewitz keine eigenständige Einheit ist, sondern vielmehr ein Instrument der Politik, das von den politischen Behörden kontrolliert und gesteuert wird. Das heißt, dass sowohl die Entscheidung, einen Krieg zu erklären, als auch die Verwaltung und Führung des Krieges in der Verantwortung der politischen Führer liegen. Die militärischen Ziele sind somit den politischen Zielen untergeordnet. Im clausewitzschen Denken ist der Krieg ein Mittel, um politische Ziele zu erreichen, die mit anderen Methoden nicht erreicht werden können. Er wird jedoch immer als vorübergehende Lösung und nicht als Dauerzustand betrachtet. Der Krieg ist also kein Zweck an sich, sondern ein Mittel zum Zweck: das vom Staat definierte politische Ziel. Sobald dieses Ziel erreicht ist oder wenn es nicht mehr möglich ist, es zu erreichen, endet der Krieg und man kehrt zu einem Zustand des Friedens zurück. Aus diesem Grund ist der Begriff des Friedens untrennbar mit dem des Krieges verbunden: Der Krieg zielt darauf ab, einen neuen, für den Staat, der ihn führt, günstigeren Friedenszustand zu schaffen.
Das westfälische System[modifier | modifier le wikicode]
Das Westfälische System, benannt nach dem Westfälischen Friedensvertrag, der 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete, hat die internationale politische Struktur und das Verständnis von Krieg tiefgreifend beeinflusst. Diese Reihe von Verträgen verankerte den Begriff der staatlichen Souveränität und legte die Vorstellung fest, dass jeder Staat die ausschließliche Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung ohne Einmischung von außen besitzt. Damit formalisierte es auch die Idee der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Was den Krieg betrifft, so hat das westfälische System dazu beigetragen, ihn als eine Aktivität zwischen Staaten und nicht zwischen Fraktionen oder Individuen zu formalisieren. Es förderte auch die Entwicklung von Regeln und Normen für die Kriegsführung, obwohl dieser Prozess erst in den folgenden Jahrhunderten mit der Entwicklung des humanitären Völkerrechts so richtig in Schwung kam. Während der Krieg also weiterhin als Instrument der Außenpolitik angesehen wurde, begann das westfälische System damit, Beschränkungen und Regeln für seine Anwendung einzuführen. Diese Zwänge wurden durch die Entwicklung des Völkerrechts in den folgenden Jahrhunderten noch verstärkt.
Hugo Grotius, auch bekannt als Hugo de Groot, war eine zentrale Figur bei der Entwicklung des Völkerrechts, insbesondere im Hinblick auf die Gesetze von Krieg und Frieden. Sein bekanntestes Werk, "De Jure Belli ac Pacis" ("Vom Recht des Krieges und des Friedens"), das 1625 veröffentlicht wurde, gilt als einer der grundlegenden Texte des Völkerrechts. In diesem Werk versucht Grotius, eine Reihe von Regeln für das Verhalten von Staaten in Kriegs- und Friedenszeiten festzulegen. Er untersucht ausführlich, wann ein Krieg gerechtfertigt ist (jus ad bellum), wie er geführt werden sollte (jus in bello) und wie nach einem Konflikt ein gerechter Frieden wiederhergestellt werden kann (jus post bellum).
Diese Ideen hatten einen bedeutenden Einfluss darauf, wie der Krieg wahrgenommen und geführt wird, indem sie die Vorstellung einführten, dass selbst in Kriegszeiten bestimmte Handlungen nicht akzeptabel sind und dass die Kriegsführung bestimmten ethischen und rechtlichen Grundsätzen unterliegen muss. Die von Grotius aufgestellten Grundsätze wurden im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt und ausgebaut und führten zur Formulierung detaillierterer und umfassenderer internationaler Konventionen wie den Genfer Konventionen, die heute das Verhalten in Kriegszeiten regeln.
Die Organisation des zwischenstaatlichen Systems hat dazu geführt, dass strenge Regeln zur Regulierung der Kriegsführung erlassen wurden. Ziel dieser Regeln ist es, die zerstörerischen Folgen des Krieges so weit wie möglich zu begrenzen und Personen zu schützen, die nicht direkt am Krieg beteiligt sind, wie z. B. Zivilisten oder Kriegsgefangene. Aus diesem Grund muss ein Krieg nach internationalem Recht vor seinem Beginn erklärt werden. Diese Erklärung soll allen beteiligten Parteien, einschließlich anderer Länder und internationaler Organisationen, klar signalisieren, dass ein bewaffneter Konflikt begonnen hat. Während eines Krieges müssen sich die Kombattanten an bestimmte Regeln halten. So dürfen sie beispielsweise nicht absichtlich Zivilisten oder zivile Gebäude wie Schulen oder Krankenhäuser ins Visier nehmen oder Waffen einsetzen, die nach dem Völkerrecht verboten sind, wie chemische oder biologische Waffen. Schließlich muss nach einem Krieg ein Friedensprozess in Gang gesetzt werden, um Streitigkeiten zu lösen, Kriegsverbrechen zu bestrafen und die durch den Konflikt verursachten Schäden zu beheben. Obwohl diese Regeln oft verletzt werden, ist ihre Existenz und universelle Anerkennung ein wichtiger Versuch, eine Tätigkeit zu zivilisieren, die von Natur aus gewalttätig und zerstörerisch ist.
Der Krieg wurde trotz seiner oft verheerenden Folgen als Mittel zur Lösung politischer Streitigkeiten in das zwischenstaatliche System integriert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es nicht darum geht, den Krieg zu fördern oder zu verherrlichen, sondern vielmehr darum, zu versuchen, ihn einzudämmen und zu regulieren. Seit dem 17. Jahrhundert wurden zahlreiche Regeln aufgestellt, die versuchen, die Verheerungen des Krieges zu begrenzen. Dazu gehört das humanitäre Völkerrecht, das Grenzen für die Art und Weise setzt, wie Krieg geführt werden kann, und Personen schützt, die nicht oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, wie Zivilisten, Gesundheitsarbeiter und Kriegsgefangene. Darüber hinaus hat das Völkerrecht auch Regeln dafür aufgestellt, wie man einen Krieg erklärt, Feindseligkeiten führt und Frieden schließt. Dazu gehören das Kriegsrecht, das Regeln für die Durchführung von Feindseligkeiten aufstellt, und das Friedensrecht, das den Abschluss von Friedensverträgen und die Lösung internationaler Konflikte regelt. Diese Bemühungen zur Regulierung des Krieges zeugen von der Erkenntnis, dass ein Krieg zwar manchmal unvermeidlich sein kann, aber auf eine Art und Weise geführt werden muss, die menschliches Leid und materielle Zerstörung so weit wie möglich minimiert.
Der Westfälische Friedensvertrag, der 1648 zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges geschlossen wurde, bestand aus zwei verschiedenen Abkommen: dem Vertrag von Osnabrück und dem Vertrag von Münster. Der Vertrag von Osnabrück wurde zwischen dem Schwedischen Reich und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation geschlossen, während der Vertrag von Münster zwischen dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und den Vereinigten Provinzen (den heutigen Niederlanden) sowie zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich geschlossen wurde. Diese Verträge sind historisch wichtig, da sie den Grundstein für die moderne internationale Ordnung legten, die auf der Souveränität der Staaten beruht. Der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten wurde ebenso festgelegt wie der Grundsatz des Machtgleichgewichts. Der Westfälische Friedensvertrag bedeutete im Grunde das Ende der Idee eines universellen christlichen Reiches in Europa und ebnete den Weg für ein System unabhängiger und souveräner Nationalstaaten.
Die Westfälischen Verträge beendeten den Dreißigjährigen Krieg, einen Religionskrieg, der Europa und insbesondere das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zwischen 1618 und 1648 auseinanderriss. In diesem Krieg standen sich vor allem katholische und protestantische Kräfte gegenüber, obwohl Politik und Machtkämpfe ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Durch die Beendigung dieses Krieges brachten die Westfälischen Verträge nicht nur einen willkommenen Frieden, sondern markierten auch einen grundlegenden Wandel in der politischen Organisation Europas. Vor diesen Verträgen war die Idee eines universellen christlichen Reiches, in dem eine höhere Autorität (entweder der Papst oder der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches) eine gewisse Autorität über Königreiche und Fürstentümer haben sollte, noch lebendig. Die Westfälischen Verträge legten den Grundsatz der staatlichen Souveränität fest und besagen, dass jeder Staat die absolute und ausschließliche Autorität über sein Territorium und sein Volk besitzt. Das bedeutete, dass zum ersten Mal Staaten und nicht Kaiser oder Päpste zu den Hauptakteuren auf der internationalen Bühne wurden. Dies wird als das "westfälische System" bezeichnet, das nach wie vor die Grundlage der modernen internationalen Ordnung bildet.
Die Schweiz wurde 1648 im Westfälischen Friedensvertrag als unabhängige Einheit anerkannt, obwohl es länger dauerte, bis sich ihre heutige Form als Staat konsolidierte. Die immerwährende Neutralität der Schweiz wurde auch auf dem Wiener Kongress 1815 festgelegt, was ihren eigenständigen Status auf der internationalen Bühne stärkte. Dennoch ist zu beachten, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft als Union der Kantone bereits vor dem Westfälischen Friedensvertrag existierte. Ihre einzigartige Struktur entsprach jedoch nicht genau dem Konzept des Nationalstaats, wie er mit dem westfälischen System entstand. Daher kann man sagen, dass es lange gedauert hat, bis die Schweiz in ihrer modernen Form auftauchte.
Der Westfälische Friedensvertrag legte den Grundstein für das moderne internationale System, das auf nationaler Souveränität beruht. Mit anderen Worten: Jeder Staat hat das Recht, sein Hoheitsgebiet nach eigenem Ermessen ohne Einmischung von außen zu regieren. Dieses Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ist ein zentraler Pfeiler des internationalen Systems. Es beseitigt jedoch nicht den Konflikt oder die Meinungsverschiedenheit zwischen Staaten. Wenn eine Meinungsverschiedenheit auftritt, kann Krieg als Mittel zur Lösung eingesetzt werden. In der modernen Welt werden jedoch in der Regel andere Formen der Konfliktlösung wie Diplomatie, Dialog und Verhandlungen bevorzugt. Krieg wird oft als letztes Mittel angesehen, wenn keine andere Option praktikabel oder wirksam ist.
Die Unterscheidung zwischen dem inneren und dem äußeren Raum der Staaten ist in der internationalen Politik von grundlegender Bedeutung. Innerhalb seiner Grenzen hat ein Staat die Souveränität, seine eigenen Gesetze und Vorschriften durchzusetzen und die Ordnung so aufrechtzuerhalten, wie er es für notwendig erachtet. Dieser innere Raum ist häufig durch einen Satz klar definierter Regeln und Normen gekennzeichnet, die weithin anerkannt und eingehalten werden. Außerhalb seiner Grenzen muss sich ein Staat in einem komplexeren und oft weniger regulierten Umfeld bewegen, in dem die Interaktionen hauptsächlich zwischen souveränen Staaten stattfinden, die möglicherweise unterschiedliche Interessen haben. Dieser äußere Raum wird durch das Völkerrecht geregelt, das weniger verbindlich ist und stärker von der Zusammenarbeit zwischen Staaten abhängt.
Der Grundsatz der Souveränität begründet zwar die formale Gleichheit aller Staaten im Völkerrecht, führt aber nicht zwangsläufig zu einer tatsächlichen Gleichheit auf der internationalen Bühne. Einige Staaten können aufgrund ihrer wirtschaftlichen, militärischen oder strategischen Macht einen unverhältnismäßig großen Einfluss ausüben. Gleichzeitig hat der Aufstieg nichtstaatlicher Akteure die internationale Landschaft komplexer gemacht. Nichtregierungsorganisationen (NGOs), multinationale Unternehmen und sogar Einzelpersonen (wie Aktivisten, politische Dissidenten oder Prominente) können nun bedeutende Rollen in der internationalen Politik spielen. Diese Akteure können die globale Politik beeinflussen, indem sie die öffentliche Meinung mobilisieren, direkte Aktionen durchführen, grundlegende Dienstleistungen erbringen oder wirtschaftliche Macht ausüben. Doch trotz des wachsenden Einflusses dieser nichtstaatlichen Akteure bleiben die Staaten die wichtigsten und mächtigsten Akteure auf der internationalen Bühne.
Im zeitgenössischen internationalen System ist der Staat die grundlegende politische Einheit. Das Konzept des souveränen Nationalstaats bleibt, obwohl es kritisiert und oft durch Fragen des Transnationalismus, der Globalisierung und der interdependenten internationalen Beziehungen verkompliziert wird, der wichtigste Organisator der Weltpolitik. Von jedem Staat als souveränem Gebilde wird erwartet, dass er absolute Autorität über sein Territorium und seine Bevölkerung ausübt. Das internationale System beruht auf der Interaktion dieser souveränen Staaten und der Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Realität oftmals komplexer ist. Viele nichtstaatliche Akteure - von multinationalen Konzernen über terroristische Gruppen bis hin zu Nichtregierungsorganisationen und internationalen Institutionen - spielen ebenfalls eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne. Manchmal können diese Akteure sogar die Autorität und Souveränität von Staaten in Frage stellen. Doch trotz dieser Herausforderungen bleibt die Idee des Nationalstaats zentral für das Verständnis und die Strukturierung unserer politischen Welt.
Man spricht nicht von "Weltstudien" oder "globalen Studien". Der Begriff, der sich durchgesetzt hat, ist der der "Internationalen Beziehungen". Das Studienfeld "Internationale Beziehungen" konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Staaten und, im weiteren Sinne, zwischen Akteuren auf der Weltbühne. Es geht nicht einfach darum, die Welt als Ganzes zu studieren, sondern zu verstehen, wie Staaten miteinander interagieren, wie sie Macht aushandeln und herausfordern, wie sie zusammenarbeiten und in Konflikte geraten. Die Betonung liegt auf "Beziehungen", denn über diese Beziehungen definieren sich die Staaten gegenseitig, gestalten ihre Außenpolitik und beeinflussen das internationale System. Daher bleiben der Nationalstaat und die Staatsgrenze trotz der zunehmenden Interdependenz und Globalisierung Schlüsselbegriffe in der Theorie und Praxis der internationalen Beziehungen. Tatsächlich ist die Strukturierung des Raums zwischen Staaten eine grundlegende Dimension in der Analyse der internationalen Beziehungen. Es ist diese Strukturierung, die unter anderem Bündnisse, Konflikte, Handel und Bevölkerungsströme bestimmt. Sie ist es auch, die einen bedeutenden Einfluss auf die Weltordnungspolitik und die Entwicklung internationaler Normen hat.
Der 1648 unterzeichnete Westfälische Friedensvertrag legte den Grundstein für die moderne internationale Ordnung, die auf dem Prinzip der nationalen Souveränität beruht. Nach diesem Prinzip hat jeder Staat das Recht, sein eigenes Territorium und seine eigene Bevölkerung ohne Einmischung von außen zu regieren. Souveräne Gleichheit bedeutet, dass aus der Sicht des Völkerrechts alle Staaten gleich sind, unabhängig von ihrer Größe, ihrem Reichtum oder ihrer Macht. Das bedeutet, dass jeder Staat das Recht hat, in vollem Umfang an der internationalen Gemeinschaft teilzunehmen und von anderen Staaten respektiert zu werden.
Doch auch wenn der Westfälische Friedensvertrag Souveränität und souveräne Gleichheit als grundlegende Prinzipien des internationalen Systems etabliert hat, darf man daraus nicht ableiten, dass Krieg eine unvermeidliche Folge dieser Prinzipien ist. Denn auch wenn Streitigkeiten zwischen Staaten zu bewaffneten Konflikten führen können, ist der Krieg weder die einzige noch die am meisten gewünschte Art der Streitbeilegung. Die Grundsätze des Völkerrechts, wie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, sind auch für die aus Westfalen hervorgegangene internationale Ordnung zentral. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahrhunderte internationale Normen und Institutionen entwickelt, die die Kriegsführung einrahmen und regulieren und den Dialog, die Verhandlungen und die Zusammenarbeit zwischen Staaten fördern. Das Westfälische System ist daher nicht einfach eine Lizenz zum Krieg, sondern der Rahmen, in dem Staaten koexistieren, zusammenarbeiten und manchmal auch gegeneinander kämpfen.
Vom Totalen Krieg zum Institutionalisierten Krieg (Holsti)[modifier | modifier le wikicode]
Jahrhundert war eine Zeit bedeutender Veränderungen in der politischen und sozialen Organisation vieler Länder, die zur Entstehung des modernen Staates führten. In dieser Zeit begannen die Staaten, ihre Macht zu konsolidieren, die Autorität zu zentralisieren, systematisch Steuern zu erheben und effizientere und strukturierte Bürokratien zu entwickeln. Diese Zentralisierung und Bürokratisierung ermöglichte es den Staaten, Ressourcen anzuhäufen und diese effektiver zu mobilisieren, insbesondere um Kriege zu führen. Als die Staaten mächtiger und effizienter wurden, waren sie in der Lage, Kriege in größerem Umfang und mit größerer Intensität zu führen. Dies ebnete den Weg für den sogenannten "totalen Krieg", bei dem alle Aspekte der Gesellschaft für die Kriegsanstrengungen mobilisiert werden und die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten verschwimmt. Parallel zu diesen Veränderungen entwickelte sich auch das internationale System weiter, wobei sich das westfälische System auf der Grundlage der Souveränität der Staaten etablierte. Diese beiden Prozesse - die Entwicklung des Staates und die Veränderung des internationalen Systems - verstärkten sich gegenseitig. Die Konsolidierung des Staates trug zum Aufschwung des westfälischen Systems bei, während das westfälische System den Rahmen dafür bot, dass sich Staaten entwickeln und stärken konnten.
Während der moderne Staat durch die Schaffung einer internen sozialen Ordnung und eines Monopols über die legitime Anwendung von Gewalt wesentlich zum Rückgang der zwischenmenschlichen Gewalt beigetragen hat, hat die Zunahme seiner Fähigkeit, Ressourcen zu mobilisieren und zu konzentrieren, auch zur Möglichkeit von Konflikten in größerem Maßstab geführt, oft mit verheerenden Folgen. Im Kontext der internationalen Beziehungen hat das westfälische System ein Umfeld geschaffen, in dem Staaten, die ihre Interessen schützen und ihre Sicherheit gewährleisten wollen, auf den Krieg als Mittel zur Lösung ihrer Streitigkeiten zurückgreifen können. Diese Entwicklung führte zu immer zerstörerischeren Kriegen, die in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts gipfelten.
Die Entwicklung der Normen und Regeln für den Krieg führte zu einer klareren Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, wobei man sich bemühte, letztere vor den direkten Auswirkungen des Krieges zu schützen. Diese Idee wurde im humanitären Völkerrecht, insbesondere in den Genfer Konventionen, kodifiziert. Im Mittelalter war die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten nicht immer klar, und Zivilisten waren oft direkt vom Krieg betroffen. Mit der Entwicklung des modernen Staates und der Kodifizierung des Krieges entstand jedoch eine Norm, nach der Zivilisten in Konflikten so weit wie möglich geschont werden sollten. Abgesehen davon wird die Unterscheidung in der Theorie zwar mittlerweile weitgehend anerkannt und respektiert, in der Praxis aber leider oft ignoriert. In vielen zeitgenössischen Konflikten kam es zu schweren Verstößen gegen diese Norm, mit vorsätzlichen Angriffen auf Zivilisten und massivem Leid für die nicht kämpfende Bevölkerung.
Ab dem 17. Jahrhundert, mit dem Aufstieg des Nationalstaats und der Professionalisierung der Armeen, kam es zu einer Verringerung der direkten Auswirkungen von Kriegen auf die Zivilbevölkerung. Die Kämpfer - in der Regel Berufssoldaten - wurden zu den Hauptteilnehmern und -opfern von Kriegen. Dieser Trend kehrte sich jedoch im Laufe des 20. Jahrhunderts um, insbesondere mit den beiden Weltkriegen und anderen großen Konflikten, in denen Zivilisten häufig als Zielscheibe oder als Kollateralopfer eingesetzt wurden. Dies hat sich nach dem Ende des Kalten Krieges mit dem Anstieg innerstaatlicher Konflikte und nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen noch verstärkt. In diesen Konflikten werden Zivilisten oft direkt ins Visier genommen und stellen die Mehrheit der Opfer.
Die Entstehung des modernen Krieges ist untrennbar mit der Entstehung des Nationalstaats verbunden. Im Mittelalter waren Konflikte durch fließende Strukturen und Fraktionen gekennzeichnet, die Stadtstaaten, religiöse Orden wie das Papsttum, Kriegsherren und andere Gruppen umfassten, die ihre Bündnisse je nach ihren aktuellen Interessen häufig wechselten. Es war eine Zeit, in der Gewalt allgegenwärtig war, doch die Grenzen der Konflikte waren oft fließend und veränderlich. Mit dem Aufstieg des Nationalstaats änderte sich das Wesen des Krieges erheblich. Die Staaten begannen, Armeen aus Soldaten aufzustellen, die an ihren Uniformen erkennbar waren und als Vertreter des Staates auf dem Schlachtfeld dienten. Ob diese Soldaten nun bezahlte Berufssoldaten oder zum Militärdienst mobilisierte Wehrpflichtige waren, sie symbolisierten die Fähigkeit und Autorität des Staates, Gewalt zu projizieren und seine Interessen zu verteidigen. Der Krieg wurde so zu einer Erweiterung der zwischenstaatlichen Beziehungen und der Politik des Staates mit klarer definierten Regeln und Konventionen.
Vom Totalen Krieg zum Institutionalisierten Krieg (Holsti)[modifier | modifier le wikicode]
Der Westfälische Friede schuf ein neues politisches System, das als westfälisches System bekannt ist und die Idee souveräner Nationalstaaten formalisierte. In diesem System wurde der Krieg zu einem institutionalisierten Instrument zur Lösung von Konflikten zwischen Staaten. Statt einer Reihe von kontinuierlichen, chaotischen Scharmützeln wurde der Krieg zu einem erklärten und anerkannten Zustand des offenen Konflikts zwischen souveränen Staaten. Dies führte auch zur Entstehung von Kriegsregeln und -konventionen, die darauf abzielten, die zerstörerischen Auswirkungen des Konflikts zu begrenzen und die Rechte der Kombattanten und der Zivilbevölkerung zu schützen. Diese Regeln wurden in internationalen Verträgen und Konventionen wie den Genfer Konventionen formalisiert.
K. J. Holsti unterscheidet in seinem Buch "The State, War, and the State of War" (1996) zwischen zwei Arten von Kriegen. Die "Typ-1-Kriege", die er definiert, sind die traditionellen Kriege zwischen Staaten, die seit dem Westfälischen Friedensvertrag bis zum Ende des Kalten Krieges die Norm waren. Diese Konflikte sind in der Regel klar definiert, mit formellen Kriegserklärungen, eindeutigen militärischen Fronten und einem Ende der Feindseligkeiten, das häufig durch Friedensverträge markiert wird. Im Gegensatz dazu sind "Typ-2-Kriege" laut Holsti die modernen Kriege, die tendenziell viel chaotischer und weniger klar definiert sind. An ihnen können nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen, Milizen oder Banden beteiligt sein. Diese Konflikte können innerhalb der Grenzen eines Staates ausbrechen, statt zwischen verschiedenen Staaten, und sie können Jahrzehnte dauern, mit ständiger Gewalt statt einem klar definierten Anfang und Ende.
Die Zeit zwischen 1648 und 1789 wird oft als die Ära des "begrenzten Krieges" oder des "Kabinettskrieges" bezeichnet. Diese Kriege hatten in der Regel klare und begrenzte Ziele. Sie wurden oft aus bestimmten Gründen geführt, wie z. B. um die Kontrolle über bestimmte Gebiete zu erlangen oder um bestimmte Streitigkeiten zwischen Staaten zu lösen. Diese Kriege wurden in der Regel von Berufsarmeen unter der direkten Kontrolle der Regierung des Staates geführt, daher der Begriff "Kabinettskrieg". Die Idee war, den Krieg als Instrument zur Erreichung bestimmter politischer Ziele zu nutzen, anstatt die vollständige Vernichtung des Feindes anzustreben. Dies entspricht der clausewitzschen Auffassung von Krieg als "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Diese Kriege waren in der Regel gut strukturiert, mit formellen Kriegserklärungen, akzeptierten Verhaltensregeln und letztlich Friedensverträgen, um den Konflikt formell zu lösen. Dies spiegelt den Grad der Formalisierung und Institutionalisierung des Kriegsbegriffs während dieser Periode wider. Dies begann sich jedoch mit den revolutionären und napoleonischen Kriegen im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert zu ändern, die durch Massenmobilisierung und ein viel größeres Maß an Zerstörung gekennzeichnet waren. Diese Kriege ebneten den Weg für die Ära der "totalen Kriege" im 20.
In dieser Periode der Geschichte, die im Allgemeinen zwischen dem Westfälischen Frieden von 1648 und der Französischen Revolution von 1789 liegt, kam es zu einer bedeutenden Kodifizierung der militärischen Strukturen und der Regeln des Krieges. Ein Zeichen dieser Kodifizierung ist das Aufkommen von unverwechselbaren Uniformen. Die Uniformen halfen, die Kriegsparteien auf dem Schlachtfeld eindeutig zu identifizieren, und trugen zu einem gewissen Maß an Disziplin und Ordnung bei. In dieser Zeit kam es auch zum Aufstieg dessen, was man als professionelle "Militärkultur" bezeichnen könnte. Die Armeen dieser Zeit wurden häufig von Mitgliedern des Adels befehligt, die in der Kriegskunst ausgebildet waren und den Militärdienst als Erweiterung ihrer sozialen und politischen Verpflichtungen betrachteten. In dieser Zeit entstand oft der "Schwertadel", eine Adelsklasse, die ihren Status und ihr Ansehen aus ihrem Dienst in der Armee bezog. Gleichzeitig wurden die Regeln des Krieges kodifiziert, was dazu führte, dass den Rechten von Kriegsgefangenen, der diplomatischen Immunität und anderen Aspekten des Kriegsrechts mehr Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Diese Verhaltenskodizes wurden durch internationale Verträge und Konventionen gestärkt, wodurch die Grundlage für das moderne Völkerrecht geschaffen wurde.
In dieser Periode der Geschichte waren Kriege in der Regel durch begrenzte Ziele und relativ kurze Verpflichtungen gekennzeichnet. Die Kriegsparteien versuchten oft, bestimmte strategische Ziele zu erreichen, wie z. B. die Eroberung eines bestimmten Gebiets oder einer bestimmten Festung, und nicht die vollständige Vernichtung des Feindes. Diese Konflikte waren häufig durch einen "Manöverkrieg" gekennzeichnet, bei dem die Armeen versuchten, einen strategischen Vorteil durch Bewegung und Stellung statt durch Frontalkampf zu erlangen. Schlachten waren oft eher die Ausnahme als die Regel, und viele Konflikte endeten eher mit Verhandlungen als mit einem vollständigen militärischen Sieg. Diese Art der Kriegsführung war zum Teil eine Folge der logistischen Zwänge der damaligen Zeit. Armeen waren oft nur begrenzt in der Lage, ihre Truppen mit Nahrung, Wasser und Munition zu versorgen, was die Dauer und den Umfang militärischer Einsätze begrenzte.
In dieser Zeit des begrenzten Krieges war das Ziel nicht die vollständige Vernichtung des Gegners, sondern vielmehr das Erreichen bestimmter strategischer Ziele. Die Schlachten wurden oft sorgfältig inszeniert und die Armeen versuchten, den unnötigen Verlust von Menschenleben so gering wie möglich zu halten. Der Schwerpunkt lag auf Strategie und Taktik, nicht auf wahlloser Zerstörung. Die Zivilbevölkerung wurde in der Regel verschont, was zum Teil daran lag, dass der Krieg als eine Angelegenheit zwischen Staaten und nicht zwischen Völkern betrachtet wurde. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Zivilbevölkerung nie betroffen war. Die durch Kriege verursachten Störungen konnten zu Hungersnöten, Epidemien und anderen Formen von Leid für die Zivilbevölkerung führen.
Der Spanische Erbfolgekrieg (1701-1714) ist ein gutes Beispiel für einen Krieg aus dieser Zeit. Er wurde durch den Tod von König Karl II. von Spanien ohne direkten Erben ausgelöst. In diesem Konflikt standen sich die europäischen Großmächte gegenüber, die versuchten, die spanische Thronfolge zu kontrollieren und im weiteren Sinne ihren Einfluss und ihre Macht in Europa zu vergrößern. Der Krieg war zeitlich begrenzt, und obwohl er brutal war und Menschenleben kostete, wurde er durch akzeptierte Regeln und Konventionen geregelt, die seine Intensität und seinen Umfang begrenzten. Beispielsweise wurden die Schlachten in der Regel von regulären Armeen geführt, und Zivilisten blieben weitgehend verschont. Dennoch war dieser Krieg im Hinblick auf die geopolitischen Veränderungen bedeutsam. Er sah den Aufstieg Großbritanniens zur Macht und markierte einen Wendepunkt im Gleichgewicht der Mächte in Europa. Er führte auch zum Vertrag von Utrecht im Jahr 1713, der die Grenzen neu definierte und nachhaltige Auswirkungen auf die europäische Politik hatte.
Die Zeit vom Ende des 17. bis zum 18. Jahrhundert ist durch eine allmähliche Kodifizierung der Armeen gekennzeichnet. Diese Kodifizierung deckt viele Aspekte der militärischen Führung ab. Die Struktur der Armeen begann sich mit der Einführung klar definierter Hierarchien und spezifischer militärischer Rollen zu formalisieren. Dies ermöglichte eine bessere Organisation und Koordination der Streitkräfte. Die Kodifizierung der Uniformen, war ein weiterer wichtiger Aspekt. Militärische Uniformen unterschieden nicht nur Soldaten von Zivilisten, sondern ermöglichten es auch, Verbündete von Feinden zu unterscheiden und den Rang und die Rolle eines jeden Soldaten zu identifizieren. Auch das Verhalten auf dem Schlachtfeld wurde reguliert. Es wurden spezielle Regeln für das Handeln in Kriegszeiten aufgestellt, darunter auch die Behandlung von Kriegsgefangenen und das Verhalten gegenüber Zivilisten. Diese Kodifizierung der Armeen war ein wesentlicher Bestandteil der Bildung moderner Nationalstaaten. Sie ermöglichte eine effizientere und besser organisierte Kriegsführung, schränkte bestimmte Formen der Gewalt ein und schützte Nichtkombattanten bis zu einem gewissen Grad.
Die Militäruniform spielt in dieser Zeit eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung und Organisation der Streitkräfte. Sie dient mehreren wichtigen Funktionen. Erstens dient sie der Identifizierung. Uniformen helfen, auf dem Schlachtfeld zwischen Verbündeten und Gegnern zu unterscheiden. Sie dienen auch dazu, den Rang und die Funktion des Einzelnen innerhalb der Armee zu identifizieren. Auf diese Weise wird in Konflikten, in denen die Situationen chaotisch und wechselhaft sein können, Klarheit geschaffen. Zweitens schafft die Uniform ein Gefühl der Einheit unter den Soldaten. Indem sie denselben Satz Kleidung tragen, fühlen sich die Soldaten miteinander verbunden und teilen eine gemeinsame Identität. Die Uniform symbolisiert ihre Loyalität gegenüber dem Staat und ihre Verpflichtung gegenüber der Sache, für die sie kämpfen. Zweitens fördert die Uniform Disziplin und Ordnung. Indem sie eine einheitliche Kleidung vorschreibt, stärkt die Armee ihre hierarchische und strukturierte Organisation. Sie ist eine ständige Erinnerung an die Strenge und Struktur, die das militärische Leben erfordert. Schließlich ist die Uniform auch ein Instrument zur Darstellung der Macht und des Prestiges des Staates. Sie ist häufig so gestaltet, dass sie den Gegner beeindruckt oder einschüchtert. Sie ist eine visuelle Aussage über die Stärke und das Potenzial des Staates. Die Vereinheitlichung der Militärkleidung begann ab dem 17. Jahrhundert, parallel zur Entwicklung des modernen Staates und stehender Armeen. Dieser Prozess wurde durch den technologischen Fortschritt beeinflusst, der die Massenproduktion von Kleidung ermöglichte, sowie durch die Notwendigkeit einer größeren Disziplin und Organisation innerhalb der Streitkräfte.
Der Krieg des Zweiten Typs oder der Totale Krieg: 1789 - 1815 und 1914 - 1945[modifier | modifier le wikicode]
Wenn man die Typologie von K.J. Holsti weiterführt, tauchen die Kriege des zweiten Typs mit den Revolutions- und Empirekriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf. Diese Konflikte unterscheiden sich erheblich von den Kriegen des ersten Typs aus dem 17. und 18.
Die Kriege des zweiten Typs, die auch als Massenkriege oder Napoleonische Kriege bezeichnet werden, zeichnen sich durch eine beispiellose Mobilisierung von menschlichen und materiellen Ressourcen aus. Sie werden durch den Willen zur Vernichtung des Feindes definiert, im Gegensatz zu den Kriegen des ersten Typs, die in erster Linie begrenzte politische Ziele erreichen wollten. Diese Kriege sind oft länger, teurer und zerstörerischer. Die Konflikte beschränken sich nicht mehr auf einzelne, abgegrenzte Schlachten, sondern erstrecken sich auf groß angelegte Militärkampagnen. Außerdem wird die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten immer unschärfer, da ganze Bevölkerungsgruppen in die Kriegsanstrengungen einbezogen werden, sei es durch Einberufung oder durch Unterstützung der Kriegsanstrengungen. Die Napoleonischen Kriege sind ein klassisches Beispiel für diese Art von Krieg, mit Millionen von Menschen, die in ganz Europa mobilisiert wurden, einer Serie von Konflikten, die über ein Jahrzehnt andauerte, und den daraus resultierenden großen politischen und territorialen Veränderungen.
Die Französische Revolution von 1789 markierte einen großen Wendepunkt in der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden. Mit dem Aufkommen der revolutionären Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wurde der Krieg mehr als nur ein Instrument der Staatspolitik. Er wird zu einem Ausdruck der kollektiven Bestrebungen und Ambitionen der Nation. Der Begriff der "Nation in Waffen" taucht in dieser Zeit zum ersten Mal auf. Dieser Begriff ist Teil der Idee einer vollständigen Mobilisierung der Bevölkerung für den Krieg. Es handelt sich nicht mehr nur um professionelle Kriegskünstler oder Söldner, die kämpfen, sondern um die gesamte Bevölkerung, einschließlich der normalen Bürger. Diese Bürger sind aufgerufen, zu den Waffen zu greifen, nicht nur um ihr Territorium zu verteidigen, sondern auch um die Idee der Nation selbst und die Prinzipien, auf denen sie beruht, zu verteidigen. Dies wird durch die Levée en masse ermöglicht, eine revolutionäre Maßnahme, die die Einberufung einer großen Zahl von Bürgern in die Armee ermöglicht. Diese Maßnahme ermöglichte es Frankreich, beträchtliche menschliche Ressourcen zu mobilisieren, um der Bedrohung durch die europäischen Mächte, die sich gegen Frankreich verbündet hatten, zu begegnen. Die Folge dieser neuen Herangehensweise an den Krieg war eine beispiellose Eskalation von Gewalt und Zerstörung sowie die zunehmende Einbeziehung von Zivilisten in den Konflikt. Dieser Trend wird sich in den folgenden zwei Jahrhunderten fortsetzen und intensivieren, insbesondere durch die beiden Weltkriege des 20.
Die Französische Revolution erschütterte die bestehende Ordnung in Europa. Traditionelle Monarchien, die von den revolutionären Ideen der Volkssouveränität und Demokratie bedroht wurden, bildeten Koalitionen, um zu versuchen, das Ancien Régime in Frankreich wiederherzustellen. Als Reaktion auf diese äußeren Bedrohungen beschlossen die revolutionären Führer Frankreichs, eine große Bürgerarmee aufzustellen. Dies war ein großer Bruch mit der Vergangenheit, in der die Armeen hauptsächlich aus Söldnern oder Berufstruppen bestanden hatten. Das 1793 verabschiedete Dekret über die Massenerhebung mobilisierte alle französischen Bürger im waffenfähigen Alter. Ziel war es, die Armeen der europäischen Monarchien, die in Frankreich einfielen, zurückzudrängen. Durch diese Massenmobilisierung wurde eine Armee aus mehreren Hunderttausend Soldaten gebildet, der es schließlich gelang, die Invasionen abzuwehren und die Revolution zu bewahren. Diese Massenerhebung gilt als die erste nationale Mobilisierung in der modernen Geschichte. Sie veränderte das Wesen des Krieges von einem begrenzten Konflikt zwischen professionellen Kriegern zu einem Kampf, der die gesamte Nation einbezog. Es veränderte auch das Verhältnis der Bürger zum Staat, da ihre Rolle nicht mehr nur darin bestand, zu gehorchen, sondern auch darin, die Nation und ihre Ideale aktiv zu verteidigen.
Der Übergang zu einer Wehrpflichtarmee erforderte einen modernen und organisierten Staat, der in der Lage war, seine Bevölkerung zu erfassen, Tausende von Soldaten schnell auszubilden und auszurüsten und die Kriegsanstrengungen langfristig zu unterstützen. Die Massenerhebung veränderte das Wesen des Krieges, da sie die Mobilisierung sehr großer Armeen ermöglichte. Unter Napoleon wuchs die französische Armee beispielsweise auf über 600.000 Mann an, eine für die damalige Zeit völlig neue Zahl. Dies erhöhte auch die Fähigkeit der Armee, Operationen an mehreren Fronten gleichzeitig durchzuführen. Allerdings erhöhte sich dadurch auch die Komplexität der militärischen Logistik, da eine viel größere Anzahl von Soldaten mit Lebensmitteln, Waffen und Munition versorgt werden musste. Dies erforderte daher einen effizienteren und organisierteren Staat, der in der Lage ist, diese groß angelegten Operationen zu planen und zu unterstützen. Dies führte auch zu einer Veränderung des Wesens des Krieges selbst. Mit so großen Armeen wurden die Schlachten zerstörerischer und führten zu einer höheren Zahl von Opfern. Der Krieg wurde zu einer Angelegenheit ganzer Nationen und bezog nicht nur die Soldaten, sondern auch die Zivilisten mit ein, die die Kriegsanstrengungen im Hintergrund unterstützten.
Die Einführung einer Wehrpflichtarmee erfordert einen modernen Staat, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens verfügt ein moderner Staat über eine effiziente Verwaltung. Diese Verwaltung ist notwendig, um die Bevölkerung zu erfassen und die Wehrpflicht zu verwalten. Die Rekruten zu identifizieren, zu registrieren, zu mobilisieren und auszubilden ist eine enorme Verwaltungsaufgabe, die eine effiziente Bürokratie erfordert. Zweitens muss der Staat über die logistische Kapazität verfügen, um eine große Armee zu unterstützen. Das bedeutet, dass er in der Lage sein muss, eine große Anzahl von Soldaten mit Nahrung, Kleidung, Waffen und Munition zu versorgen. Außerdem muss er die Fähigkeit haben, Verwundete zu versorgen. All diese Aufgaben erfordern eine starke logistische Infrastruktur. Drittens hat ein moderner Staat in der Regel eine Wirtschaft, die stark genug ist, um eine Wehrpflichtarmee zu tragen. Kriege sind teuer und man braucht einen Staat, der in der Lage ist, diese Ausgaben zu finanzieren. Schließlich erfordert die Massenerhebung einen gewissen sozialen Zusammenhalt und Solidarität. Der Staat muss die nötige Legitimität besitzen, um von seinen Bürgern zu verlangen, für ihn zu kämpfen und zu sterben. Dies ist in einem Nationalstaat, in dem die Bürger ein gemeinsames Zugehörigkeitsgefühl teilen, in der Regel leichter. Schließlich ist der Übergang zu einer Wehrpflichtarmee ein Ausdruck der Modernität eines Staates, der seine Fähigkeit veranschaulicht, Macht über seine Bürger auszuüben und seine Ressourcen zur Erreichung seiner Ziele zu mobilisieren.
Kriege des zweiten Typs nach Holsti's Typologie zeichnen sich durch groß angelegte Wehrpflichtarmeen aus und nicht mehr durch Berufsarmeen, die sich auf das Söldnerwesen stützen. Diese Kriege entstanden nach der Französischen Revolution und erreichten ihren Höhepunkt mit den Napoleonischen Kriegen. Die zugrunde liegende Idee ist, dass die gesamte Nation und nicht mehr eine Kriegerkaste oder eine Berufselite für den Krieg mobilisiert wird. Die Soldaten kämpfen nicht mehr für einen Lohn, sondern für die Verteidigung der Nation und ihrer Werte. Dies ist eine große Transformation des Wesens des Krieges, die ein viel höheres Maß an Engagement und Opferbereitschaft seitens der Bürger voraussetzt. Diese neue Form der Kriegsführung ermöglichte es, viel größere und schlagkräftigere Armeen als in der Vergangenheit aufzustellen, was zur napoleonischen Vorherrschaft in Europa beitrug. Darüber hinaus veränderten diese nationalistischen Armeen die Art und Weise, wie der Krieg von der Bevölkerung wahrgenommen und erlebt wurde. Der Krieg war nicht mehr eine Angelegenheit von Fachleuten, sondern eine Sache, für die jeder Bürger bereit war, sein Leben zu geben. Dies hatte auch erhebliche Auswirkungen auf die Art der Konflikte und das Ausmaß der Zerstörung und des menschlichen Verlusts, die sie mit sich bringen konnten.
Die ideologische Natur der Revolutionskriege führt zu einer Intensivierung der Konflikte. Im Gegensatz zu den sogenannten "traditionellen" Kriegen, bei denen die Ziele oft territorial oder materiell sind, neigen revolutionäre Kriege dazu, abstraktere und grundlegendere Ziele zu verfolgen. Es geht nicht mehr nur um den Gewinn von Territorium oder die Aneignung von Ressourcen, sondern um die Verteidigung einer Idee, eines Ideals oder sogar einer Identität. In diesem Zusammenhang ist der Feind nicht nur ein militärischer Gegner, sondern auch eine Bedrohung für die Existenz der Nation und ihrer Werte. Daher besteht das Ziel nicht nur darin, den Feind auf dem Schlachtfeld zu besiegen, sondern ihn vollständig zu vernichten, da seine bloße Existenz als Bedrohung wahrgenommen wird. Dies kann zu einer Eskalation der Gewalt und zu besonders tödlichen und zerstörerischen Kriegen führen. Auch die Tatsache, dass die gesamte Bevölkerung für den Krieg mobilisiert wird, trägt zur Eskalation von Konflikten bei, da sich jeder persönlich involviert fühlt und bereit ist, für die Sache Opfer zu bringen. Andererseits können diese Kriege von denjenigen, die sie führen, auch als legitimer oder gerechtfertigter empfunden werden, da sie für eine Sache kämpfen, an die sie zutiefst glauben, und nicht einfach nur für Macht oder Profit. Dies kann dazu beitragen, die nationale Einheit und die Entschlossenheit zum Kampf zu stärken.
Bei Kriegen der zweiten Art, wie z. B. Revolutionskriegen, ändert sich die Art der Ziele im Vergleich zu traditionelleren Konflikten erheblich. Die Ziele sind nicht mehr nur materiell, wie die Eroberung eines Territoriums oder die Kontrolle von Ressourcen, sondern werden ideologisch und abstrakt. Diese Ziele, wie "Befreiung", "Demokratie" oder "Klassenkampf", sind nicht nur unbegrenzt, sondern auch unscharf und subjektiv. Sie können nicht konkret gemessen oder erreicht werden, was es schwierig machen kann, das Ende des Konflikts zu definieren oder zu erreichen. Darüber hinaus können diese abstrakteren Ziele auch zu intensiveren und längeren Konflikten führen. Da diese Ziele oft als wesentlich für die Identität oder das Überleben einer Nation angesehen werden, sind die Kämpfer oft bereit, weiter zu gehen und höhere Risiken einzugehen, um sie zu erreichen. Schließlich können diese ideologischen Ziele auch den Abschluss eines Friedensabkommens erschweren. Da diese Ziele oft absolut und nicht verhandelbar sind, verlangen sie häufig eine bedingungslose Kapitulation des Gegners, was die Verhandlungen komplizierter machen und die Dauer von Konflikten verlängern kann.
Der Zweite Weltkrieg ist ein Paradebeispiel für den Begriff des "Krieges der zweiten Art". Das Hauptziel bestand nicht nur darin, Nazi-Deutschland militärisch zu besiegen, sondern auch die Nazi-Ideologie selbst zu beseitigen. In diesem Krieg ging es nicht einfach um Territorium oder Ressourcen, sondern um einen ideologischen Kampf. Das Ziel war nicht eine traditionelle Kapitulation, bei der die feindlichen Streitkräfte ihre Waffen niederlegen und nach Hause zurückkehren. Im Gegenteil, das Ziel war die vollständige Ausrottung des Nationalsozialismus als politisches und ideologisches System. Dies führte zu Forderungen der Alliierten nach einer "bedingungslosen Kapitulation", was bedeutete, dass die Nazis keine Möglichkeit hatten, über die Bedingungen ihrer Kapitulation zu verhandeln. Dies war im historischen Kontext der Konflikte eine ungewöhnliche Forderung, die den außergewöhnlichen und totalen Charakter dieses Krieges veranschaulichte. Darüber hinaus war Deutschland nach Kriegsende besetzt und geteilt, und es wurde ein "Entnazifizierungs"-Prozess eingeleitet, um den Nazi-Einfluss aus der deutschen Gesellschaft zu entfernen. Dies zeigte das Ausmaß des Engagements der Alliierten, nicht nur die militärische Bedrohung durch die Nazis, sondern auch die Nazi-Ideologie selbst zu beseitigen.
Der Übergang zu dieser Art des totalen Krieges ist eng mit der Entwicklung des Staates verknüpft. Mit der Entstehung des modernen Nationalstaats und des Nationalismus im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Krieg immer mehr zu einer Angelegenheit des ganzen Volkes, nicht nur des Militärs. In den totalen Kriegen des 20. Jahrhunderts, wie den beiden Weltkriegen, wurden alle Aspekte der Gesellschaft und der Wirtschaft für die Kriegsanstrengungen mobilisiert. Zivilisten wurden zu Kriegszielen, entweder direkt durch Bombardierungen oder indirekt durch Blockaden und Hungersnöte. Darüber hinaus wurde der Grund für diese Kriege oft in ideologischen oder existenziellen Begriffen ausgedrückt, wie etwa die Verteidigung der Demokratie gegen den Faschismus oder der Kampf um das Überleben der eigenen Nation. In diesem Zusammenhang war ein bloßer Sieg auf dem Schlachtfeld nicht ausreichend - der Feind musste vollständig besiegt und sein politisches und ideologisches System zerschlagen werden.
Das Nazi-Regime war in der Lage, an die Macht zu kommen und seine Gräueltaten in solch massivem Ausmaß zu begehen, was größtenteils auf die Infrastruktur und den Staatsapparat des damaligen Deutschlands zurückzuführen ist. Moderne staatliche Strukturen, die stark zentralisierte bürokratische, militärische und wirtschaftliche Institutionen umfassen, können potenziell für bösartige Zwecke missbraucht werden, wie es beim Nationalsozialismus in Deutschland der Fall war. Ohne einen so mächtigen und gut organisierten Staat wäre es für totalitäre Ideologien wie den Nationalsozialismus viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich gewesen, ihre zerstörerischen Pläne in einem so massiven Ausmaß umzusetzen. Ebenso wäre das Nazi-Regime ohne die industrielle und militärische Stärke eines modernen Staates nicht in der Lage gewesen, einen Krieg von globalem Ausmaß zu entfachen.
Der Zweite Weltkrieg markierte einen bedeutenden Bruch in der Art und Weise, wie Kriege geführt wurden, insbesondere in Bezug auf die Ziele. Mit der Verbreitung von Luftbombardements und der Industrialisierung der Kriegsführung wurden Zivilisten zu direkten Zielen. In diesem Krieg wurde die Mehrheit der Opfer vom Militär auf die Zivilbevölkerung verlagert. In diesem Zusammenhang können Massenvernichtungswaffen wie Atombomben massive Zerstörungen und den Tod von Tausenden oder gar Hunderttausenden von Zivilisten in einem einzigen Augenblick verursachen. Außerdem wird die gesamte Bevölkerung in die Kriegsanstrengungen einbezogen, und die Rüstungsindustrie ist oft ein vorrangiges Ziel, was zu einer höheren Zahl ziviler Opfer führt. In den Kriegen des zweiten Typs wurden auch eine Politik des Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in großem Maßstab umgesetzt, wofür industrielle Mittel und eine staatliche Organisation erforderlich waren. Die Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis sind ein tragisches Beispiel dafür, wie industrielle Kapazitäten und staatliche Bürokratie für unmenschliche Zwecke eingesetzt werden können. All dies zeigt einmal mehr, wie dramatisch die Folgen des modernen Staates und seiner Fähigkeit zur Organisation und Mobilisierung von Ressourcen sein können, wenn sie missbraucht werden.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt deutlich, dass Krieg und Industrialisierung untrennbar miteinander verbunden sind. Während der beiden Weltkriege mussten die Nationen ihre Volkswirtschaften schnell umstellen, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen, was zu einer deutlichen Beschleunigung der Industrialisierung führte. Tatsächlich wurden Fabriken, die früher der Produktion von Konsumgütern gewidmet waren, auf die Herstellung von Waffen, Militärfahrzeugen, Munition und anderem Kriegsmaterial umgestellt. Diese Industrien mussten modernisiert und rationalisiert werden, um ein nie dagewesenes Produktionsniveau zu erreichen, was wiederum die Entwicklung neuer Technologien und Produktionstechniken förderte. So stieg beispielsweise während des Ersten Weltkriegs die Produktion von Stahl und anderen wichtigen Materialien exponentiell an, um den Bedarf des Krieges zu decken. Diese erhöhte Produktionskapazität wurde dann nach dem Krieg wieder eingesetzt, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.
Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts, mit dem Aufkommen der Revolutions- und Napoleonischen Kriege, kam es zu einer großen Veränderung in der Art der Konflikte. Diese Kriege des zweiten Typs wurden zu totalen Kriegen, an denen nicht nur Armeen, sondern die gesamte Gesellschaft beteiligt war. In diesen totalen Kriegen wird die Mobilisierung der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung. Die Staaten führen Wehrpflichtsysteme ein, um eine große Zahl von Soldaten zu rekrutieren, und verwandeln den Krieg so in eine echte nationale Anstrengung. Die wirtschaftlichen, industriellen und technologischen Ressourcen eines jeden Landes werden mobilisiert, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Das bedeutet, dass die gesamte Gesellschaft vom Krieg betroffen ist. Die Zivilbevölkerung ist direkt involviert, sei es als Kämpfer an der Front, als Arbeiter in den Rüstungsfabriken oder als logistische Unterstützung in der Kommunikations-, Transport- und Gesundheitsinfrastruktur. Auch die Zivilbevölkerung leidet unter den Folgen des Krieges, darunter materielle Zerstörungen, Zwangsumsiedlungen, Entbehrungen und Verluste an Menschenleben. Diese totalen Kriege verändern also das Leben der beteiligten Gesellschaften grundlegend. Sie stärken die Verbindung zwischen Staat und Bevölkerung und verwandeln den Krieg in eine kollektive und nationale Verpflichtung. Die Unterscheidung zwischen Front und Hinterland verschwimmt und der Krieg wird zu einer allgegenwärtigen Realität im Alltag der Zivilbevölkerung.
Zwischen 1815 und 1914 gab es in Europa eine Phase relativer Stabilität und des Friedens, die oft als "hundertjähriger Frieden" oder "langes 19. Jahrhundert" bezeichnet wird. Während dieser Zeit vermieden die europäischen Großmächte größere Konflikte untereinander, was zu einer gewissen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Stabilität auf dem Kontinent führte. Allerdings war diese Zeit des relativen Friedens nicht frei von kleineren Spannungen und Konflikten. Es gab regionale Kriege und Krisen, koloniale Konflikte und Kämpfe um nationale Unabhängigkeit, die in dieser Zeit ausbrachen. Außerdem häuften sich im Laufe der Zeit die Rivalitäten und Spannungen zwischen den europäischen Mächten, die vor allem auf den Imperialismus, koloniale Rivalitäten und nationalistische Spannungen zurückzuführen waren. Die scheinbare Stabilität dieser Periode wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 gebrochen. Dieser große Konflikt war ein Wendepunkt in der Geschichte und markierte das Ende des relativen Friedens in Europa. Ihm folgte eine Reihe von großen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen, die das 20.
Nach den Napoleonischen Kriegen fand 1814-1815 der Wiener Kongress statt. Er brachte die damals wichtigsten europäischen Mächte mit dem Ziel zusammen, Europa nach den durch die Napoleonischen Kriege verursachten Umwälzungen neu zu ordnen und neue Konflikte zu verhindern. Der Wiener Kongress begründete das Prinzip des "Konzerts der Nationen", das auch als "Wiener System" bekannt ist. Es war ein System der multilateralen Diplomatie, bei dem sich die europäischen Großmächte regelmäßig trafen, um internationale Fragen zu besprechen und den Frieden in Europa zu wahren. Die Idee dahinter war, ein Gleichgewicht der Mächte zu schaffen und die zerstörerischen Kriege zu vermeiden, die die napoleonische Zeit geprägt hatten. Das Völkerbundskonzert war ein Versuch, ein System internationaler Beziehungen auf der Grundlage von Zusammenarbeit, Absprachen und Diplomatie zu schaffen. Doch trotz seiner Bemühungen zeigte das System im Laufe der Zeit seine Grenzen auf, insbesondere als es darum ging, mit den politischen Veränderungen und nationalistischen Bestrebungen umzugehen, die im Laufe des 19. Die Zeit nach dem Wiener Kongress war von Spannungen und Konflikten geprägt, darunter der Aufstieg des Nationalismus, die Revolutionen von 1848 und koloniale Rivalitäten. Diese Entwicklungen führten schließlich zum Ende des "hundertjährigen Friedens" und zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914.
Das Völkerbundskonzert, auch bekannt als Metternich-System, wurde nach dem Sturz Napoleons 1815 auf dem Wiener Kongress ins Leben gerufen. Die Gewinner des Krieges gegen Napoleon - nämlich Großbritannien, Österreich, Preußen und Russland, die damals die wichtigsten Mächte waren - legten neue Regeln für die Gestaltung der internationalen Beziehungen fest. Diese Regeln führten ein Konzertierungssystem für den Umgang mit Streitigkeiten zwischen Staaten ein, das auf dem Gleichgewicht der Mächte, der Einhaltung von Verträgen und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten basierte. Damit sollte eine Wiederholung der verheerenden Kriege, die das napoleonische Zeitalter geprägt hatten, vermieden werden. Daher war das Völkerbundskonzert zwar kein vollwertiges System der kollektiven Sicherheit, förderte aber die Zusammenarbeit zwischen den Mächten und trug dazu bei, die Stabilität in Europa für einen Großteil des 19. Jahrhunderts aufrechtzuerhalten. Tatsächlich funktionierte dieses System eine Zeit lang relativ gut, da die Zahl der großen Kriege in Europa deutlich zurückging. Allerdings wurde es auch dafür kritisiert, dass es den Status quo unterstützte und festigte und damit den sozialen und politischen Fortschritt behinderte. Zudem scheiterte er letztlich daran, den Ausbruch der Weltkriege im 20. Jahrhundert zu verhindern. Das Völkerbundskonzert war ein Meilenstein in der Geschichte der internationalen Beziehungen, da es den Grundstein für die moderne multilaterale Diplomatie legte und als Vorläufer für internationale Organisationen wie den Völkerbund und die Vereinten Nationen diente.
Die Ära nach 1945[modifier | modifier le wikicode]
Obwohl es während des Kalten Krieges erhebliche Spannungen gab, insbesondere zwischen der Sowjetunion und den USA, erlebte Europa seit 1945 eine beispiellose Periode des Friedens. Diese Zeit, die oft als "Pax Europaea" oder europäischer Frieden bezeichnet wird, markierte die längste Friedensperiode auf dem Kontinent in der modernen Geschichte. Nach den Napoleonischen Kriegen erlebte Europa zwischen 1815 und 1914 eine relativ friedliche Zeit, die als "Hundertjähriger Frieden" bekannt ist, trotz einiger bemerkenswerter Konflikte wie dem Krimkrieg und dem Französisch-Preußischen Krieg. Diese Zeit war geprägt von der allgemeinen Stabilität, die durch das Völkerbundskonzert gewährleistet wurde, das das Gleichgewicht der Mächte und die diplomatische Lösung von Konflikten förderte. Ebenso erlebte Europa trotz der Spannungen des Kalten Krieges und der drohenden nuklearen Vernichtung nach 1945 eine außergewöhnlich lange Friedensperiode. Diese "Pax Europaea" kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die nukleare Abschreckung, die Gründung und Erweiterung der Europäischen Union, die Präsenz von NATO-Streitkräften und des Warschauer Pakts sowie die umfangreiche Wirtschaftshilfe durch den Marshallplan. Diese Faktoren trugen zu einer stärkeren gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den europäischen Nationen bei, wodurch direkte Konflikte nicht nur unerwünscht, sondern zunehmend undenkbar wurden. So konnte Europa trotz der Herausforderungen und Spannungen der Nachkriegswelt einen dauerhaften und bedeutenden Frieden bewahren.
Bis zu den jüngsten Konflikten in der Ukraine konnte der Frieden in Europa weitgehend aufrechterhalten werden. Der Konflikt in der Ukraine, der 2014 begann, stellt einen bedeutenden Bruch dieses Friedens dar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Konflikt eher lokal begrenzt ist und nicht zu einem groß angelegten Krieg geführt hat, an dem viele europäische Länder beteiligt waren, wie es bei den beiden Weltkriegen der Fall war. Die Ukraine-Krise hat einige der Spannungen aufgezeigt, die nach wie vor in Europa bestehen, insbesondere zwischen Russland und den westlichen Nationen. Die Situation in der Ukraine ist komplex und hat viele Herausforderungen für die Stabilität und Sicherheit in Europa aufgeworfen. Sie hat die Wirksamkeit einiger der Strukturen und Vereinbarungen in Frage gestellt, die jahrzehntelang dazu beigetragen haben, den Frieden in Europa zu erhalten. Dennoch bleibt die Zeit seit 1945 auch mit dem Konflikt in der Ukraine eine der friedlichsten in der europäischen Geschichte, insbesondere im Vergleich zu den vorherigen Jahrhunderten, die von häufigen und verheerenden Kriegen geprägt waren.
Während Europa und andere Teile der entwickelten Welt seit dem Zweiten Weltkrieg eine Periode relativen Friedens erlebten, litten viele andere Orte während des Kalten Krieges und danach unter gewalttätigen Konflikten. Diese Zeit war von einer Reihe von Stellvertreterkriegen geprägt, bei denen Großmächte gegnerische Parteien in lokalen Konflikten unterstützten, ohne sich direkt am Krieg zu beteiligen. Beispiele für solche Stellvertreterkriege sind u. a. der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, der angolanische Bürgerkrieg und die Kriege in Afghanistan. Diese Konflikte führten oft zu schweren Verlusten unter der Zivilbevölkerung und hatten langfristige Auswirkungen auf die Stabilität und Entwicklung der betroffenen Regionen. Dies ist eine wichtige Erinnerung daran, dass die "Pax Europaea" und der Frieden zwischen den Großmächten zwar wichtig sind, aber nicht die gesamte Geschichte von Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert und darüber hinaus darstellen. Konflikte betreffen nach wie vor viele Teile der Welt, oft mit verheerenden Folgen für die lokale Bevölkerung.
Historisch gesehen waren große Konflikte häufig das Ergebnis direkter Kriege zwischen Großmächten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 haben es diese Mächte jedoch weitgehend vermieden, in direkte Konflikte miteinander verwickelt zu werden. Dieser Übergang kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Die Entwicklung und Verbreitung von Atomwaffen hat eine gegenseitige Abschreckung geschaffen, bei der die Kosten eines direkten Konflikts die totale Zerstörung wären. Darüber hinaus hat die zunehmende wirtschaftliche Interdependenz den Krieg für die Großmächte weniger attraktiv gemacht, da er den Welthandel und die Finanzmärkte stören würde. Darüber hinaus bot die Schaffung internationaler Institutionen wie der Vereinten Nationen Mechanismen für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Schließlich könnte auch die Verbreitung der Demokratie zu diesem Trend beigetragen haben, da Demokratien dazu neigen, Kriege untereinander zu vermeiden - ein Konzept, das als "demokratischer Frieden" bekannt ist.
Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es eine zunehmende Tendenz, Krieg als etwas Illegales oder zumindest als etwas, das vermieden werden sollte, zu betrachten. Dies ist ein bedeutender Wandel in der Art und Weise, wie der Krieg historisch gesehen wurde. Die Gründung des Völkerbunds nach dem Ersten Weltkrieg war ein erster Schritt in Richtung dieser Idee. Obwohl der Völkerbund den Zweiten Weltkrieg nicht verhindern konnte, basierte sein Nachfolger, die Vereinten Nationen, auf ähnlichen Grundsätzen der friedlichen Streitbeilegung und Kriegsvermeidung. Darüber hinaus wurden durch die Entwicklung des humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen bestimmte Regeln für die Kriegsführung aufgestellt, mit dem Gedanken, die schädlichen Auswirkungen des Krieges zu minimieren. In jüngerer Zeit wurde die Idee der "Schutzverantwortung" (Responsibility to Protect, R2P) entwickelt, um eine internationale Intervention in Situationen zu rechtfertigen, in denen ein Staat nicht in der Lage ist oder sich weigert, seine eigene Bevölkerung zu schützen.
Der Philosoph Immanuel Kant skizzierte in einer Abhandlung, die er 1795 veröffentlichte, einen Entwurf für einen "ewigen Frieden". Kant formulierte die Idee, dass liberale Demokratien weniger wahrscheinlich miteinander in den Krieg ziehen würden, eine Theorie, die von anderen politischen Denkern aufgegriffen wurde und als "demokratischer Frieden" bekannt wurde. Dieser Theorie zufolge neigen Demokratien weniger zu Kriegen, weil ihre Regierungen ihren Bürgern gegenüber verantwortlich sind, die die menschlichen und wirtschaftlichen Kosten von Konflikten zu tragen haben. Kant förderte auch die Idee einer Föderation freier Nationen, eine Art Vorläufer der heutigen internationalen Organisationen wie der Vereinten Nationen. Ziel dieser "Friedensföderation" wäre es, Konflikte durch Verhandlungen und internationales Recht statt durch Krieg zu lösen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 versuchten die Nationen der Welt, Strukturen zu schaffen, um den Frieden zu erhalten und zukünftige Konflikte zu verhindern. Dies führte zur Gründung der Vereinten Nationen (UNO), deren Ziel es ist, die internationale Zusammenarbeit zu erleichtern und Konflikte zu verhindern. Die Vereinten Nationen sind ein Beispiel für ein so genanntes System der kollektiven Sicherheit. In einem solchen System verpflichten sich die Staaten, zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Wenn ein Staat einen anderen angreift, wird von den anderen Staaten erwartet, dass sie sich auf die Seite des angegriffenen Staates stellen und Maßnahmen ergreifen, um den Angreifer abzuschrecken oder aufzuhalten. Neben den Vereinten Nationen wurden auch andere Organisationen und Verträge gegründet, um die kollektive Sicherheit zu fördern, wie die Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) und die Europäische Union. Diese Mechanismen haben seit 1945 dazu beigetragen, größere Konflikte zwischen Großmächten zu verhindern. Allerdings haben sie auch ihre Grenzen und sind nicht immer wirksam bei der Verhinderung von Konflikten, wie man an den vielen regionalen Konflikten und Bürgerkriegen seit 1945 sehen kann.
Die Charta der Vereinten Nationen, die 1945 eingeführt wurde, hat wesentliche Regeln zur Regulierung des Einsatzes von Gewalt zwischen Staaten aufgestellt. Im Allgemeinen verbietet sie die Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen, außer unter zwei besonderen Umständen. Erstens ist in Artikel 51 der Charta das inhärente Recht der Staaten auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten Angriffs verankert. Das bedeutet, dass ein Staat das Recht hat, sich zu verteidigen, wenn er selbst oder ein anderer Staat, mit dem er ein Verteidigungsabkommen geschlossen hat, angegriffen wird. Zweitens erlaubt Kapitel VII der Charta dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Maßnahmen zu ergreifen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen. Dies kann auch die Anwendung von Gewalt beinhalten und diente als Grundlage für die Genehmigung mehrerer militärischer Interventionen, wie z. B. im Golfkrieg 1991. Obwohl diese Prinzipien dazu gedacht waren, den Einsatz von Gewalt zu begrenzen und die friedliche Lösung von Konflikten zu fördern, waren sie auch umstritten, insbesondere was ihre Auslegung und Anwendung in konkreten Situationen betrifft.
Seit 1945 gab es eine zunehmende Tendenz zur Regulierung und zum Verbot von Kriegen. Die Charta der Vereinten Nationen war ein wichtiger Meilenstein in dieser Entwicklung, da sie die Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen verbietet, es sei denn, es handelt sich um Selbstverteidigung oder eine Genehmigung durch den Sicherheitsrat. Neben der Charta der Vereinten Nationen haben auch andere Verträge und Konventionen zu diesem Trend beigetragen. Beispielsweise haben die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle strenge Regeln für die Kriegsführung aufgestellt, um das menschliche Leid zu begrenzen. Ebenso haben Rüstungskontrollverträge wie der Atomwaffensperrvertrag versucht, die Verbreitung der zerstörerischsten Waffen zu begrenzen. Gleichzeitig gab es eine zunehmende Bewegung hin zu einer friedlichen Konfliktlösung. Friedliche Streitbeilegungsmechanismen wie Mediation, Schiedsverfahren und gerichtliche Vergleiche werden zunehmend zur Lösung internationaler Streitigkeiten eingesetzt. Doch obwohl diese Bemühungen dazu beigetragen haben, den Krieg einzudämmen und zu regulieren, konnten sie ihn nicht vollständig beseitigen. In vielen Teilen der Welt kommt es weiterhin zu Konflikten, was die anhaltende Herausforderung unterstreicht, einen dauerhaften und universellen Frieden zu erreichen.
Zeitgenössische Transformationen des Krieges[modifier | modifier le wikicode]
Das Ende des Kalten Krieges im Jahr 1989, das durch den Fall der Berliner Mauer gekennzeichnet war, stellte einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte der modernen Kriegsführung dar. Während dieser Zeit der bipolaren Spannungen zwischen Ost und West war die Welt zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion aufgeteilt worden. Obwohl diese beiden Supermächte nie in einem direkten Konflikt standen, unterstützten sie Stellvertreterkriege auf der ganzen Welt, die zu langwierigen und kostspieligen Konflikten führten. Das Ende des Kalten Krieges veränderte die Dynamik der modernen Kriegsführung auf mehrere Arten. Zunächst einmal bedeutete es das Ende der Bipolarität, die die Weltpolitik fast ein halbes Jahrhundert lang geprägt hatte. Infolgedessen veränderte sich die Art der Konflikte von Kriegen zwischen Staaten hin zu Bürgerkriegen und nichtstaatlichen Konflikten. Zweitens hat das Ende des Kalten Krieges auch den Weg für eine neue Welle des Optimismus hinsichtlich der Möglichkeit eines dauerhaften Weltfriedens geebnet. Es bestand die Hoffnung, dass die Welt ohne die ständige Anspannung des Kalten Krieges bedeutende Fortschritte bei der Konfliktlösung und Kriegsvermeidung machen könnte. Schließlich hat das Ende des Kalten Krieges auch zu einer Reihe neuer Herausforderungen geführt, darunter die Verbreitung von Atomwaffen, der Anstieg des internationalen Terrorismus und das wachsende Problem gescheiterter Staaten. Diese Herausforderungen haben das Wesen der modernen Kriegsführung beeinflusst und stellen nach wie vor große Probleme für die globale Sicherheit dar.
Das Ende des Kalten Krieges im Jahr 1989 war ein bedeutender Wendepunkt in der Weltgeschichte, der weitreichende Auswirkungen auf das Wesen des Krieges und der modernen Staatlichkeit hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Entwicklung des modernen Krieges eng mit der Entstehung und Konsolidierung des modernen Nationalstaats verbunden. Dieser Staat war durch eine klar definierte territoriale Souveränität, das Monopol der legitimen Gewalt und eine zentralisierte Regierungsstruktur gekennzeichnet. Kriege waren in erster Linie Auseinandersetzungen zwischen diesen Nationalstaaten. Nach 1989 beobachteten viele Forscher jedoch eine deutliche Veränderung dieser Dynamik. Kriege wurden seltener zu direkten Konfrontationen zwischen Nationalstaaten und häufiger zu internen Konflikten, Bürgerkriegen oder Kriegen, an denen nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen oder Milizen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde der Begriff der staatlichen Souveränität selbst allmählich in Frage gestellt. Humanitäre Interventionen, friedenserhaltende Maßnahmen und die Doktrin der "Schutzverantwortung" haben alle die traditionelle Vorstellung von der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates in Frage gestellt. Folglich kann man sagen, dass das Ende des Kalten Krieges eine neue Ära eingeläutet hat, in der sich die Beziehung zwischen Krieg und Staat weiterentwickelt. Die genauen Umrisse dieser neuen Ära sind noch immer Gegenstand von Debatten unter Forschern und Analysten.
Seit dem Ende des Kalten Krieges legen viele Wissenschaftler und Militärexperten nahe, dass der Krieg einen bedeutenden Wandel durchlaufen hat. Diese Transformationen wurden auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter die Entwicklung der Militärtechnologie, die Globalisierung, Veränderungen im Wesen des Staates und der relative Rückgang der zwischenstaatlichen Kriegsführung. Die Kriege von heute werden oft als "postmodern" beschrieben, um ihren Unterschied zu den traditionellen Kriegen früherer Jahrhunderte widerzuspiegeln. Postmoderne Kriege zeichnen sich häufig durch ihre Komplexität aus und involvieren eine Vielzahl staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, manchmal sogar Privatunternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Sie finden häufig in städtischen Gebieten statt, statt auf traditionellen Schlachtfeldern, und können asymmetrische Akteure wie Terrorgruppen oder Cyberangreifer einbeziehen. Diese postmodernen Kriege haben auch die traditionellen Normen und Regeln der Kriegsführung in Frage gestellt. Wie lassen sich beispielsweise die Grundsätze des humanitären Völkerrechts, die für Kriege zwischen Staaten konzipiert wurden, auf Konflikte mit nichtstaatlichen Akteuren oder Cyberangriffe anwenden? Das bedeutet nicht, dass die alten Formen der Kriegsführung völlig verschwunden sind. Es gibt immer noch Konflikte, die traditionellen Kriegen ähneln. Diese neuen Konfliktformen haben der Kriegskunst jedoch eine Schicht der Komplexität hinzugefügt und erfordern ein ständiges Nachdenken und eine Anpassung an die neuen Gegebenheiten des 21.
Die neue Welt(un)ordnung[modifier | modifier le wikicode]
Der Fall der Berliner Mauer 1989 und die Auflösung der Sowjetunion 1991 markierten das Ende des Kalten Krieges und des bipolaren Systems, das fast ein halbes Jahrhundert lang die Weltpolitik beherrscht hatte. In dieser Zeit hatten die USA und die Sowjetunion als Supermächte zwei getrennte Blöcke mit globalem Einfluss errichtet. Trotz ständiger Spannungen und zahlreicher Krisen wurde ein offener Konflikt zwischen diesen beiden Mächten vermieden, was größtenteils auf die Drohung der gegenseitigen versicherten Zerstörung (MAD) im Falle eines Atomkriegs zurückzuführen war. Das Ende des Kalten Krieges hat jedoch nicht zu einer "neuen Weltordnung" des Friedens und der Stabilität geführt, wie einige gehofft hatten. Stattdessen sind neue Herausforderungen und Konflikte entstanden. Gescheiterte Staaten, Bürgerkriege, internationaler Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sind zu großen Problemen geworden. Auch die Art der Konflikte hat sich verändert, wobei asymmetrische Kriege und Konflikte, an denen nichtstaatliche Akteure beteiligt sind, zugenommen haben.
Das Ende des Kalten Krieges leitete eine neue Ära in der Weltpolitik ein, die von einer gewissen Portion Optimismus geprägt war. Viele Experten und politische Entscheidungsträger hofften, dass das Ende der Rivalität zwischen den Supermächten zu einer Ära des verstärkten internationalen Friedens und der Zusammenarbeit führen würde. Der politische Philosoph Francis Fukuyama bezeichnete diese Zeit sogar als "das Ende der Geschichte" und deutete an, dass sich die liberale Demokratie schließlich als das unangefochtene und endgültige Regierungssystem herauskristallisiert hatte. Mit dem Verschwinden der Sowjetunion fanden sich die Vereinigten Staaten als einzige globale Supermacht wieder und leiteten das ein, was einige als die amerikanische "Hypermacht" bezeichnet haben. Viele glaubten, dass diese neue unipolare Ära zu mehr Stabilität und Frieden in der Welt führen würde. Gleichzeitig ermöglichte das Ende der Rivalität zwischen den beiden Supermächten den Vereinten Nationen, eine effektivere Rolle bei der Konfliktprävention und Friedensförderung zu spielen. Die systematische Obstruktion durch eines der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die die Organisation während des Kalten Krieges oftmals gelähmt hatte, wurde weitgehend aufgehoben. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der friedenserhaltenden Maßnahmen der Vereinten Nationen in den 1990er Jahren.
Mit dem Ende des Kalten Krieges kam es in den 1990er Jahren zu einem deutlichen Anstieg der friedenserhaltenden Maßnahmen der Vereinten Nationen. UN-Blauhelme wurden in Konflikten auf der ganzen Welt eingesetzt, um den Frieden zu erhalten oder wiederherzustellen und die Versöhnung und den Wiederaufbau zu fördern. Die Idee war, dass diese friedenserhaltenden Einsätze dazu beitragen könnten, die Eskalation von Konflikten zu verhindern, Zivilisten zu schützen, die Bereitstellung humanitärer Hilfe zu erleichtern und den Friedensprozess zu unterstützen. Mit anderen Worten, diese Missionen sollten dazu beitragen, nach dem Ende des Kalten Krieges "die Friedensdividende zu ernten".
Das Ende des Kalten Krieges und die Entstehung eines neuen internationalen Systems wurden von einem zunehmenden Diskurs über die "globale Unordnung" begleitet. Dieser Begriff bezieht sich auf die Vorstellung, dass die Welt nach dem Kalten Krieg durch erhöhte Unsicherheit, komplexe und vernetzte globale Herausforderungen und das Fehlen eines klaren und stabilen Rahmens für die internationale Ordnungspolitik gekennzeichnet ist. Mehrere Faktoren haben zu dieser Wahrnehmung einer "globalen Unordnung" beigetragen. Zunächst einmal hat das Ende der Bipolarität des Kalten Krieges den klaren Rahmen beseitigt, der zuvor die internationalen Beziehungen strukturiert hatte. Anstelle einer zwischen zwei Supermächten aufgeteilten Welt haben wir eine komplexere, multipolare Landschaft mit mehreren wichtigen Akteuren erlebt, darunter nicht nur Nationalstaaten, sondern auch internationale Organisationen, multinationale Unternehmen, nichtstaatliche Gruppen und andere. Zweitens war die Welt nach dem Kalten Krieg von einer Reihe globaler Herausforderungen geprägt, darunter transnationaler Terrorismus, Finanzkrisen, Klimawandel, Pandemien, Cybersicherheit und andere Probleme, die sich nicht an nationale Grenzen halten und nicht von einem einzelnen Land oder auch nur einer Gruppe von Ländern gelöst werden können. Schließlich gab es ein wachsendes Bewusstsein für die Grenzen und Widersprüche der bestehenden internationalen Institutionen. So wurden beispielsweise die Vereinten Nationen, der IWF, die Weltbank und andere Organisationen für ihre mangelnde Repräsentativität, ihre Ineffizienz und ihre Unfähigkeit, effektiv auf globale Herausforderungen zu reagieren, kritisiert. Vor diesem Hintergrund ist die Frage, wie man mit dieser "globalen Unordnung" umgehen und ein gerechteres, effizienteres und widerstandsfähigeres internationales System aufbauen kann, zu einem zentralen Thema der Weltpolitik geworden.
In seinem viel diskutierten Buch "Der Kampf der Kulturen" schlug der politische Analyst Samuel P. Huntington eine neue Betrachtungsweise der Welt nach dem Kalten Krieg vor. Er argumentierte, dass die künftigen Quellen internationaler Konflikte nicht so sehr politische oder wirtschaftliche Ideologien beinhalten würden, sondern vielmehr die Unterschiede zwischen den verschiedenen großen Zivilisationen der Welt. Huntington zufolge könnte die Welt in etwa acht große Zivilisationen unterteilt werden, die auf Religion und Kultur basieren. Er prognostizierte, dass die größten Konflikte des 21. Jahrhunderts zwischen diesen Zivilisationen stattfinden würden, insbesondere zwischen der westlichen Zivilisation und den islamischen und konfuzianistischen Zivilisationen (letztere hauptsächlich durch China vertreten).
Das Ende des Kalten Krieges markierte einen bedeutenden Übergang in der Art der Konflikte. Während die Zeit des Kalten Krieges von zwischenstaatlichen Konflikten und Stellvertreterkriegen zwischen den beiden Supermächten dominiert wurde, kam es in der Ära nach dem Kalten Krieg zu einem deutlichen Anstieg von Bürgerkriegen und internen Konflikten. An diesen Konflikten war häufig eine Vielzahl nichtstaatlicher Akteure beteiligt, wie Rebellengruppen, Milizen, Terrorgruppen und kriminelle Banden. Darüber hinaus waren sie häufig von intensiver und lang anhaltender Gewalt, massiven Menschenrechtsverletzungen und schweren humanitären Krisen geprägt. Diese Trends stellten die internationale Gemeinschaft vor ernste Herausforderungen. Zum einen war es schwieriger, diese Konflikte zu bewältigen und zu lösen, da sie häufig tief verwurzelte Probleme wie ethnische oder religiöse Identität, Regierungsführung, Ungleichheit und Zugang zu Ressourcen beinhalteten. Andererseits haben diese Konflikte oft destabilisierende Auswirkungen, die über nationale Grenzen hinausgehen, wie Flüchtlingsströme, die Ausbreitung extremistischer Gruppen und die regionale Destabilisierung.
Historisch gesehen war der Nationalstaat der Hauptakteur in bewaffneten Konflikten, und die meisten Kriege fanden zwischen Staaten statt. Mit dem Zusammenbruch der bipolaren Weltordnung am Ende des Kalten Krieges begann sich das Wesen des Krieges jedoch zu verändern. Bürgerkriege, die früher eine relativ seltene Art von Konflikten waren, wurden immer häufiger. An diesen innerstaatlichen Konflikten war häufig eine Vielzahl nichtstaatlicher Akteure beteiligt, wie Rebellengruppen, Milizen, Terrorgruppen und kriminelle Banden. Der Anstieg der Bürgerkriege hat neue Herausforderungen für das Konfliktmanagement und die internationale Sicherheit mit sich gebracht. Im Gegensatz zu zwischenstaatlichen Kriegen sind Bürgerkriege oft komplexer und schwieriger zu lösen. Sie können tief verwurzelte Probleme wie ethnische oder religiöse Spaltungen, Regierungsführung, Ungleichheit und den Zugang zu Ressourcen beinhalten. Darüber hinaus haben diese Konflikte oft destabilisierende Folgen, die über nationale Grenzen hinausgehen, wie Flüchtlingsströme, die Ausbreitung extremistischer Gruppen und regionale Destabilisierung.
Seit dem Ende des Kalten Krieges im Jahr 1989 hat sich die Art der Konflikte erheblich verändert. Während zwischenstaatliche Kriege früher die dominierende Konfliktform waren, war die Zeit nach dem Kalten Krieg durch eine Zunahme von Bürgerkriegen und internen Konflikten gekennzeichnet. An diesen Bürgerkriegen war häufig eine Reihe von nichtstaatlichen Akteuren beteiligt, darunter bewaffnete Gruppen, Milizen, Terrorgruppen und Banden. Infolgedessen entsteht oft der Eindruck, dass der Staat nicht mehr der Hauptakteur in bewaffneten Konflikten ist. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung für das internationale System dar, das auf dem Prinzip der staatlichen Souveränität aufgebaut wurde und dazu gedacht ist, Konflikte zwischen Staaten zu bewältigen. Bürgerkriege sind oft komplexer, schwieriger zu lösen und führen eher zu humanitären Krisen als zwischenstaatliche Kriege.
Die Zeit nach dem Kalten Krieg war geprägt von der Entstehung und Verbreitung einer Vielzahl nichtstaatlicher Akteure, die zu Schlüsselfiguren in zahlreichen Konflikten auf der ganzen Welt geworden sind. Terrorgruppen, Milizen und kriminelle Organisationen wie Mafias und Banden sind zu wichtigen Akteuren in Gewalt und Konflikten geworden. Diesen Akteuren ist es oft gelungen, die Schwächen des Staates auszunutzen, insbesondere in Ländern, in denen der Staat schwach oder fragil ist, sein Territorium nicht wirksam kontrollieren oder seiner Bevölkerung keine Grundversorgung bieten kann. Sie setzten häufig Gewalt ein, um ihre Ziele zu erreichen, sei es, um die Autorität des Staates zu untergraben, um ein Gebiet oder Ressourcen zu kontrollieren oder um eine politische oder ideologische Sache voranzutreiben. Dies hatte zahlreiche Auswirkungen auf die internationale Sicherheit. Einerseits hat es Konflikte komplexer und schwieriger zu lösen gemacht. Andererseits hat dies zu mehr Gewalt und Instabilität geführt, mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung.
Das Konzept der Souveränität, das lange Zeit grundlegend für die Strukturierung des zwischenstaatlichen Systems und die Regulierung von Gewalt war, wurde im Kontext der Zeit nach dem Kalten Krieg ernsthaft in Frage gestellt. Der Aufstieg nichtstaatlicher Gewaltakteure wie Terrorgruppen und krimineller Organisationen fand häufig in Gebieten statt, in denen die staatliche Autorität schwach oder nicht vorhanden war, was die Grenzen der Souveränität als Mittel zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit deutlich machte. Darüber hinaus hat die Ausbreitung interner Konflikte und Bürgerkriege wichtige Fragen zur Verantwortung des Staates für den Schutz seiner eigenen Bevölkerung und zum Recht der internationalen Gemeinschaft, in die Angelegenheiten eines souveränen Staates einzugreifen, um schwere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern oder zu beenden, aufgeworfen. Diese Herausforderungen haben zu wichtigen Diskussionen und Debatten über das Wesen und die Bedeutung der Souveränität im 21. Jahrhundert geführt. Zu den Konzepten, die aus diesen Debatten hervorgegangen sind, gehört das Prinzip der "Schutzverantwortung", das besagt, dass Souveränität nicht nur ein Recht, sondern auch eine Verantwortung ist und dass die internationale Gemeinschaft die Verantwortung hat, einzugreifen, wenn ein Staat nicht in der Lage ist oder sich weigert, seine Bevölkerung vor Massenverbrechen zu schützen.
"Failed States" oder gescheiterte Staaten sind Staaten, die nicht mehr in der Lage sind, in ihrem gesamten Hoheitsgebiet für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, ihrer Bevölkerung grundlegende Dienstleistungen zu bieten oder in den Augen ihrer Bürger eine legitime Macht zu repräsentieren. Diese Staaten werden zwar international immer noch als souverän anerkannt, sehen sich aber häufig mit einem Kontrollverlust über einen erheblichen Teil ihres Hoheitsgebiets, mit Aufständen oder gewaltsamen internen Konflikten sowie mit Korruption und schlechter Regierungsführung konfrontiert. Seit den 1990er Jahren ist eine Vielzahl von Konflikten, vor allem in Afrika, aber auch in anderen Teilen der Welt, in diesen gescheiterten Staaten ausgebrochen. Diese Konflikte sind häufig durch massive Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, weit verbreitete Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts gekennzeichnet und haben oft destabilisierende Auswirkungen auf die umliegenden Länder und Regionen.
Die Zunahme interner Konflikte und Bürgerkriege seit den 1990er Jahren hat im internationalen Diskurs zu einer Neubewertung des traditionellen Konzepts der Souveränität geführt. Während Souveränität früher als Garant für Ordnung und Stabilität galt, der die Staaten vor äußerer Einmischung schützte, wurde sie nun zunehmend problematischer gesehen. In diesem Zusammenhang wurde Souveränität manchmal als Barriere für internationale Interventionen in Situationen angesehen, in denen Bevölkerungen von massiver Gewalt, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit bedroht waren. Dies hat zu Debatten über die "Schutzverantwortung" und die Frage geführt, wann und wie die internationale Gemeinschaft zum Schutz der Zivilbevölkerung eingreifen sollte, selbst wenn dies gegen den traditionellen Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates verstößt. Darüber hinaus wurde die Souveränität auch als Quelle der Legitimität in Frage gestellt, wenn autoritäre oder despotische Regime sich auf sie beriefen, um Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen oder Forderungen nach demokratischen Reformen zu widerstehen. Obwohl die Souveränität also ein Grundprinzip des internationalen Systems bleibt, sind ihre Bedeutung und ihre Anwendung im zeitgenössischen Kontext zunehmend umstritten geworden.
Die Entstehung neuer Kriege[modifier | modifier le wikicode]
Mary Kaldor, eine Expertin für internationale Beziehungen und Kriegstheorie, hat in ihrem Buch "New and Old Wars: Organised violence in a global era" (1999) die Idee der "neuen Kriege" vorgestellt. Ihrer Ansicht nach weisen die Konflikte, die nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden sind, andere Merkmale auf als die traditionellen "alten Kriege", was größtenteils auf die Auswirkungen der Globalisierung sowie auf politische, wirtschaftliche und technologische Veränderungen zurückzuführen ist.
Die "neuen Kriege", so Kaldor, sind typischerweise gekennzeichnet durch :
- Die Degradierung des Krieges zu diffusen und oft dezentralisierten Gewalttaten, an denen eine Vielzahl nichtstaatlicher Akteure beteiligt sind, wie Milizen, Terrorgruppen, kriminelle Banden und Warlords.
- Die Fokussierung auf Identität statt auf Ideologie als Konfliktmotor, wobei häufig auf ethnische, religiöse oder nationalistische Diskurse zurückgegriffen wird, um Unterstützung zu mobilisieren und Gewalt zu rechtfertigen.
- Die zunehmende Bedeutung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Angriffen auf Zivilisten anstelle von konventionellen Kämpfen zwischen Streitkräften.
- Die zunehmende Beteiligung internationaler und transnationaler Akteure, sowohl in Bezug auf die Finanzierung und Unterstützung von Konfliktparteien als auch in Bezug auf die Bemühungen, Konflikte zu lösen oder ihre humanitären Auswirkungen abzumildern.
Diese "neuen Kriege" stellen unterschiedliche Herausforderungen an die Prävention, die Lösung und den Wiederaufbau nach Konflikten und erfordern andere Strategien und Ansätze als jene, die in den "alten Kriegen" wirksam waren.
In ihrer Analyse der neuen Kriege argumentiert Mary Kaldor, dass die Ära nach 1989 durch drei Schlüsselelemente gekennzeichnet ist. Das erste ist die Globalisierung. Das Ende des 20. Jahrhunderts war durch eine beschleunigte Globalisierung gekennzeichnet, die die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen auf globaler Ebene grundlegend verändert hat. Diese Globalisierung hat direkte Auswirkungen auf die Art der Konflikte. Die transnationale Finanzierung bewaffneter Gruppen, die Verbreitung extremistischer Ideologien über digitale Medien oder die Beteiligung internationaler Streitkräfte an friedenserhaltenden Maßnahmen sind nur einige der Phänomene, die daraus hervorgegangen sind. Zweitens ist die Zeit nach 1989 durch einen großen Wandel der politischen Strukturen gekennzeichnet. Mit dem Ende des Kalten Krieges brachen viele kommunistische und autoritäre Regime zusammen, was zur Entstehung neuer Demokratien führte. Gleichzeitig kam es vermehrt zu internationalen Interventionen in die inneren Angelegenheiten von Staaten, die häufig mit der Notwendigkeit begründet wurden, die Menschenrechte zu schützen oder Völkermord zu verhindern. Schließlich weist Kaldor auf eine grundlegende Veränderung im Wesen der Gewalt hin. Konflikte sind diffuser und dezentraler geworden und involvieren eine Vielzahl nichtstaatlicher Akteure. Vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten, die Ausnutzung ethnischer oder religiöser Identität zu Mobilisierungszwecken und die Anwendung von Terrortaktiken sind alltäglich geworden. So wirken diese drei Elemente laut Kaldor zusammen, um eine neue Art von Krieg zu schaffen, die sich grundlegend von den traditionellen zwischenstaatlichen Kriegen der Vergangenheit unterscheidet.
Laut Mary Kaldor hat die Moderne eine Verschiebung von Ideologien hin zu Identitäten als Hauptantriebskraft von Konflikten erlebt. In diesem Zusammenhang werden Schlachten nicht mehr für politische Ideale geführt, sondern für die Behauptung und Verteidigung bestimmter, oft ethnischer Identitäten. Diese Entwicklung ist ein Schritt in Richtung Ausgrenzung, da sie zu einer stärkeren Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft führen kann. Im Gegensatz zu einer ideologischen Debatte, in der es zu Kompromissen und Konsens kommen kann, kann die Verteidigung der Identität eine Dynamik von "wir gegen die" erzeugen, die äußerst zerstörerisch sein kann.
Mary Kaldor hebt diese entscheidende Veränderung bei den Konfliktmotiven hervor. Wenn sich die Kämpfe auf Ideologien konzentrierten, wie z. B. den internationalen Sozialismus, hatten sie einen eher inklusiven Charakter. Das Ziel bestand darin, möglichst viele Menschen von einer Sache, einem Denksystem oder einer Weltanschauung zu überzeugen und dafür zu gewinnen. Wenn Konflikte hingegen auf Identität, insbesondere auf ethnischer Identität, beruhen, haben sie tendenziell einen stärkeren exklusiven Charakter. Wenn man um eine bestimmte ethnische Identität kämpft, grenzt man eine bestimmte Gruppe als "wir" ab, was unweigerlich ein "sie" impliziert, das unterscheidbar und anders ist. Dadurch entsteht eine Ausgrenzungsdynamik, die zutiefst spaltend wirken und zu Gewalt zwischen den Gemeinschaften führen kann. Dies ist eine tiefgreifende Veränderung im Vergleich zu den ideologischen Konflikten der Vergangenheit.
Andererseits ist der Krieg laut Kaldor nicht mehr für das Volk, sondern gegen das Volk, d. h. wir haben es zunehmend mit Akteuren zu tun, die nicht den Staat repräsentieren und nicht einmal danach streben, der Staat zu sein. Früher wurden Konflikte in der Regel von Staaten oder Akteuren geführt, die danach strebten, den Staat zu kontrollieren. Der Krieg wurde also "für das Volk" geführt, in dem Sinne, dass das Ziel darin bestand, die Kontrolle über die Regierung zu erlangen, um theoretisch den Interessen des Volkes zu dienen. Im aktuellen Kontext argumentiert sie, dass Kriege oft "gegen das Volk" geführt werden. Das bedeutet, dass nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen, Milizen oder Banden zunehmend in Konflikte verwickelt werden. Diese Gruppen versuchen nicht unbedingt, den Staat zu kontrollieren, und können sich tatsächlich an Gewaltakten beteiligen, die sich hauptsächlich gegen die Zivilbevölkerung richten. So hat sich das Wesen des Krieges von einem Kampf um die Kontrolle des Staates zu einer Quelle von Gewalt gegen das Volk gewandelt.
Es gibt zunehmend einen Krieg der Banditen, bei dem es darum geht, die natürlichen Ressourcen der Länder zur persönlichen Bereicherung bestimmter Gruppen zu extrahieren. Mary Kaldor beschreibt diesen Wandel als eine Form des "Banditenkriegs". In diesem Kontext wird der Krieg nicht zur Erreichung traditioneller politischer Ziele wie der Kontrolle des Staates oder der Verteidigung einer Ideologie geführt, sondern zur persönlichen Bereicherung oder zur Bereicherung von Gruppen. Diese neue Form des Konflikts ist häufig durch den Abbau und die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen in Konfliktregionen gekennzeichnet. Diese "Banditenkriege" können verheerende Folgen für die lokale Bevölkerung haben, nicht nur wegen der damit verbundenen direkten Gewalt, sondern auch wegen der wirtschaftlichen und sozialen Destabilisierung, die sie mit sich bringen. Häufig werden Ressourcen, die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung genutzt werden könnten, stattdessen für private Interessen oder Gruppen abgezweigt, was Armut und Ungleichheit verschärfen kann.
In der Zeit nach dem Kalten Krieg hat sich eine globale Kriegswirtschaft herausgebildet, in der nichtstaatliche Akteure wie kriminelle Organisationen, Terrorgruppen und private Milizen eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese Gruppen stützen sich häufig auf transnationale Netzwerke, um ihre Operationen zu finanzieren, und zwar durch Drogenhandel, illegalen Waffenhandel, Warenschmuggel und andere Formen der organisierten Kriminalität. Diese Kriegsökonomie führt zu einer Verlängerung der Konflikte, da sie bewaffneten Gruppen eine Möglichkeit bietet, ihre Aktivitäten ohne die Notwendigkeit staatlicher oder volkswirtschaftlicher Unterstützung zu finanzieren. Gleichzeitig trägt sie zu regionaler Instabilität bei, da die Gewinne aus diesen illegalen Aktivitäten häufig zur Finanzierung anderer Formen von Gewalt und Unruhen verwendet werden. Darüber hinaus erschweren diese transnationalen Netzwerke die Kontrolle und Lösung von Konflikten durch staatliche Behörden und internationale Organisationen. Sie operieren häufig außerhalb des traditionellen Rechtsrahmens und können sich über mehrere Länder oder Regionen erstrecken, wodurch die Bemühungen zu ihrer Bekämpfung erschwert werden. Schließlich kann die Beteiligung nichtstaatlicher Akteure an Konflikten auch destabilisierende Auswirkungen auf Staaten haben, indem sie ihre Autorität und ihre Fähigkeit, Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, untergraben. Dies kann wiederum Spannungen und Konflikte verschärfen und einen Teufelskreis aus Gewalt und Instabilität in Gang setzen.

Mary Kaldors Ansatz zum Thema Krieg kann als entpolitisierend betrachtet werden. Sie argumentiert, dass zeitgenössische Konflikte hauptsächlich durch ethnische, religiöse oder identitätsbezogene Faktoren und nicht durch politische Ideologien motiviert sind. Dies stellt einen Bruch mit den Kriegen der Vergangenheit dar, die oft im Namen einer politischen Ideologie, wie Kommunismus oder Faschismus, geführt wurden. Aus dieser Perspektive ist Krieg nicht mehr eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wie es der Militärtheoretiker Carl von Clausewitz formulierte, sondern vielmehr ein Gewaltakt, der durch Identitätsunterschiede motiviert ist. Dies legt nahe, dass traditionelle Lösungen wie politische Verhandlungen oder Friedensabkommen möglicherweise nicht effektiv genug sind, um diese Konflikte zu lösen.
Die traditionelle Sichtweise des Krieges, wie sie Carl von Clausewitz beschrieb, betrachtet ihn als "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln". Aus dieser Perspektive wird der Krieg als ein Werkzeug gesehen, das Staaten einsetzen, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Nach dem Ansatz von Mary Kaldor und ähnlichen Forschern soll sich diese Dynamik jedoch geändert haben. Sie argumentieren, dass in zeitgenössischen Konflikten die traditionellen politischen Ziele oft von anderen Motivationen wie ethnischer oder religiöser Identität oder dem Wunsch nach Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen in den Hintergrund gedrängt werden. In diesen Fällen steht der Krieg nicht mehr im Dienste der Politik, sondern scheint eher durch wirtschaftliche oder identitätsbezogene Interessen motiviert zu sein.
Wir sind mit Staaten konfrontiert, die aus der Entkolonialisierung hervorgegangen sind, vor allem in den südlichen Regionen, die einen schwierigen Prozess des nationalen Aufbaus durchlaufen haben. Diese Staaten haben oftmals nicht die notwendigen Werkzeuge für eine solide und nachhaltige Strukturierung erhalten. Infolgedessen sind sie fragil und instabil geworden, eine Situation, die das Entstehen von Konflikten und Gewalt begünstigt. Wenn diese Staaten zu zerfallen beginnen, entsteht ein Chaos, in dem ethnische Gruppen miteinander in Konflikt geraten können. Gleichzeitig nutzen Banditen und andere nichtstaatliche Akteure diese Instabilität für ihre eigenen Interessen aus. Das Fehlen einer starken und effektiven staatlichen Autorität trägt dazu bei, dieses Chaos zu verewigen, und verhindert die Schaffung eines dauerhaften Friedens.
Die von Mary Kaldor vorgeschlagene Perspektive, die ein Verschwinden politischer Konflikte zugunsten einer Form von globaler Unordnung nahelegt, hat unser Verständnis der zeitgenössischen Veränderungen des Krieges maßgeblich beeinflusst. Dieser Vision zufolge wären schwache oder zerfallende Staaten nicht in der Lage, Stabilität auf ihrem Territorium zu gewährleisten, was einer Reihe von Bedrohungen und Gefahren Tür und Tor öffnen würde. Ohne staatliche Struktur und Kontrolle kann ein gewisses Chaos entstehen, das häufig ethnische Konflikte, kriminelle Aktivitäten und den uneingeschränkten Zugang zu natürlichen Ressourcen durch verschiedene nichtstaatliche Gruppen hervorbringt. In diesem Kontext kommt es zu einer Zunahme von Bürgerkriegen und internen Konflikten, die von transnationalen Netzwerken wie der Mafia angeheizt werden. Das Fehlen eines stabilen und starken Staates führt also zu einer komplexen Konfliktlandschaft, in der die klassischen politischen Konflikte einer Vielzahl diffuserer und dezentralerer Bedrohungen weichen. Dieser Ansatz hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, wie wir moderne Konflikte und die Herausforderungen für den Weltfrieden und die globale Sicherheit verstehen.
Die im Nahen Osten beobachtete Unordnung hat viele Bedenken ausgelöst, die häufig mit dem Konzept des Staates und seiner Rolle als stabilisierende Einheit zusammenhängen. Wenn der Staat unfähig zu sein scheint, Kontrolle und Ordnung aufrechtzuerhalten, kann dies zu einer Vielzahl von Bedrohungen und Risiken führen. Im Falle des Nahen Ostens sind diese Bedrohungen vielfältig. Sie reichen von sozialer und wirtschaftlicher Instabilität innerhalb der Länder, über die Zunahme sektiererischer und ethnischer Konflikte bis hin zur Gefahr des internationalen Terrorismus. Diese Konflikte können auch zu humanitären Krisen, massiven Bevölkerungsverschiebungen und weltweiten Flüchtlingsproblemen führen. Das Fehlen einer wirksamen staatlichen Kontrolle kann auch dazu führen, dass nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen an Einfluss und Macht gewinnen. So konnte beispielsweise der Islamische Staat (IS) entstehen und große Gebiete im Irak und in Syrien unter seine Kontrolle bringen, indem er die Schwäche der lokalen Staaten und das herrschende Chaos ausnutzte. Dies verdeutlicht die Komplexität der Herausforderungen, die mit fehlender staatlicher Kontrolle und Instabilität einhergehen, sowie die Herausforderungen, die sich daraus für die internationale Sicherheit ergeben.
Unsere Vorstellung vom internationalen System ist stark im Konzept des Staates verankert. Der Staat wird allgemein als Hauptakteur in der internationalen Politik angesehen, der innerhalb seiner Grenzen für Sicherheit, Ordnung und Stabilität sorgt. Wenn ein Staat zusammenbricht oder nicht in der Lage ist, seine Autorität wirksam auszuüben, kann dies destabilisierende Folgen sowohl für das betroffene Land als auch für die internationale Gemeinschaft haben. Der Zusammenbruch eines Staates kann ein Machtvakuum erzeugen und so den Nährboden für das Entstehen nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen, interner Konflikte und allgemeiner Gewalt schaffen. Dies kann auch zu einer humanitären Krise führen, bei der Flüchtlinge vor Gewalt und Armut fliehen, was wiederum zu Spannungen in den Nachbarländern und darüber hinaus führen kann. Darüber hinaus kann die Unfähigkeit eines Staates, sein Territorium zu kontrollieren, auch eine Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellen. Dadurch kann ein Raum entstehen, in dem Terrorismus, organisierte Kriminalität und andere illegale Aktivitäten gedeihen können, mit potenziell schwerwiegenden Folgen über die Grenzen des betreffenden Staates hinaus. Aus diesen Gründen wird der Zusammenbruch von Staaten häufig als eine Hauptquelle für Instabilität und Unsicherheit im internationalen System angesehen. Daher ist es für die internationale Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung, zusammenzuarbeiten, um den Zusammenbruch von Staaten zu verhindern und bei der Wiederherstellung der Stabilität zu helfen, wenn er eintritt.
In der Geschichte der internationalen Beziehungen hat es Fälle gegeben, in denen ausländische Mächte autoritäre oder diktatorische Regime unterstützt haben, um die regionale Stabilität zu wahren, eine konkurrierende Ideologie einzudämmen, Zugang zu Ressourcen zu erhalten oder aus strategischen Gründen. Diese Praxis wirft jedoch erhebliche ethische Probleme auf und kann im Widerspruch zu den demokratischen Grundsätzen und den Menschenrechten stehen, die diese ausländischen Mächte häufig zu verteidigen vorgeben. Im Kontext der internationalen Politik kann die Unterstützung eines autoritären Regimes manchmal eine Präferenz für einen Staat widerspiegeln, der sein Land fest unter Kontrolle hat, selbst wenn dies auf Kosten der Menschenrechte oder der Demokratie geht. Dies ist eine Tendenz, die häufig aus der Sorge um die regionale Stabilität und die internationale Sicherheit resultiert. Die Idee dahinter ist, dass diese Regime zwar repressiv und undemokratisch sein können, aber auch ein gewisses Maß an Stabilität und Berechenbarkeit gewährleisten können. Sie können Chaos oder Gewalt verhindern, die sonst ohne eine starke staatliche Kontrolle entstehen könnten, und sie können auch als Gegengewicht zu anderen regionalen oder internationalen Kräften dienen, die als Bedrohung wahrgenommen werden.
Der Nationalstaat ist nach wie vor eine grundlegende Struktur, um unsere Gesellschaften und die Welt, in der wir leben, zu organisieren und zu verstehen. Durch den Staat definieren wir im Allgemeinen unsere nationale Identität, der Staat vertritt die Bürger auf der internationalen Bühne, und durch Staaten strukturieren wir am häufigsten unsere internationalen Interaktionen und Beziehungen. Der Nationalstaat ist auch ein Schlüsselinstrument für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die Gewährleistung der Rechte und Freiheiten der Bürger, die Bereitstellung grundlegender öffentlicher Dienstleistungen und die Gewährleistung der nationalen Sicherheit. Er steht somit für eine gewisse Stabilität und Berechenbarkeit in einer ansonsten komplexen und sich ständig verändernden Welt.
Der Begriff "postmoderne Kriegsführung" bezieht sich auf eine grundlegende Entwicklung der Kriegskunst, weg von den traditionellen Paradigmen, die mit Nationalstaaten verbunden sind, die sich aus politischen oder territorialen Gründen in einem Konflikt befinden. Im Kern der postmodernen Kriegsführung beobachten wir eine Entpolitisierung der Konflikte, bei der politische Motive oder territoriale Kontrolle durch eine Vielzahl von Faktoren wie ethnische, religiöse, wirtschaftliche oder ökologische Differenzen ersetzt werden. Diese neue Ära des Krieges ist auch durch eine Deterritorialisierung gekennzeichnet, bei der Konflikte nicht mehr auf bestimmte Regionen beschränkt sind, sondern länderübergreifend oder global werden können, wie der internationale Terrorismus oder Cyberkonflikte. Einer der beunruhigendsten Aspekte der postmodernen Kriegsführung ist die Privatisierung der Gewalt, bei der nichtstaatliche Akteure wie Terrorgruppen, private Milizen oder kriminelle Organisationen eine zunehmend prominente Rolle spielen. Gleichzeitig haben sich die Auswirkungen von Konflikten auf die Zivilbevölkerung verstärkt, mit direkten verheerenden Folgen wie Gewalt und indirekten wie Vertreibung, Hunger oder Krankheit.
Obwohl Demokratien weniger wahrscheinlich untereinander in den Krieg ziehen - ein Konzept, das als "demokratischer Frieden" bekannt ist - sind sie weiterhin in militärische Konflikte verwickelt. An diesen Konflikten sind häufig nichtdemokratische Länder beteiligt oder sie sind Teil internationaler Missionen zur Friedenssicherung oder zur Terrorismusbekämpfung. Die Länder des Nordens neigen auch dazu, andere Mittel als den konventionellen Krieg einzusetzen, um ihre außenpolitischen Ziele zu erreichen. Beispielsweise können sie Diplomatie, Wirtschaftssanktionen, Entwicklungshilfe und andere Instrumente der "Soft Power" einsetzen, um andere Nationen zu beeinflussen. Darüber hinaus hat die Technologie die Art des Krieges verändert. Insbesondere die Länder des Nordens neigen dazu, in ihrer Kriegsführung stark von fortgeschrittener Technologie abzuhängen. Der Einsatz von Drohnen, Cyberangriffen und anderen Formen der unkonventionellen Kriegsführung wird immer üblicher. Letztendlich bleibt die Anwendung militärischer Gewalt, auch wenn sich die Art und Weise der Kriegsführung ändern kann, leider ein Merkmal der internationalen Politik. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, weiterhin nach Wegen zu suchen, um Konflikte zu verhindern und den Weltfrieden und die Sicherheit zu fördern.
Auf dem Weg zu einem postmodernen Krieg[modifier | modifier le wikicode]
Die Art und Weise, wie Kriege geführt werden, hat sich vor allem für die westlichen Länder erheblich verändert. Dieser Wandel hat sich vor allem in einem stärkeren Einsatz von Technologie, einer zunehmenden Professionalisierung der Armeen und einer wachsenden Abneigung gegen den Verlust von Menschenleben, die oft als "Risikoallergie" bezeichnet wird, manifestiert. Das Konzept des "Western Way of War" betont die Präferenz für fortschrittliche Technologie und Luftüberlegenheit in der Kriegsführung. Mit der Entwicklung immer raffinierterer Waffen, dem Einsatz von Drohnen und der wachsenden Bedeutung des Cyberkriegs ist die Technologie zu einem Schlüsselelement der Kriegsführung geworden. Darüber hinaus hat die zunehmende Professionalisierung der Armeen zu einer intensiveren Ausbildung und einer stärkeren Spezialisierung der Soldaten geführt. Berufsarmeen sind immer häufiger anzutreffen und Einberufungen oder Drafts werden in den westlichen Ländern immer seltener. Die "Risikoallergie" wurde dadurch verschärft, dass es den westlichen Gesellschaften immer schwerer fällt, den Verlust von Menschenleben in Kriegszeiten zu akzeptieren. Dies führte zu einer Vorliebe für Luftschläge und den Einsatz von Drohnen, die es ermöglichen, militärische Operationen durchzuführen, ohne das Leben von Soldaten zu gefährden.
In der heutigen Zeit gibt es einen deutlichen Rückgang der sozialen Akzeptanz des Verlusts von Menschenleben in Kriegen, die im Ausland geführt werden. Die Bevölkerung ist immer weniger bereit, Konflikte zu unterstützen, die mit dem Verlust von Leben, insbesondere ihrer eigenen Bürger, einhergehen. Diese Situation wird zum Teil durch die allgegenwärtige und sofortige Berichterstattung über Konflikte in den Medien angeheizt, wodurch die menschlichen Kosten des Krieges für die breite Bevölkerung sichtbarer und realer werden. Gleichzeitig hat der technologische Fortschritt es ermöglicht, Kriege aus größerer Entfernung zu führen. Durch den Einsatz von Drohnen, Präzisionsraketen und anderen hochmodernen Technologien können Angriffe aus der Ferne durchgeführt werden, ohne dass eine direkte Gefahr für die Truppen vor Ort besteht. Diese Form der technologischen Kriegsführung ist größtenteils das Ergebnis der von den Staaten erleichterten technologischen Entwicklungen.
Der Einsatz von Drohnen in modernen Konflikten hat die Art der Kriegsführung radikal verändert. Die Steuerung von Drohnen ermöglicht es, militärische Operationen, einschließlich tödlicher Schläge, aus Tausenden von Kilometern Entfernung durchzuführen. Das Personal, das diese Drohnen steuert, tut dies oft von Stützpunkten außerhalb des Schlachtfeldes aus, manchmal sogar in einem anderen Land. Dies wirft eine Reihe von ethischen und moralischen Fragen auf. Einerseits kann dadurch das Risiko für die militärischen Kräfte, die diese Drohnen steuern, minimiert werden. Andererseits kann dies zu einer Entkopplung zwischen dem Akt des Tötens und der Realität des Krieges führen, was wiederum psychologische Folgen für die Bediener der Drohnen haben kann. Darüber hinaus kann dies dazu führen, dass die Entscheidung über die Anwendung von Gewalt weniger unmittelbar und persönlich getroffen wird, was potenziell die Schwelle für die Anwendung von Gewalt senken kann. Darüber hinaus hat der Einsatz von Drohnen auch strategische Auswirkungen. Er ermöglicht präzise Schläge mit minimalem Risiko für die Streitkräfte, kann aber auch zu zivilen Opfern und Kollateralschäden führen. Der Einsatz von Drohnen wirft daher wichtige Fragen im Bereich des humanitären Völkerrechts und der Haftung auf.
Die Frage ist, ob diese Distanzierung die Natur des Krieges verändert, ist dies eine Evolution, eine Revolution der militärischen Angelegenheiten mit dem Konzept des "Null-Todes"-Krieges, muss man Clausewitz überholen, wenn man zum Beispiel über Mary Kaldor spricht. Die Distanzierung des Krieges durch Technologie, insbesondere durch Drohnen, wirft die Frage auf, ob sich das Wesen des Krieges ändert. Die Möglichkeit, militärische Operationen durchzuführen, ohne das Leben der eigenen Soldaten direkt zu gefährden, verändert unbestreitbar die Erfahrung des Krieges und kann die Entscheidungsfindung über die Anwendung von Gewalt beeinflussen. Das Konzept des "Null-Toten-Kriegs" mag zwar aus der Sicht derjenigen, die den Krieg führen, attraktiv erscheinen, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch ein aus der Ferne geführter Krieg verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung haben und zum Verlust von Menschenleben führen kann. Die Frage, ob wir "über Clausewitz hinausgehen" sollten, ist ein Streitpunkt unter Militärtheoretikern. Clausewitz argumentierte, dass der Krieg eine Erweiterung der Politik mit anderen Mitteln ist. Auch wenn die Technologie die Art und Weise, wie Krieg geführt wird, verändert hat, kann argumentiert werden, dass das letztendliche Ziel dasselbe bleibt: politische Ziele zu erreichen. Aus dieser Perspektive ist das Denken von Clausewitz immer noch relevant. Allerdings haben Forscher wie Mary Kaldor darauf hingewiesen, dass sich die heutigen Formen der organisierten Gewalt von den traditionellen Kriegsmodellen unterscheiden können, die Clausewitz in Betracht gezogen hat. Die "neuen Kriege", so Kaldor, zeichnen sich durch innerstaatliche Gewalt, die Beteiligung nichtstaatlicher Akteure und die zunehmende Bedeutung von Identitäten anstelle von Ideologien aus. Diese Veränderungen könnten uns dazu veranlassen, einige der klassischen Kriegstheorien zu überdenken.
Wandelt sich der Krieg wirklich? Ist er etwas, das sich in den Ländern des Südens zunehmend entpolitisiert und letztlich etwas eminent Technisches ist, bei dem es keinen Bezug mehr zu dem gibt, was vor Ort passiert? Die Wahrnehmung des Krieges als etwas Entferntes und Technisches, insbesondere im Westen, mag ein zunehmendes Phänomen sein. Die Behauptung, dass der Krieg "entpolitisiert" wird, erfordert jedoch eine differenziertere Analyse.
In den Ländern des Südens nehmen zwar innerstaatliche Konflikte und Gewalt durch nichtstaatliche Akteure zu, doch bleiben diese Konflikte zutiefst politisch. Sie können mit Kämpfen um die Kontrolle von Ressourcen, ethnischen oder religiösen Unterschieden, dem Streben nach Selbstbestimmung oder Reaktionen auf Korruption und schlechte Regierungsführung zusammenhängen. Darüber hinaus kann organisierte Gewalt erhebliche politische Auswirkungen haben, indem sie Machtstrukturen beeinflusst, die Beziehungen zwischen Gruppen verändert und die politische Zukunft eines Landes gestaltet. In den Ländern des Nordens kann der Einsatz von Technologien wie Drohnen den Eindruck einer "Entmenschlichung" des Krieges erwecken, bei dem Gewaltakte aus der Ferne und scheinbar losgelöst verübt werden. Diese Herangehensweise an den Krieg kann jedoch ihre eigenen politischen Implikationen haben. Beispielsweise kann die scheinbare Leichtigkeit, mit der Gewalt aus der Ferne zugefügt werden kann, Entscheidungen darüber beeinflussen, wann und wie Gewalt angewendet wird. Darüber hinaus kann die Art und Weise, wie diese Technologien eingesetzt und reguliert werden, wichtige politische Debatten auslösen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass, auch wenn sich das Wesen und die Führung des Krieges verändern können, der Krieg ein zutiefst politisches Unterfangen bleibt und seine Folgen weit über das Schlachtfeld hinaus spürbar sind.
Wir sprechen über all die Kriege, die wir auf den Bildschirmen sehen, wie zum Beispiel den Golfkrieg in den 1990er Jahren, der weit weg zu sein scheint, weil wir ihn nicht einmal mehr durch unsere Familien oder unsere eigenen Erfahrungen erleben. Der Golfkrieg in den 1990er Jahren war ein Wendepunkt in der Art und Weise, wie der Krieg von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Dieser Krieg wurde in den Medien stark thematisiert, wobei Bilder des Krieges live im Fernsehen übertragen wurden. Dies hat dazu beigetragen, eine gewisse Distanz zwischen der Öffentlichkeit und dem tatsächlichen Konflikt zu schaffen. Wenn man den Krieg durch den Fernsehbildschirm betrachtet, kann er weit entfernt und von unserem Alltag abgekoppelt erscheinen. Diese Distanz kann auch durch die Tatsache verstärkt werden, dass immer weniger Menschen in den westlichen Ländern direkte Erfahrungen mit dem Militärdienst haben. Während der Wehrdienst früher für viele Männer (und einige Frauen) eine gemeinsame Erfahrung war, haben viele Länder heute vollständig professionelle Armeen. Das bedeutet, dass der Krieg von einem kleineren Prozentsatz der Bevölkerung direkt erlebt wird. Obwohl der Krieg für viele Menschen in den westlichen Ländern weit weg zu sein scheint, hat er sehr reale Folgen für diejenigen, die direkt daran beteiligt sind, sei es für die in Konfliktgebieten eingesetzten Soldaten oder für die betroffene lokale Bevölkerung. Darüber hinaus kann ein Konflikt, auch wenn er geografisch weit entfernt zu sein scheint, indirekte Folgen durch Phänomene wie Flüchtlingsströme, wirtschaftliche Auswirkungen oder Bedrohungen der internationalen Sicherheit haben.
Anhänge[modifier | modifier le wikicode]
- Leander, Anna. Wars and the Un-Making of States: Taking Tilly Seriously in the Contemporary World
- Goldstone , Jack A. States Making Wars Making States Making Wars... in Contemporary Sociology, Vol. 20, No. 2 (Mar., 1991), pp. 176-178. Url: https://www.jstor.org/stable/pdf/2072886.pdf?acceptTC=true
- Kaldor, Mary. New & Old Wars. Stanford, CA: Stanford UP, 2007. Print.
- La naissance de la guerre moderne : war-making et state-making dans une perspective occidentale
- Tilly, Charles. War Making and State Making as Organized Crime. url: http://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/q3/28/02/reading_response_4_2.pdf
- NATO StratCom COE; Mark Laity. (2018, August 10). What is War?. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Gj-wsdGL4-M