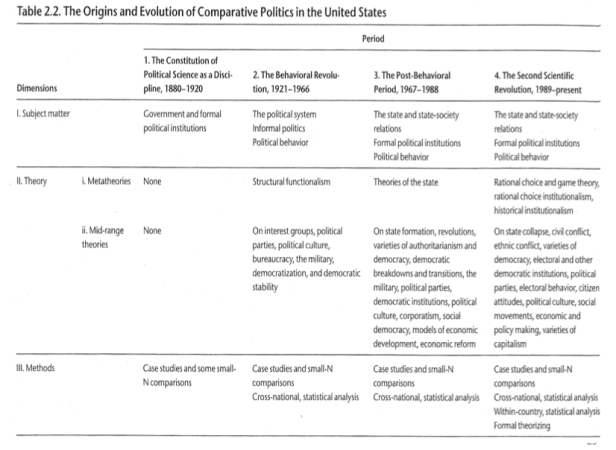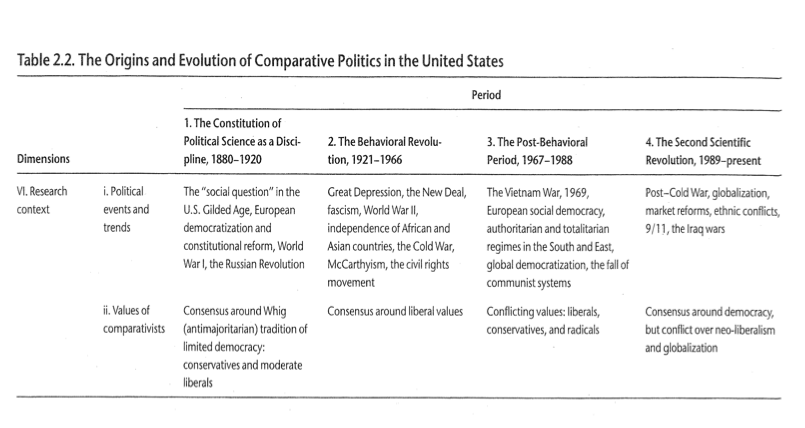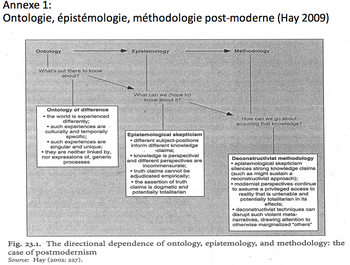Geschichte der Disziplin Politikwissenschaft: Theorien und Konzepte
La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu ● Aux origines de la chute de la République de Weimar ● La pensée sociale de Max Weber et Vilfredo Pareto ● La notion de « concept » en sciences-sociales ● Histoire de la discipline de la science politique : théories et conceptions ● Marxisme et Structuralisme ● Fonctionnalisme et Systémisme ● Interactionnisme et Constructivisme ● Les théories de l’anthropologie politique ● Le débat des trois I : intérêts, institutions et idées ● La théorie du choix rationnel et l'analyse des intérêts en science politique ● Approche analytique des institutions en science politique ● L'étude des idées et idéologies dans la science politique ● Les théories de la guerre en science politique ● La Guerre : conceptions et évolutions ● La raison d’État ● État, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveaux ● Les théories de la violence en science politique ● Welfare State et biopouvoir ● Analyse des régimes démocratiques et des processus de démocratisation ● Systèmes Électoraux : Mécanismes, Enjeux et Conséquences ● Le système de gouvernement des démocraties ● Morphologie des contestations ● L’action dans la théorie politique ● Introduction à la politique suisse ● Introduction au comportement politique ● Analyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publique ● Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation ● Analyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluation ● Introduction à la sous-discipline des relations internationales
Die Politikwissenschaft, wie wir sie heute kennen, ist in der Tat eine relativ junge Disziplin. Ihre Entwicklung als eigenständiges akademisches Studienfeld liegt etwa ein Jahrhundert zurück. Die Grundlagen des politischen Denkens lassen sich jedoch in weitaus älteren philosophischen und literarischen Werken finden.
Die Tradition des westlichen politischen Denkens hat ihre Wurzeln in der Tat im antiken Griechenland mit Denkern wie Platon und Aristoteles. Ihre Schriften zu Themen wie Gerechtigkeit, Macht, Autorität, Rolle des Staates, Staatsbürgerschaft und Regierungsführung legten den Grundstein für das Nachdenken über die Politik. Diese Ideen wurden dann im Laufe der Jahrhunderte von Denkern wie Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Marx und vielen anderen weiterentwickelt und bereichert. Allerdings hat sich die Politikwissenschaft erst im Laufe des 20. Jahrhunderts als eigenständiges akademisches Feld mit eigenen Institutionen, akademischen Zeitschriften und Forschungsmethoden herausgebildet. Dies fiel mit einer Bewegung hin zu einem empirischeren und wissenschaftlicheren Ansatz für das Studium der Politik zusammen, der sich durch den Einsatz quantitativer Methoden und einen besonderen Schwerpunkt auf der Systematisierung und Überprüfung von Theorien auszeichnet.
Heute ist die Politikwissenschaft eine vielfältige Disziplin, die eine Vielzahl von Unterfeldern umfasst, wie z. B. politische Theorie, vergleichende Politik, internationale Beziehungen, öffentliche Politik, öffentliche Verwaltung und Geschlechterpolitik, um nur einige zu nennen. Doch trotz dieser Vielfalt teilen alle Wissenschaftler der Politikwissenschaft ein gemeinsames Interesse am Verständnis politischer Phänomene.
Die Definition der Politikwissenschaft: Eine intellektuelle Herausforderung
Laut Harold Lasswell in seinem Buch "Politics: Who Gets What, When, How" aus dem Jahr 1936 wird die Politikwissenschaft dadurch definiert, wer was wann und wie bekommt.[1] Mit anderen Worten: Es geht um den ewigen Kampf innerhalb der Gesellschaft um die Kontrolle über knappe Ressourcen. Diese Konflikte, sowohl zwischen Individuen als auch zwischen sozialen Gruppen, werden durch den Wunsch hervorgerufen, die Ressourcen einer Gesellschaft, die unweigerlich begrenzt sind, untereinander aufzuteilen. Diese Perspektive legt den Schwerpunkt auf die Konflikte im Zusammenhang mit der Umverteilung knapper Ressourcen in einer Gesellschaft.
Robert E. Goodin sieht in seinem 2009 veröffentlichten "The State of the Discipline, The Discipline of the State" Politik als den begrenzten Einsatz sozialer Macht, der als Essenz des Politischen dargestellt wird.[2] Das zentrale Konzept hier ist der Begriff der Macht, ein Thema, das in den Sozialwissenschaften umfassend erforscht wurde. Nach Max Weber ist die Macht von A über B die Fähigkeit von A, B dazu zu bringen, etwas zu tun, was B ohne das Eingreifen von A nicht getan hätte. Diese allgemeine Definition bezieht sich auf die Fähigkeit, andere Individuen, Gruppen oder Staaten zu beeinflussen, indem man ihr Verhalten erzwingt. Eine der Interessen dieser Definition besteht darin, zu zeigen, dass Macht relational ist. Goodin zufolge kann Macht viele Formen annehmen, ist aber immer begrenzt, da selbst die Mächtigsten den Beherrschten ihren Willen nicht durch Zwang aufzwingen können. Macht ist also vielschichtig, aber immer gezwungen, und die Politikwissenschaft hat die Aufgabe, diese Machtbeziehungen auf verschiedenen Ebenen darzustellen.
Goodin schlägt auch eine andere Definition vor, nach der die Politikwissenschaft die Disziplin des Staates ist. Hier wird der Staat als eine Ansammlung von Normen, Institutionen und Machtbeziehungen verstanden. Was die Normen betrifft, so ist die Geschichte des modernen Staates eng mit der liberalen Demokratie verbunden, mit spezifischen Normen wie Gewaltenteilung, politischer Wettbewerb, individuelle politische Partizipation und politische Verantwortung der gewählten Vertreter gegenüber den Wählern. Der Staat ist auch eine Reihe von Institutionen, die verschiedene Formen des Politischen verkörpern. Der Staat wäre somit der bevorzugte Ort für Machtbeziehungen zwischen Individuen und Gruppen.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die Politikwissenschaft einen bedeutenden Autonomieprozess durchlaufen und sich von verwandten Disziplinen, insbesondere der Geschichte, abgegrenzt. Historisch gesehen wurde die Politikwissenschaft weitgehend als Unterdisziplin der Geschichte betrachtet, da sie sich weitgehend auf die Untersuchung der Geschichte von Institutionen, politischen Ideen und sozialen Bewegungen stützte. Im Zuge der Entwicklung der Disziplin im 20. Jahrhundert begann die Politikwissenschaft jedoch, ihre eigenen methodischen Ansätze, theoretischen Rahmen und Anwendungsbereiche zu entwickeln. Einer der Schlüsselfaktoren dieser Autonomisierung war die Entwicklung quantitativer Methoden und die Anwendung der Spieltheorie, der Rationalitätstheorie und anderer Konzepte aus der Psychologie und der Ökonomie zur Analyse des politischen Verhaltens. Diese methodischen Fortschritte haben es der Politikwissenschaft ermöglicht, sich von den Methoden der narrativen Geschichtsforschung zu entfernen und sich zu einer stärker analytischen und datenorientierten Disziplin zu entwickeln. Darüber hinaus hat die Politikwissenschaft ihr Untersuchungsfeld schrittweise auf eine breitere Palette politischer Phänomene ausgeweitet, darunter die Analyse des Wahlverhaltens, die Untersuchung von Entscheidungsprozessen innerhalb politischer Institutionen und das Verständnis internationaler Machtdynamiken. Schließlich haben die Einrichtung unabhängiger politikwissenschaftlicher Abteilungen an den Universitäten und die Veröffentlichung von Fachzeitschriften die Identität des Fachs als eigenständigen Bereich der akademischen Forschung gestärkt.
Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler James Duesenberry betont die unterschiedlichen Perspektiven, die Wirtschaft und Soziologie bei der Untersuchung des menschlichen Verhaltens einnehmen: "Die Wirtschaft spricht nur darüber, wie Individuen Entscheidungen treffen, die Soziologie spricht nur darüber, dass sie keine Wahl haben". [3] In der Ökonomie liegt der Schwerpunkt auf der Vorstellung, dass Individuen rationale Akteure sind, die Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Präferenzen und der ihnen auferlegten Beschränkungen, wie Einkommen oder Zeit, treffen. Dies stützt sich auf das Konzept des Wirtschaftsmenschen oder "homo oeconomicus", eines hypothetischen Individuums, das stets bestrebt ist, seinen Nutzen oder sein Wohlergehen zu maximieren, indem es rationale Entscheidungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen trifft. Andererseits befasst sich die Soziologie stärker mit dem sozialen und kulturellen Kontext, in den die Menschen gestellt werden, und wie diese Umgebungen ihr Verhalten und ihre Lebensoptionen prägen. Mit anderen Worten: Die Soziologie beleuchtet häufig, wie soziale Strukturen die individuellen Entscheidungen einschränken oder bestimmen. Beispielsweise kann eine Person, die in eine bestimmte soziale Schicht hineingeboren wurde, andere Möglichkeiten haben als eine Person, die in eine andere soziale Schicht hineingeboren wurde, was ihre Entscheidungen in Bezug auf Bildung, Beschäftigung oder sogar Lebensstil einschränken kann. So veranschaulicht Duesenberry die Spannung zwischen dem methodologischen Individualismus, der typisch für die Wirtschaft ist, und dem methodologischen Holismus, der eher für die Soziologie charakteristisch ist. Wichtig ist, dass es sich hierbei um zwei komplementäre Ansätze zum Verständnis des menschlichen Verhaltens und der Gesellschaft handelt, die jeweils einzigartige und wertvolle Einsichten bieten.
Was Duesenberry sagt, verdeutlicht zwei konträre Auffassungen des Menschen in der neoklassischen Soziologie und Ökonomie. Zum einen tendiert die Soziologie zu einem "übersozialisierten" Menschenbild, bei dem das Verhalten des Einzelnen weitgehend von externen sozialen Kräften bestimmt wird. Mit anderen Worten: In diesem Modell wird das Individuum weitgehend von der sozialen Struktur, in der es lebt, beeinflusst. Dazu können Faktoren wie kulturelle Normen, soziale Rollen, soziale Erwartungen und soziale Institutionen gehören. In dieser Sichtweise hat der Einzelne nur einen begrenzten Handlungsspielraum, um außerhalb der sozialen Erwartungen und Zwänge zu handeln. Andererseits neigt die neoklassische Ökonomie zu einem "untersozialisierten" Menschenbild, bei dem das Individuum als relativ unabhängig von sozialen Einflüssen operierend gesehen wird. In diesem Modell wird das Individuum hauptsächlich als rationaler Wirtschaftssubjekt betrachtet, das versucht, sein persönliches Wohlergehen zu maximieren, indem es rationale Entscheidungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen trifft. Soziale Interaktionen werden häufig als wirtschaftliche Transaktionen gesehen, bei denen die Individuen Güter und Dienstleistungen austauschen, um ihren Nutzen zu maximieren. Diese beiden gegensätzlichen Auffassungen vom Menschen verdeutlichen die Spannung zwischen Individualismus und Kollektivismus bei der Analyse des menschlichen Verhaltens. Sie betonen auch, wie wichtig es ist, sowohl individuelle als auch soziale Faktoren zu berücksichtigen, um menschliches Verhalten und menschliche Gesellschaften zu verstehen.
Marx hebt die Spannung zwischen der Fähigkeit der Individuen, ihre eigene Geschichte zu gestalten, und den durch die bestehenden gesellschaftlichen und historischen Bedingungen auferlegten Zwängen hervor: "Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht willkürlich unter den von ihnen gewählten Bedingungen, sondern unter den unmittelbar gegebenen und von der Vergangenheit ererbten Bedingungen. Die Tradition aller toten Generationen lastet mit einem sehr schweren Gewicht auf dem Gehirn der Lebenden. Und selbst wenn es scheint, dass sie damit beschäftigt sind, sich selbst und die Dinge zu verwandeln, um etwas völlig Neues zu schaffen, ist es gerade in diesen revolutionären Krisenzeiten, dass sie ängstlich die Geister der Vergangenheit heraufbeschwören, dass sie sich ihre Namen, ihre Parolen, ihre Kostüme von ihnen borgen, um auf der neuen Bühne der Geschichte in dieser ehrbaren Verkleidung und mit dieser geliehenen Sprache zu erscheinen". [4].
Marx erkennt an, dass die Individuen eine aktive Rolle bei der Gestaltung ihrer eigenen Geschichte spielen. Er argumentiert jedoch, dass dieser Prozess nicht willkürlich ist, sondern stark von den gegebenen und ererbten sozialen und historischen Bedingungen der Vergangenheit beeinflusst wird. Der zweite Teil des Zitats verdeutlicht, wie Individuen in Zeiten des Wandels und der Revolution häufig auf die Vergangenheit zurückblicken. Selbst wenn sie versuchen, etwas Neues zu schaffen, greifen sie oft auf historische Bezüge zurück und leihen sich Namen, Parolen und Kostüme aus der Vergangenheit. Dies zeigt laut Marx, wie schwer die Vergangenheit auf der Gegenwart lastet, selbst in Momenten radikaler Veränderung. Alles in allem sieht Marx die Geschichte nicht als bloßes Produkt menschlicher Handlungen, sondern als komplexes Zusammenspiel zwischen individueller Agency und gesellschaftlichen und historischen Strukturen. Er betont, wie die Vergangenheit die Möglichkeiten der Veränderung in der Gegenwart informiert und begrenzt.
Das Marx-Zitat veranschaulicht die komplexe Wechselwirkung zwischen individueller Agency - also der Fähigkeit von Menschen, autonom zu handeln und Entscheidungen zu treffen - und den sozialen und institutionellen Strukturen, in denen sie sich befinden. Zu diesen Strukturen können politische und wirtschaftliche Institutionen, kulturelle Normen, Klassenstrukturen, Umweltzwänge und vieles mehr gehören. Die von Marx beschriebene Spannung ist die zwischen Freiheit und Determination: Einerseits sind die Individuen frei, Entscheidungen zu treffen und zu handeln; andererseits werden ihre Handlungsmöglichkeiten durch Strukturen geformt und eingeschränkt, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen und größtenteils ein Produkt der Geschichte sind. Beispielsweise kann sich ein Einzelner dafür entscheiden, hart zu arbeiten, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, aber sein Erfolg hängt auch von strukturellen Faktoren wie der verfügbaren Bildung und den wirtschaftlichen Möglichkeiten, der sozialen und wirtschaftlichen Herkunft, dem breiteren politischen und wirtschaftlichen Kontext und anderen Faktoren ab, die größtenteils von der Geschichte und der Gesellschaft, in der er lebt, bestimmt werden. Darüber hinaus sind diese Strukturen nicht nur Einschränkungen, sondern prägen auch die Art und Weise, wie der Einzelne die Welt wahrnimmt und interpretiert, und beeinflussen so seine Bestrebungen, seine Motivationen und seine Vorstellung von dem, was möglich oder wünschenswert ist. Marx erinnert uns daran, dass die Menschen zwar Geschichte machen, dies aber unter Bedingungen tun, die sie nicht selbst gewählt, sondern von der Vergangenheit geerbt haben.
Von den antiken Ursprüngen zu modernen Theorien
Das antike Griechenland, insbesondere das 5. Jahrhundert v. Chr., wird oft als die Wiege des westlichen politischen Denkens angesehen. Während dieser Zeit, die auch als das Goldene Zeitalter Athens bekannt ist, wurden viele grundlegende politische Konzepte entwickelt und diskutiert.
Im antiken Griechenland war die Politik ein zentrales Anliegen der Philosophie. Die Denker dieser Epoche konzentrierten sich auf die Analyse politischer Ideen und Ideale, erforschten die Eigenschaften verschiedener politischer Systeme und stellten Fragen über das Wesen der Staatsbürgerschaft, die Rolle und das Handeln der Regierungen sowie die Einmischung des Staates in öffentliche Angelegenheiten und die Außenpolitik.
Zwei Symbolfiguren dieser Epoche sind Platon und Aristoteles. Platon erforschte in seinem Werk "Die Republik" die Fragen der Gerechtigkeit, der Gleichheit und der besten Regierungsform. Sein Schüler Aristoteles untersuchte in seiner "Politik" die verschiedenen Regierungsformen, die Staatsbürgerschaft und das Wesen der politischen Gemeinschaft. Diese Schriften legten den Grundstein für das westliche politische Denken und hatten einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Politikwissenschaft.
Platon, ein griechischer Philosoph der Antike (427-347 v. Chr.), wird oft als einer der Gründerväter der Politikwissenschaft angesehen. Sein berühmtes Werk "Die Republik" ist ein bedeutender Text nicht nur für die Philosophie, sondern auch für das politische Denken. In "Die Republik" entwirft Platon eine Typologie der verschiedenen politischen Systeme. Er unterscheidet insbesondere die Monarchie (die er "Königtum" nennt), die Aristokratie, die Timokratie (eine auf Ehre basierende Regierung), die Oligarchie, die Demokratie und die Tyrannis. Jedes Regime wird nach seiner Gerechtigkeit und Effizienz beurteilt. Neben dieser Typologie bietet Platon auch eine Vision dessen, was er für den idealen Staat hält. Für ihn ist eine gerechte Gesellschaft diejenige, in der jedes Individuum die Funktion erfüllt, die ihm am besten entspricht. Gemäß seiner berühmten Drei-Klassen-Theorie sollte die Gesellschaft in Regierende (die "Wächter"), Hilfskräfte (die "Krieger") und Produzenten (die Handwerker und Landwirte) unterteilt werden. Platons Beitrag zur Politikwissenschaft beschränkt sich nicht auf die "Republik". In anderen Werken, wie z. B. "Die Gesetze", untersucht er weiterhin Fragen der politischen und sozialen Organisation. Seine Ideen hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf das westliche politische Denken und werden auch heute noch von zeitgenössischen Politikwissenschaftlern untersucht und diskutiert.
Aristoteles (384-322 v. Chr.) ist ein weiterer wichtiger Denker des antiken Griechenlands und ein wesentlicher Beitrag zur Politikwissenschaft. Sein Werk "Die Politik" ist ein grundlegender Text des politischen Denkens, in dem er viele Fragen behandelt, die bis heute zentral für die Disziplin sind. Im Gegensatz zu Platon verfolgt Aristoteles bei der Untersuchung politischer Angelegenheiten einen empirischen und induktiven Ansatz. Anstatt mit abstrakten Ideen zu beginnen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten, zog es Aristoteles vor, bestehende Gesellschaften zu beobachten und daraus zu lernen. Er ist dafür bekannt, dass er 158 Verfassungen griechischer Städte studierte, um die Natur und die Vorteile verschiedener politischer Systeme zu verstehen. In der "Politik" stellt Aristoteles auch seine eigene Typologie der politischen Systeme vor, die er in sechs Formen unterteilt: Monarchie, Aristokratie, Polity (eine Mischung aus Aristokratie und Demokratie), Tyrannis, Oligarchie und Demokratie. Jede dieser Formen wird auf ihre Vor- und Nachteile hin analysiert, und Aristoteles argumentiert für die Polity als beste Regierungsform. Darüber hinaus ist Aristoteles berühmt für seine Auffassung, dass Politik grundsätzlich mit der Frage des menschlichen Wohlergehens verbunden ist. Seiner Ansicht nach besteht der Zweck der Stadt (polis) darin, ihren Bürgern ein gutes Leben zu ermöglichen. Diese Sicht der Politik hatte einen nachhaltigen Einfluss auf das westliche politische Denken.
Während der Zeit des antiken Griechenlands kristallisierten sich zwei Hauptthemen heraus, die auch heute noch eine zentrale Stellung in der Politikwissenschaft einnehmen:
- Institutionelle Formen des Politischen: Diese Frage untersucht die verschiedenen Arten von institutionellen Vereinbarungen, die den politischen Bereich strukturieren. Dazu gehören verschiedene Regierungsformen, Wahlsysteme, Gewaltenteilung, die Beziehungen zwischen Regierung und Bürgern usw. Im antiken Griechenland analysierten politische Denker wie Aristoteles eine Vielzahl von Verfassungen von Stadtstaaten, um ihre Merkmale und Funktionsweisen zu verstehen.
- Die Bewertung institutioneller Formen: Dieses Thema ist mit der normativen Frage verbunden, welches die besten Formen der Regierung oder politischen Organisation sind. Dies beinhaltet oftmals eine Reflexion über politische und ethische Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit usw. Beispielsweise entwarf Platon in seiner Republik eine Idealvorstellung des Stadtstaates, während Aristoteles für die Polity (eine Mischung aus Aristokratie und Demokratie) als beste Regierungsform argumentierte.
Beide Themen finden sich immer wieder in den Debatten und Forschungen der zeitgenössischen Politikwissenschaft, wenn auch mit neuen Nuancen und unterschiedlichen methodologischen Ansätzen.
Die Erneuerung der Ideen während der Renaissance
Das Mittelalter war stark vom christlichen Denken und der Theorie des Naturrechts beeinflusst. Letztere ging von der Existenz eines universellen, aus der göttlichen Transzendenz abgeleiteten Gesetzes aus, das das menschliche Verhalten und die Grundsätze der Gerechtigkeit diktieren würde. Aus dieser Perspektive sollte der Staat oder die Stadt ihre Institutionen und ihre Regierungsführung in Übereinstimmung mit diesem Naturgesetz strukturieren.
Die mit der Renaissance verbundenen philosophischen und intellektuellen Veränderungen bedeuteten jedoch einen Bruch mit dieser Tradition. Ab dieser Zeit begann sich das politische Denken einer humanistischeren und säkulareren Sichtweise zuzuwenden, die sich auf den Menschen und nicht auf die Gottheit konzentrierte. Politische Denker begannen, neue Konzepte von Macht, Souveränität und Staat zu erforschen, und markierten damit eine neue Phase in der Entwicklung der Politikwissenschaft.
Machiavelli (1469 - 1527) ist bekannt für seine politische Abhandlung "Der Fürst", in der er Fragen der Legitimität politischer Systeme und Herrscher erforscht. Er wird oft als Vorläufer der realistischen Schule angesehen, die im 20. Jahrhundert die realistische Theorie der internationalen Beziehungen hervorgebracht hat. Im Bruch mit dem damals vorherrschenden christlichen Denken, das Moral als Selbstzweck sah, betrachtete Machiavelli die Moral auch als Mittel zum Zweck, um politische Ziele zu erreichen. Seiner Ansicht nach kann die Moral als Instrument eingesetzt werden, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Diese instrumentalistische Sicht der Moral stellt einen bedeutenden Bruch mit früheren Auffassungen dar und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf das spätere politische Denken.
Jean Bodin (1529 - 1596) ist hauptsächlich als Theoretiker der staatlichen Souveränität bekannt. In seinem Hauptwerk "Die sechs Bücher der Republik" legt er das Wesen des Staates dar, das sich seiner Meinung nach durch den Begriff der Souveränität definiert. Für Bodin ist die Souveränität das grundlegende Attribut des Staates, der die letzte und unabhängige Macht über sein Territorium und seine Bevölkerung innehat. Diese Auffassung von Souveränität hat die politische Theorie tiefgreifend beeinflusst und bildet die Grundlage für unser modernes Verständnis des Nationalstaats.
Die Epoche der Aufklärung war eine Zeit der intellektuellen Blüte und wichtiger Beiträge zur politischen Theorie. Bedeutende Philosophen und Denker wie Hobbes, Locke, Hume und Smith legten den Grundstein für viele der grundlegenden Konzepte in der angelsächsischen Tradition der Politikwissenschaft. Thomas Hobbes (1588 - 1679) entwickelte in seinem Werk "Leviathan" eine Theorie über den Absolutismus und den Gesellschaftsvertrag und schlug vor, dass die Menschen bereit sind, einen Teil ihrer Freiheit an einen Herrscher abzutreten, um im Gegenzug Sicherheit zu erhalten. John Locke (1632 - 1704), der oft als Vater des Liberalismus bezeichnet wird, entwickelte in seinen "Zwei Abhandlungen über die Regierung" eine Theorie der Regierung, die auf der Zustimmung der Regierten beruht, und legte den Grundstein für die Theorie der Naturrechte. David Hume (1711 - 1776) wiederum leistete einen Beitrag zur politischen Theorie, indem er die Grundlagen der Gesellschaft und des Regierens untersuchte, insbesondere in seinen "Essays über den Handel". Adam Smith (1723 - 1790) ist vor allem für sein Werk "Der Wohlstand der Nationen" bekannt, in dem er die Theorie der Marktwirtschaft und das Konzept der "unsichtbaren Hand" formulierte. Alexander Hamilton (1755 - 1804) schließlich ist einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten und spielte eine entscheidende Rolle bei der Ausarbeitung der US-Verfassung und der Definition des amerikanischen Regierungssystems. Diese Denker haben unterschiedliche und sich ergänzende Perspektiven auf Themen wie die Rolle des Staates, das Wesen der individuellen Rechte, die Organisation der Wirtschaft und die Regierungsstruktur eingebracht, die die zeitgenössische Politikwissenschaft nach wie vor beeinflussen.
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (1689 - 1755), allgemein bekannt als Montesquieu, ist einer der einflussreichsten französischen Philosophen auf dem Gebiet der Politikwissenschaft. In seinem 1748 veröffentlichten Werk "De l'Esprit des Lois" (Vom Geist der Gesetze) formulierte er wesentliche Ideen zur Strukturierung der politischen Macht in einer Gesellschaft. Montesquieu schlug eine Aufteilung der politischen Macht in drei verschiedene Zweige vor: die Legislative (die Gesetze macht), die Exekutive (die die Gesetze ausführt) und die Judikative (die die Gesetze auslegt und anwendet). Diese Idee, die als Theorie der Gewaltenteilung bekannt ist, hatte einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung moderner politischer Institutionen, insbesondere in demokratischen Systemen. Laut Montesquieu soll die Gewaltenteilung Machtmissbrauch verhindern und die persönlichen Freiheiten garantieren, indem sie ein System der Kontrolle und des Gleichgewichts ("checks and balances") zwischen den verschiedenen Gewalten schafft. Die Theorie der Gewaltenteilung hat insbesondere die Ausarbeitung der Verfassung der Vereinigten Staaten beeinflusst und ist auch heute noch in vielen Ländern ein Grundprinzip des Verfassungsrechts.
Ende des 18. - 19. Jahrhunderts: Eine Übergangszeit
Im späten 18. und 19. Jahrhundert traten mehrere wichtige Denker auf, die die Sozialtheorie und die Politikwissenschaft stark beeinflusst haben. Sie entwickelten komplexe Theorien über die Struktur der Gesellschaft, das Wesen der Macht, die Beziehungen zwischen Individuen und Gruppen und andere Aspekte des Funktionierens der Gesellschaft.
Jahrhunderts bis ins 19. Jahrhundert hinein entstanden im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland oder auch in Italien mehrere einflussreiche Denker. Diese Denker spielten wichtige Rollen bei der Entwicklung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Philosophie. Ihre Arbeit beeinflusste verschiedene Bereiche, darunter die Soziologie, die Philosophie und die Politikwissenschaft.
- Adam Smith (1723-1790): Smith, der als Vater der modernen Wirtschaft bekannt ist, legte die Grundlagen der Marktwirtschaft und der Arbeitsteilung. In seinem Werk "Der Wohlstand der Nationen" stellte er das Prinzip der "unsichtbaren Hand" auf, das freie Märkte lenkt.
- David Ricardo (1772-1823) : Ricardo war ein einflussreicher Ökonom, der vor allem für seine Arbeitswerttheorie und seine Theorie der komparativen Vorteile bekannt ist, die auch heute noch die Grundlage für die meisten Argumente für den Freihandel bildet. Sein bekanntestes Werk ist "Über die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung".
- John Stuart Mill (1806-1873): Mill ist einer der bedeutendsten Denker des Liberalismus. In seinem Werk "Über die Freiheit" verteidigte er die individuelle Freiheit gegen die Einmischung des Staates. Er trug auch zur utilitaristischen Theorie bei und behauptete, dass Handlungen nach ihrem Nutzen oder ihrer Fähigkeit, Glück zu erzeugen, beurteilt werden sollten.
- Auguste Comte (1798-1857): Comte gilt als Vater der Soziologie und führte das Konzept des Positivismus ein, das die Anwendung der wissenschaftlichen Methode zum Verständnis und zur Erklärung der sozialen Welt befürwortet.
- Alexis de Tocqueville (1805-1859): Tocqueville ist vor allem für seine Analyse der amerikanischen Demokratie in seinem Werk "De la démocratie en Amérique" (Über die Demokratie in Amerika) bekannt. Er war auch ein scharfsinniger Beobachter der sozialen und politischen Trends seiner Zeit, einschließlich des Aufstiegs der Gleichheit und des demokratischen Despotismus.
- Herbert Spencer (1820-1903) : Spencer hatte einen bedeutenden Einfluss vertrat eine Philosophie des sozialen und wirtschaftlichen "Laissez-faire" und ist dafür bekannt, Darwins Evolutionstheorie auf die menschliche Gesellschaft angewandt zu haben, ein Konzept, das oft in dem Satz "survival of the fittest" zusammengefasst wird.
- Émile Durkheim (1858-1917) : Durkheim ist ein weiterer Gründungsvater der Soziologie. Er betonte die Bedeutung sozialer Institutionen und führte Konzepte wie das soziale Faktum, Anomie und soziale Solidarität ein. Seine Arbeit legte den Grundstein für die funktionalistische Soziologie.
- Karl Marx (1818-1883): Marx ist einer der einflussreichsten Denker der modernen Geschichte. Gemeinsam mit Friedrich Engels entwickelte er den Marxismus, eine kritische Theorie des Kapitalismus und der Klassengesellschaft. Seine Werke, darunter "Das Manifest der Kommunistischen Partei" und "Das Kapital", legten die Grundlagen für Sozialismus und Kommunismus und beeinflussten eine Vielzahl von Disziplinen, darunter Politikwissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften.
- Max Weber (1864-1920): Weber gilt als einer der Begründer der modernen Soziologie. Seine Arbeiten befassten sich mit einem breiten Spektrum an Themen, darunter Bürokratie, Autorität, Religion und Kapitalismus. Sein Konzept der "Überzeugungsethik" und der "Verantwortungsethik" wird in der politischen Analyse noch immer häufig verwendet. Sein Werk "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" wird oft als Standardstudie über den Einfluss der Religion auf die wirtschaftliche Entwicklung zitiert.
- Vilfredo Pareto (1848-1923) : Der italienische Ökonom und Soziologe Pareto ist vor allem für seine Arbeiten über die Verteilung des Wohlstands und seine Elitentheorie bekannt. Er führte das Konzept des "Pareto-Optimums" in die Wirtschaft ein, das besagt, dass ein Zustand optimal ist, wenn keine Verbesserung erreicht werden kann, ohne dass sich die Situation eines Individuums verschlechtert.
- Gaetano Mosca (1858-1941) : Ebenfalls ein Elitentheoretiker, betonte Mosca die Idee, dass in jeder Gesellschaft immer eine organisierte Minderheit eine unorganisierte Mehrheit regieren wird. Sein bekanntestes Werk, "Die politische Klasse", führt diese Theorie detailliert aus.
- Robert Michels (1876-1936) : Der italienische Soziologe deutscher Abstammung Michels ist für seine "Theorie der eisernen Oligarchie" bekannt. In seinem Buch "Die politischen Parteien" argumentiert er, dass alle Organisationsformen, ob demokratisch oder nicht, aufgrund der bürokratischen Tendenzen, die jeder Organisation innewohnen, unweigerlich zur Oligarchie führen.
19. Jahrhundert: Klassische Periode der Sozialtheorie
Die klassische Periode der Sozialtheorie im 19. Jahrhundert brachte eine Reihe neuer Perspektiven auf die Gesellschaft und die menschliche Geschichte hervor. Zu den einflussreichsten gehörte der historische Materialismus von Karl Marx und Friedrich Engels, der eine deterministische Sicht der Geschichte auf der Grundlage des Klassenkampfes und der Entwicklung der Produktivkräfte vorschlug. Nach Marx und Engels ist die menschliche Geschichte im Wesentlichen eine Geschichte von Klassenkonflikten, in der die wirtschaftlichen Strukturen die politischen und ideologischen Strukturen der Gesellschaft weitgehend bestimmen. Aus dieser Perspektive entwickelt sich die Geschichte linear und progressiv, wobei jede Produktionsweise (Sklaverei, Feudalismus, Kapitalismus) aufgrund von inneren Widersprüchen und Klassenkonflikten durch die nächste ersetzt wird. Diese deterministische und progressive Geschichtsauffassung spielte eine Schlüsselrolle in der politischen Philosophie von Marx und Engels, die das Ende des Kapitalismus und die Entstehung von Sozialismus und Kommunismus als unvermeidliche Schritte in der menschlichen Geschichte betrachteten. Diese Ideen hatten einen tiefen und dauerhaften Einfluss auf die Sozial- und Politiktheorie, obwohl ihre Implikationen und ihre Gültigkeit auch heute noch diskutiert werden.
Angesichts dieser deterministischen und oft sehr theoretischen Sichtweisen der Gesellschaft begann sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Reihe empirischer Arbeiten herauszubilden. Diese Arbeiten versuchten, die sozialen Realitäten konkreter und detaillierter zu untersuchen, indem sie sich auf direkte Beobachtungen und die Analyse empirischer Daten stützten. Dies führte zur Entstehung neuer Disziplinen wie der Soziologie, die von Figuren wie Émile Durkheim in Frankreich initiiert wurde, der die Bedeutung der systematischen Untersuchung sozialer Tatsachen betonte. Parallel dazu entwickelte Max Weber in Deutschland einen verstehenden Ansatz der Soziologie, der individuelle Handlungen und soziale Prozesse aus der Sicht der Akteure selbst zu verstehen suchte. Diese empirischen Arbeiten stellten häufig die großen deterministischen Erzählungen von Geschichte und Gesellschaft in Frage, indem sie die Komplexität und Variabilität sozialer Phänomene aufzeigten. Sie betonten die Bedeutung spezifischer historischer und kultureller Kontexte sowie die Möglichkeit multipler sozialer und politischer Entwicklungspfade. Dies bedeutete einen wichtigen Bruch mit früheren Ansätzen und legte den Grundstein für viele zeitgenössische Zweige der Sozialwissenschaften, einschließlich der Politikwissenschaft. Es ebnete auch den Weg für eine Vielzahl neuer Methoden, von der Ethnografie bis zur statistischen Analyse, die heute Standardinstrumente in der Sozial- und Politikforschung sind.
Als Reaktion auf den deterministischen Trend begannen viele Forscher, detaillierte Studien zur Beschreibung politischer Institutionen durchzuführen. In dieser Zeit schrieb Woodrow Wilson, der später der 28. Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte, das Buch "The State: Elements of Historical and Practical Politics". In diesem Werk bot Wilson eine tiefgründige Studie der politischen Institutionen und erstellte eine Typologie der politischen Systeme auf der Grundlage ihrer institutionellen Struktur und Praxis. Dies spiegelt einen empirischen und vergleichenden Ansatz der Politikwissenschaft wider, der versucht, politische Systeme auf der Grundlage ihrer spezifischen Merkmale und ihres historischen Kontextes zu verstehen. Dieser Ansatz kann als eine moderne Wiederaufnahme der von Platon und Aristoteles entwickelten klassischen Typologien gesehen werden, allerdings mit einem stärkeren Fokus auf direkte Beobachtung und detaillierte Analyse. Dies stellte einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Politikwissenschaft als eigenständige Disziplin dar und unterstrich den Wert der systematischen Untersuchung politischer Institutionen, um die Funktionsweise politischer Systeme zu verstehen.
Woodrow Wilson war nicht nur der 28. Präsident der Vereinigten Staaten, sondern auch ein angesehener Akademiker und Politikwissenschaftler. Bevor er in die Politik ging, lehrte Wilson an der Princeton University, wo er für seine bedeutenden Arbeiten in der Politikwissenschaft bekannt wurde. Einer von Wilsons bemerkenswertesten Beiträgen zur Disziplin war sein institutioneller Ansatz für das Studium der Politik. Er plädierte dafür, der Analyse der politischen Institutionen als Schlüsselelementen jedes politischen Systems besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Darüber hinaus betonte er die Bedeutung der praktischen Politik und unterstrich die Notwendigkeit für Forscher, zu verstehen, wie politische Institutionen in der Praxis tatsächlich funktionieren, und nicht nur in der Theorie. Während seiner Amtszeit als Präsident in der Zeit des Ersten Weltkriegs konnte Wilson einige seiner politischen Ideen in die Praxis umsetzen. Seine Präsidentschaft war von zahlreichen progressiven Reformen geprägt, und er ist insbesondere für seine Rolle bei der Gründung des Völkerbunds nach dem Ersten Weltkrieg bekannt, einer Institution, die den Frieden und die internationale Zusammenarbeit fördern sollte.
Sowohl Max Weber als auch Émile Durkheim leisteten wichtige Beiträge zur soziologischen Theorie und befassten sich mit Themen wie Modernisierung, wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Demokratisierung. Max Weber ist vor allem für sein Konzept der protestantischen Ethik und des Geistes des Kapitalismus bekannt, in dem er argumentiert, dass die Rationalisierung bzw. der Prozess der Übernahme rationaler und effizienter Denk- und Verhaltensweisen ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung des modernen Kapitalismus war. Er untersuchte auch die Bürokratie und das Konzept der rational-legalen Autorität, die das Herzstück der modernen Staatsführung bilden. Émile Durkheim hingegen gilt als einer der Begründer der modernen Soziologie. Er ist berühmt für seine Theorie des sozialen Faktums, die argumentiert, dass soziale Phänomene unabhängig von den Individuen existieren und ihr Verhalten beeinflussen. Durkheim erforschte auch die Themen Modernisierung und sozialer Wandel, insbesondere durch seine Untersuchung von Selbstmord und Religion. Kurz gesagt, sowohl Weber als auch Durkheim haben zu unserem Verständnis der Prozesse der Modernisierung und des sozialen Wandels, einschließlich der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung, beigetragen.
Der Modernisierungsprozess beispielsweise bleibt ein Schlüsselthema für Forschung und Diskussion, insbesondere im Hinblick auf Fragen der Entwicklung und Demokratisierung. Forscher untersuchen weiterhin, wie sich Gesellschaften verändern, wenn sie "moderner" werden, wie sich diese Veränderungen auf die Regierungsführung und die Politik auswirken und wie eine positive wirtschaftliche und politische Entwicklung am besten erleichtert werden kann. Ebenso bleibt die soziale und wirtschaftliche Entwicklung ein wichtiges Anliegen der Politikwissenschaftler. Sie untersuchen Fragen wie die, wie sich das Wirtschaftswachstum auf soziale Ungleichheiten auswirkt, wie Regierungspolitik die Entwicklung unterstützen kann und wie sich soziale Veränderungen, wie z. B. durch Migration oder Klimawandel, auf die Politik auswirken. Schließlich ist auch die Demokratisierung ein wichtiges Untersuchungsgebiet der Politikwissenschaft. Die Forscher untersuchen, wie und warum Demokratien entstehen, sich stabilisieren oder scheitern und welche Strategien den Übergang zur Demokratie und ihre Aufrechterhaltung unterstützen können. Diese Fragen sind besonders relevant im aktuellen Kontext, in dem viele Länder auf der ganzen Welt mit Herausforderungen im Zusammenhang mit demokratischer Regierungsführung konfrontiert sind.
Der wissenschaftliche Ansatz der Politikwissenschaft hat sich im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickelt. Sie zeichnet sich durch eine größere Strenge bei der Analyse politischer Phänomene, eine schlüssigere Logik in den vorgebrachten Argumenten und eine Dominanz des induktiven Ansatzes gegenüber vorherigen Annahmen über die menschliche Natur, wie sie im Mittelalter üblich war, aus. Dieser induktive Ansatz stützt sich auf empirische Beobachtungen und die Analyse von Daten, um Hypothesen und Theorien zu formulieren. Anstatt von vorgefertigten Theorien über die menschliche Natur oder die Struktur der Gesellschaft auszugehen, beobachten die Forscher politische Verhaltensweisen und Ereignisse, sammeln Daten und nutzen diese Informationen, um Theorien zu entwickeln, die die beobachteten Phänomene erklären. Das bedeutet nicht, dass die Politikwissenschaft frei von theoretischen oder philosophischen Debatten ist. Im Gegenteil, diese Debatten sind entscheidend, um die empirische Forschung zu lenken und die Ergebnisse zu interpretieren. Die Betonung des empirischen und induktiven Ansatzes hat jedoch dazu beigetragen, den wissenschaftlichen Charakter der Disziplin zu stärken. Darüber hinaus haben auch der Einsatz quantitativer Methoden wie Statistiken und ökonometrische Modelle sowie die zunehmende Zugänglichkeit von Daten dazu beigetragen, die Politikwissenschaft als wissenschaftliche Disziplin voranzubringen. Diese Instrumente ermöglichen es den Forschern, ihre Hypothesen rigoros zu testen und empirische Beweise zur Unterstützung ihrer Argumente zu liefern.
Die Anwendung der vergleichenden Methode in der Politikwissenschaft begann im 20. Jahrhundert an Bedeutung zu gewinnen. Diese Methode ermöglicht es Forschern, politische Systeme, Regime, Politiken und Prozesse in verschiedenen nationalen und internationalen Kontexten zu analysieren und zu vergleichen. Während eines Großteils dieses Jahrhunderts befand sich die Anwendung dieser Methode jedoch noch in den Anfängen und war nicht immer systematisch. Der vergleichende Ansatz zielt darauf ab, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den untersuchten Fällen zu identifizieren, um zu versuchen, zu erklären, warum bestimmte politische Phänomene auftreten. Beispielsweise kann er helfen zu verstehen, warum es einigen Ländern gelingt, eine stabile Demokratie zu errichten, während dies in anderen Ländern nicht gelingt. Im Laufe der Zeit hat sich die vergleichende Methode weiterentwickelt und an Raffinesse gewonnen. Sie ist systematischer geworden, insbesondere mit der Entwicklung statistischer Techniken, die es ermöglichen, eine große Anzahl von Fällen gleichzeitig zu vergleichen. Trotz dieser Entwicklung ist es wichtig zu beachten, dass die vergleichende Methode auch Herausforderungen mit sich bringt. Sie erfordert eine genaue Kenntnis des spezifischen Kontexts jedes untersuchten Falls, und es kann schwierig sein, alle Variablen zu kontrollieren, die die Ergebnisse beeinflussen könnten. Außerdem müssen die Forscher darauf achten, dass sie nicht zu allgemeine Schlussfolgerungen aus einer begrenzten Anzahl von Fällen ziehen.
Ein Großteil der traditionellen Politikwissenschaft hat sich auf die Untersuchung der formalen Regierungsinstitutionen wie Parlamente, Gerichte, Verfassungen und öffentliche Verwaltungen konzentriert. Diese Studien verfolgten häufig einen deskriptiven, rechtlichen und formalen Ansatz und konzentrierten sich auf die Struktur, Funktion und Organisation dieser Institutionen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich das Feld der Politikwissenschaft in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert und erweitert hat. Heute beschränken sich die Forscher der Politikwissenschaft nicht mehr auf die Untersuchung der formalen Institutionen der Regierung. Sie beschäftigen sich auch mit einer Vielzahl anderer politischer Phänomene, wie z. B. Wahlverhalten, sozialen Bewegungen, Identitätspolitik, Global Governance, vergleichender Politik, internationalen Konflikten und vielem mehr. Darüber hinaus haben sich auch die in der Politikwissenschaft verwendeten Methoden weiterentwickelt. Anstatt sich ausschließlich auf einen deskriptiven Ansatz zu konzentrieren, verwenden viele Forscher in der Politikwissenschaft heute vielfältigere Forschungsmethoden, darunter quantitative, qualitative, gemischte und formale Modellierungsansätze. Alles in allem bleibt die Untersuchung der formalen Regierungsinstitutionen zwar ein wichtiger Teil der Politikwissenschaft, doch hat sich das Feld erheblich erweitert und diversifiziert und spiegelt eine viel breitere Palette von Interessensgebieten und Forschungsmethoden wider.
Ende des 19. Jahrhunderts Anfang des 20. Jahrhunderts: Eine Ära des Wandels
Jahrhunderts hat sich die Politikwissenschaft wirklich professionalisiert und zu einer eigenständigen Disziplin entwickelt. Zu dieser Entwicklung haben mehrere Faktoren beigetragen. Erstens spielte die Gründung von Berufsorganisationen, wie der American Political Science Association (APSA) im Jahr 1903, eine entscheidende Rolle. Diese Organisationen trugen dazu bei, die Praxis der Politikwissenschaft zu standardisieren, ethische Normen für die Forschung festzulegen und die Verbreitung der Forschungsarbeiten durch Konferenzen und Veröffentlichungen zu fördern. Zweitens hat die Entwicklung von Doktorandenprogrammen für Politikwissenschaft an den Universitäten dazu beigetragen, eine neue Generation professioneller Forscher auszubilden. Diese Programme boten einen Rahmen für eine systematische Ausbildung in politischer Theorie, Forschungsmethoden und in den verschiedenen Unterbereichen des Fachs. Drittens wurde die Entwicklung der Politikwissenschaft durch die Einführung neuer Forschungsmethoden, insbesondere quantitativer, auf Statistiken basierender Ansätze, vorangetrieben. Diese Methoden haben es den Forschern ermöglicht, politische Fragen mit einem nie dagewesenen Maß an Strenge und Genauigkeit zu untersuchen. Schließlich hat die Politikwissenschaft auch von der Unterstützung verschiedener Stiftungen und Förderagenturen profitiert, die dazu beigetragen haben, die Forschung zu finanzieren und die Entwicklung des Fachs zu fördern. Diesen Entwicklungen ist es zu verdanken, dass sich die Politikwissenschaft zu einer eigenständigen akademischen Disziplin mit einem eigenen Wissenskorpus, eigenen Forschungsmethoden und professionellen Standards entwickelt hat.
Die Politikwissenschaft als eigenständige akademische Disziplin hat ihre Wurzeln vor allem in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Gründung der ersten Graduiertenschule an der Columbia University in New York im Jahr 1880 markiert den Beginn der Institutionalisierung der Politikwissenschaft als eigenständiges Studienfeld in den USA. Dieser Schritt war entscheidend für die Etablierung der Politikwissenschaft als eigenständiges akademisches Studienfach. Daraufhin wurde 1903 die American Political Science Association (APSA) gegründet. Die APSA entwickelte sich zu einer Schlüsselorganisation für Politikwissenschaftler, indem sie eine Plattform für den Austausch und die Verbreitung von Forschungsergebnissen sowie einen Raum für die berufliche Weiterentwicklung und die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern bot. Diese Schritte haben nicht nur dazu beigetragen, dass sich die Politikwissenschaft von anderen Disziplinen abheben konnte, sondern auch die Grundlage für die weitere Entwicklung des Fachs sowohl in Bezug auf die theoretische Forschung als auch auf die praktische Anwendung gelegt. Heute ist die Politikwissenschaft ein dynamisches und vielfältiges Fachgebiet, das sich mit einer breiten Palette von Fragen im Zusammenhang mit Macht, Regierungsführung und internationalen Beziehungen befasst.
Laut dem britischen Historiker Edward Augustus Freeman ist "History is past politics, and politics is present history"[5] Dieses Zitat unterstreicht die enge Beziehung zwischen der Politikwissenschaft und der Geschichte. Tatsächlich kann die Politikwissenschaft als ein Zweig der Geschichte betrachtet werden, der sich auf die Analyse von politischen Systemen, Institutionen und politischen Prozessen konzentriert, während die Geschichte einen wertvollen Kontext für das Verständnis der Ursprünge und der Entwicklung dieser Systeme und Prozesse liefern kann. Ein zentraler Unterschied zwischen den beiden Disziplinen liegt jedoch in ihrer zeitlichen Ausrichtung. Während sich die Geschichte auf die Untersuchung der Vergangenheit konzentriert, konzentriert sich die Politikwissenschaft vor allem auf die Gegenwart und die Zukunft. Sie untersucht zeitgenössische Trends und Muster in der Politik und versucht, Vorhersagen zu treffen oder politische Empfehlungen für die Zukunft zu geben. Daher wird oft gesagt, dass "Politik die gegenwärtige Geschichte ist". Dennoch sind die beiden Disziplinen, obwohl sie unterschiedliche zeitliche Ausrichtungen haben, eng miteinander verbunden und verstärken sich gegenseitig. Ein tieferes Verständnis der Geschichte kann unser Verständnis der zeitgenössischen Politik bereichern, während das Studium der zeitgenössischen Politik uns dabei helfen kann, die Geschichte zu interpretieren und zu verstehen.
Der Ansatz der Politikwissenschaft unterscheidet sich von dem der Geschichte in Bezug auf die Verallgemeinerung. Während sich die Geschichte auf die Einzigartigkeit jedes Ereignisses und seiner spezifischen Umstände konzentriert, zielt die Politikwissenschaft darauf ab, Theorien und Modelle aufzustellen, die auf verschiedene Kontexte und Zeitpunkte angewendet werden können. Das bedeutet nicht, dass die Politikwissenschaft die spezifischen Details oder den Kontext eines Ereignisses oder Phänomens vernachlässigt. Im Gegenteil, sie nutzt diese Details, um Trends, Muster oder Faktoren zu identifizieren, die eine Vielzahl von politischen Phänomenen erklären können. Eines der Hauptziele der Politikwissenschaft ist es, Theorien zu schaffen, die unter verschiedenen Bedingungen verallgemeinert, getestet und validiert werden können. Dies ermöglicht es, die Mechanismen hinter politischen Phänomenen zu verstehen und vorherzusagen, wie sich diese Phänomene in der Zukunft entwickeln könnten. Beispielsweise können uns die Theorien der Politikwissenschaft dabei helfen zu verstehen, warum manche Länder demokratischer sind als andere, wie politische Institutionen das Verhalten von Bürgern und Führungskräften beeinflussen oder welche Faktoren zu Krieg oder Frieden zwischen Nationen führen können. Auf diese Weise ergänzt die Politikwissenschaft die Geschichte, indem sie konzeptionelle Rahmen zum Verständnis groß angelegter politischer Prozesse bereitstellt und gleichzeitig von historischen Einsichten profitiert, um diese Rahmen zu beleuchten.
Die formalen, rechtlichen und beschreibenden Ansätze in der Politikwissenschaft haben bestimmte Grenzen:
- Beschreibung über Erklärung: Deskriptive Ansätze liefern oft einen detaillierten Einblick in politische Ereignisse, Institutionen oder Prozesse, aber es fehlt ihnen möglicherweise an tiefgreifenden Erklärungen, warum und wie diese Phänomene auftreten.
- Abhängigkeit von Recht und formalen Institutionen: Rechtliche und institutionelle Analysen sind entscheidend, um die Funktionsweise politischer Systeme zu verstehen. Sie können jedoch nicht-institutionelle oder nicht-gesetzliche Einflüsse auf das politische Verhalten vernachlässigen, wie z. B. soziale Normen, wirtschaftlicher Druck, informelle Machtdynamiken etc.
- Geringe Nutzung der vergleichenden Analyse: Die vergleichende Analyse ist ein mächtiges Instrument für die politikwissenschaftliche Forschung, da sie es ermöglicht, Trends, Muster und Faktoren zu identifizieren, die über verschiedene politische Kontexte hinweg konstant sind. In den frühen Stadien der Disziplin wurde dieser Ansatz jedoch weniger genutzt, wodurch die Fähigkeit zur Verallgemeinerung von Forschungsergebnissen eingeschränkt wurde.
- Mangel an empirischen Ansätzen: Obwohl sich die Politikwissenschaft zunehmend empirischen Methoden zugewandt hat, waren diese in den frühen Stadien der Disziplin nicht so weit verbreitet. Das bedeutet, dass einige Theorien oder Hypothesen nicht rigoros durch empirische Daten getestet wurden, was ihre Gültigkeit und Zuverlässigkeit einschränken kann.
Die Politikwissenschaft hat sich jedoch seit ihren Anfängen stark weiterentwickelt und neue Methoden integriert, darunter anspruchsvollere empirische Ansätze, systematische vergleichende Analysen und die Beachtung nicht-institutioneller Faktoren im politischen Verhalten.empirisches Gestein. Die vergleichende Analyse befindet sich noch in einem embryonalen Zustand und ist noch nicht sehr weit entwickelt.
Nach dem damaligen Motto: Die Politikwissenschaft konzentriert sich auf die Gegenwart und die Geschichte auf die Vergangenheit. Dieses Motto verdeutlicht die klassische Unterscheidung zwischen Politikwissenschaft und Geschichte. Die Geschichte im Allgemeinen befasst sich mit dem umfassenden und detaillierten Verständnis vergangener Ereignisse, Personen, Ideen und Zusammenhänge. Sie versucht, die Vergangenheit in ihrer ganzen Komplexität und Besonderheit zu beschreiben und zu erklären. Historiker konzentrieren sich oft auf einzigartige Ereignisse und spezifische Zusammenhänge und versuchen, die Vergangenheit um ihrer selbst willen zu verstehen, anstatt nach Verallgemeinerungen oder Theorien zu streben. Die Politikwissenschaft hingegen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Untersuchung von Macht und politischen Systemen in der Gegenwart und Zukunft. Sie konzentriert sich dabei auf Begriffe wie Staat, Regierung, Politik, Macht, Ideologie usw. Die Politikwissenschaft beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie sich die Politik auf den Staat auswirkt. Anstatt sich nur mit der detaillierten Untersuchung spezifischer Fälle zu befassen, versucht die Politikwissenschaft, Theorien und Modelle zu entwickeln, die allgemein auf verschiedene Kontexte und Zeiträume anwendbar sind. Davon abgesehen ist es wichtig zu beachten, dass sich Politikwissenschaft und Geschichte nicht gegenseitig ausschließen. Politikwissenschaftler können wertvolle Lehren aus der Geschichte ziehen, um Trends und Muster in politischen Phänomenen zu verstehen, während Historiker Werkzeuge und Konzepte aus der Politikwissenschaft nutzen können, um die Vergangenheit zu analysieren. Beide Disziplinen ergänzen und bereichern sich gegenseitig.
Die Chicagoer Schule: Auf dem Weg zu einem verhaltensorientierten Ansatz
Die Chicagoer Schule ist berühmt dafür, dass sie die Soziologie mit der Einführung einer empirischen und quantitativen Methodik zur Untersuchung des menschlichen Verhaltens in ihrem städtischen Umfeld vorangebracht hat. Es ist diese Tradition, die die Verhaltensrevolution in der Politikwissenschaft in den 1950er und 1960er Jahren inspiriert hat. Die Verhaltensrevolution markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Politikwissenschaft. Anstatt sich hauptsächlich auf die formellen Institutionen und Strukturen der Regierung zu konzentrieren, begannen die Forscher, sich stärker für die Untersuchung individueller Verhaltensweisen und informeller politischer Prozesse zu interessieren. Sie begannen, durch Umfragen, Interviews und andere Forschungsmethoden empirische Daten zu sammeln, um zu verstehen, wie sich Menschen an der Politik beteiligen, wie sie politische Entscheidungen treffen, wie sie mit dem politischen System interagieren und so weiter. Dieser neue Ansatz hat unser Verständnis von Politik erheblich bereichert. Sie hat auch neue Forschungsmethoden und -techniken in die Disziplin eingeführt, wie die statistische Analyse, die Verwendung von formalen Modellen und Rational-Choice-Theorien und die Einführung systematischerer Vergleichsrahmen.
Die Chicagoer Schule war eine wichtige Kraft bei der Förderung eines neuen Ansatzes in der Politikwissenschaft. Charles Merriam, der eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Chicagoer Schule spielte, argumentierte, dass die Politikwissenschaft von ihrer traditionellen historischen und juristischen Ausrichtung abrücken und sich stärker auf die empirische Analyse des politischen Verhaltens konzentrieren müsse. In seinem Manifest von 1929 plädierte Merriam für einen "wissenschaftlichen" Ansatz in der Politikwissenschaft, der sich auf die Sammlung und Analyse empirischer Daten konzentrieren sollte. Er argumentierte auch, dass Forscher in der Politikwissenschaft einen interdisziplinären Ansatz verfolgen sollten, indem sie Ideen und Methoden aus anderen Disziplinen wie Psychologie, Soziologie und Wirtschaft einbeziehen.
Die Chicagoer Schule wurde bekannt für die Anwendung empirischer und quantitativer Methoden bei der Untersuchung des politischen Verhaltens. So setzten ihre Forscher beispielsweise Umfragen und Erhebungen ein, um politische Einstellungen und das Wahlverhalten zu untersuchen, und sie verfolgten einen vergleichenden Ansatz, um die politischen Systeme verschiedener Länder zu analysieren. Der Einfluss der Chicagoer Schule war tiefgreifend und nachhaltig. Sie legte den Grundstein für die "Verhaltensrevolution", die die Politikwissenschaft in den 1950er und 1960er Jahren veränderte. Und obwohl der behavioristische Ansatz seither selbst kritisiert und verändert wurde, beeinflussen viele Grundsätze der Chicagoer Schule nach wie vor die Art und Weise, wie Politikwissenschaft heute praktiziert wird.
Harold Lasswell, Leonard White und Quincy Wright waren Schlüsselfiguren der Chicagoer Schule, von denen jeder einen bedeutenden Beitrag zur behavioristischen Entwicklung der Politikwissenschaft leistete. Harold Lasswell, der für seine Arbeit an Kommunikationsmodellen bekannt ist, analysierte die Rolle der Medien und der Propaganda in der Gesellschaft und entwickelte insbesondere das Modell "Wer sagt was, zu wem, über welchen Kanal, mit welcher Wirkung". Dieser Beitrag hatte einen bedeutenden Einfluss auf die Kommunikations- und Politikstudien. Leonard White, ein Pionier in der Erforschung der öffentlichen Verwaltung, trug dazu bei, diesen Bereich zu einer eigenständigen akademischen Disziplin zu machen, wobei seine historische Arbeit über die öffentliche Verwaltung in den USA nach wie vor eine wesentliche Referenz darstellt. Quincy Wright schließlich, der sich auf internationale Beziehungen spezialisierte, schuf Arbeiten wie "A Study of War", in denen er versuchte, die Ursachen des Krieges und die Bedingungen für den Frieden wissenschaftlich zu verstehen. Diese Arbeit beeinflusste die Art und Weise, wie internationale Beziehungen erforscht werden, und betonte die Bedeutung empirischer und vergleichender Analysen. Gemeinsam haben diese Forscher die Politikwissenschaft geprägt, wobei sie sich besonders auf die empirische und verhaltensorientierte Untersuchung politischer Prozesse konzentrierten.
Die Chicagoer Schule hat sich besonders für die Untersuchung des politischen Verhaltens interessiert. Aus dieser Perspektive wurden zwei Untersuchungsgegenstände besonders hervorgehoben: das Wahlverhalten und die soziale Mobilisierung in der Politik. Die Untersuchung des Wahlverhaltens versucht, die Faktoren zu verstehen, die die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen bei Wahlen abstimmen. Diese Forschung befasst sich mit einer Vielzahl von Faktoren, darunter politische Einstellungen, Parteizugehörigkeiten, politische Präferenzen, der Einfluss der Medien sowie soziodemografische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Rasse, soziale Klasse und Bildung. Die Untersuchung der sozialen Mobilisierung in der Politik hingegen konzentriert sich auf die Prozesse, durch die sich Einzelpersonen und Gruppen in der Politik engagieren. Diese Forschung untersucht die Motivationen von Einzelpersonen, sich an der Politik zu beteiligen, die Taktiken und Strategien, die Gruppen einsetzen, um ihre Mitglieder zu mobilisieren und ihre Anliegen zu unterstützen, sowie die sozialen und institutionellen Strukturen, die die politische Mobilisierung erleichtern oder behindern. Diese beiden Untersuchungsbereiche haben zu einem besseren Verständnis des politischen Verhaltens von Einzelpersonen und Gruppen geführt und die Politikwissenschaft, wie wir sie heute kennen, mit geprägt.
1939 veröffentlichte Harold Lasswell als Mitherausgeber eine Studie mit dem Titel "World Revolutionary Propaganda: A Chicago Study", in der die Auswirkungen der Großen Depression von 1929 auf die politische Mobilisierungsfähigkeit der Arbeitslosen in Chicago untersucht wurden.[6] Die Große Depression, die mit dem Börsenkrach von 1929 begann, hatte verheerende wirtschaftliche Auswirkungen in den USA und anderswo und führte zu Massenarbeitslosigkeit und finanziellen Schwierigkeiten für viele Menschen. Die Lasswell-Studie sollte herausfinden, wie diese schwierigen wirtschaftlichen Umstände die Fähigkeit arbeitsloser Menschen, sich politisch zu engagieren, beeinflusst hatten. Die Studie verwendete einen für ihre Zeit innovativen Ansatz, bei dem quantitative und qualitative Methoden kombiniert wurden, um politisches Verhalten zu verstehen. Sie trug auch dazu bei, die Chicagoer Schule als wichtiges Zentrum für die Untersuchung des politischen Verhaltens zu etablieren, und legte den Grundstein für die anschließende verhaltensorientierte Revolution in der Politikwissenschaft.
Die Chicagoer Schule markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Politikwissenschaft, indem sie einen empirischeren und rigoroseren Ansatz zur Untersuchung des politischen Verhaltens einführte. Anstatt sich nur auf politische Institutionen oder große historische Ereignisse zu konzentrieren, betonte dieser Ansatz die Bedeutung individueller Einstellungen und Verhaltensweisen im politischen Prozess. Durch den Einsatz ausgefeilterer und rigoroserer Forschungsmethoden, einschließlich Umfragen und statistischer Analysen, war die Chicagoer Schule in der Lage, genauere und differenziertere Erkenntnisse über das politische Verhalten zu gewinnen. Dies führte zu einem besseren Verständnis verschiedener politischer Phänomene, von der politischen Mobilisierung der Arbeitslosen während der Großen Depression bis hin zur Dynamik der Stimmabgabe bei modernen Wahlen. So spielte die Chicagoer Schule eine wesentliche Rolle bei der Professionalisierung und Autonomisierung der Politikwissenschaft als akademische Disziplin, indem sie bewies, dass ein echter Durchbruch im politischen Wissen durch rigorose empirische Studien möglich ist.
Die Post-Behavioral-Periode (1950 - 1960): Neue Herausforderungen und Orientierungen
Die Verhaltensrevolution (behavioral revolution) der 1950er und 1960er Jahre markiert einen bedeutenden Wandel in der Art und Weise, wie die Politikwissenschaft untersucht und verstanden wird. Diese Revolution ist dadurch gekennzeichnet, dass man sich verstärkt auf das Verhalten von Individuen und Gruppen im politischen Kontext konzentrierte und nicht mehr auf formale Strukturen und Institutionen. Wissenschaftler der Politikwissenschaft begannen, empirische Methoden zu verwenden, um zu untersuchen, wie Einzelpersonen politische Stimuli wahrnehmen, interpretieren und darauf reagieren. Dazu gehörten unter anderem Meinungsumfragen, Medieninhaltsanalysen und Studien über das Wahlverhalten. Eine Folge dieser Revolution war die Entwicklung der Theorie der rationalen Wahl, die davon ausgeht, dass Individuen so handeln, dass sie ihren eigenen Nutzen maximieren. Diese Theorie ist zu einem wichtigen Instrument für die Analyse des politischen Verhaltens geworden. In dieser Zeit entstanden auch neue Ansätze in der vergleichenden Politik und den internationalen Beziehungen, die ebenfalls von der Verwendung empirischer und quantitativer Methoden zur Untersuchung des politischen Verhaltens profitierten.
Die Verhaltensrevolution markierte einen großen Wandel im Studium der Politikwissenschaft. Sie war durch zwei Hauptideen gekennzeichnet:
- L'Erweiterung der Gegenstände der Politikwissenschaft: Die Befürworter dieser Revolution stellten die traditionelle Sichtweise in Frage, die die Politikwissenschaft auf die Untersuchung formaler Regierungsinstitutionen beschränkte. Sie versuchten, diese Beschränkung zu überwinden, indem sie die Untersuchung informeller Verfahren und des politischen Verhaltens von Einzelpersonen und Gruppen, wie z. B. politischen Parteien, einbezogen. Zu diesen informellen Verfahren können Prozesse zur Formulierung neuer öffentlicher Politiken gehören, die häufig die Konsultation von organisierten Interessengruppen wie Gewerkschaften und anderen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen beinhalten. Diese Prozesse sind zwar nicht institutionalisiert, spielen aber eine Schlüsselrolle in der Politik und können als informelle Institutionen beschrieben werden.
- Der Wille, die Politikwissenschaft wissenschaftlicher zu machen: Die Vertreter der Verhaltensrevolution stellten den empirischen Ansatz in Frage, der nicht durch die Theorie erhellt wird. Sie traten für eine strenge und systematische theoretische Argumentation ein, die durch empirische Studien getestet werden kann. Dieser Ansatz führte zur Aufstellung und Prüfung theoretischer Hypothesen unter Verwendung quantitativer und qualitativer Methoden.
Die behavioristische Revolution hatte große Auswirkungen auf die Politikwissenschaft, da sie deren Untersuchungsfeld erweiterte und auf einem rigoroseren und wissenschaftlicheren Ansatz bestand.
Die Nachkriegszeit war von einer deutlichen Ausweitung und Diversifizierung der politikwissenschaftlichen Forschung geprägt. So wurden beispielsweise die internationalen Beziehungen zu einer wichtigen Unterdisziplin, die sich auf die Phänomene Krieg, Frieden und Kooperation auf globaler Ebene konzentrierte. Gleichzeitig hat sich die vergleichende Politik als ein zentrales Studienfeld herauskristallisiert, das eine vergleichende Perspektive auf politische Systeme und Institutionen auf der ganzen Welt bietet. Auch die Aufmerksamkeit für die spezifischen politischen Institutionen in den USA hat zugenommen, was eine tiefergehende Analyse dieses besonderen Systems ermöglicht hat. Neue Unterdisziplinen sind entstanden, die das Spektrum der Politikwissenschaft weiter ausdehnen. So begannen beispielsweise die Sicherheitsstudien, sich auf die Herausforderungen und Strategien im Zusammenhang mit der nationalen und internationalen Sicherheit zu konzentrieren. Darüber hinaus wurden die internationalen Wirtschaftsbeziehungen als ein entscheidendes Studiengebiet identifiziert, das eine Brücke zwischen Politik und Wirtschaft auf globaler Ebene schlägt. Schließlich gewann die Untersuchung des politischen Verhaltens zunehmend an Bedeutung, wobei der Schwerpunkt auf dem Verständnis der Handlungen und Verhaltensweisen von Einzelpersonen und Gruppen im politischen Kontext lag. Alles in allem markierte diese Nachkriegszeit einen Wendepunkt in der Politikwissenschaft, der ihre multidisziplinäre Natur vertiefte und ihren Umfang beim Verständnis der komplexen politischen Zusammenhänge erweiterte.
Die Universität von Michigan spielte in der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle bei der Förderung des verhaltensorientierten Ansatzes in der Politikwissenschaft. Ihre Abteilung für Politikwissenschaft legte den Schwerpunkt auf empirische Studien und förderte eine wissenschaftliche Kultur bei der Untersuchung von Politik. Insbesondere das Center for Political Studies der University of Michigan war ein Pionier in der Erforschung des politischen Verhaltens. Das Zentrum ist berühmt für die Einführung der American National Election Studies (ANES), einer Längsschnittstudie, die seit 1948 Daten über das Wahlverhalten, die politischen Meinungen und die Einstellungen der US-Bürger sammelt. Diese Studie hat wertvolle Daten geliefert, um zu verstehen, wie und warum Menschen sich am politischen Leben beteiligen. Der Schwerpunkt der Universität Michigan auf der empirischen Untersuchung des politischen Verhaltens hat dazu beigetragen, das Feld der Politikwissenschaft über die rein institutionelle und rechtliche Analyse hinaus zu verschieben und ein tieferes Verständnis davon einzuschließen, wie sich individuelle Akteure und Gruppen im politischen Kontext verhalten.
Zwei wichtige Publikationen aus dieser Zeit, die diese Verhaltensrevolution voll und ganz symbolisieren, sind "Political Man: The Social Bases of Politics" von Seymour Martin Lipset aus dem Jahr 1960[7], und "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations" von Gabriel Almond und Sidney Verba, veröffentlicht 1963.[8] Diese beiden Werke waren sehr einflussreich und markierten die Zeit der verhaltensorientierten Revolution in der Politikwissenschaft. Seymour Martin Lipsets "Political Man: The Social Bases of Politics" wurde 1960 veröffentlicht und ist zu einem Klassiker der politischen Soziologie geworden. Lipset verwendet einen empirischen Ansatz, um die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen zu untersuchen, die zur demokratischen Stabilität beitragen. Er befasst sich insbesondere mit Faktoren wie dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand, dem Bildungssystem, der Religion, dem sozialen Status und anderen sozialen Faktoren, um Muster des politischen Verhaltens zu verstehen. "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations ist ein 1963 von Gabriel Almond und Sidney Verba veröffentlichtes Buch. Das Buch enthält eine vergleichende Analyse der politischen Kulturen in fünf Ländern (USA, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Italien und Mexiko) und schlägt das Konzept der "bürgerlichen Kultur" zur Erklärung der demokratischen Stabilität vor. Almond und Verba argumentieren, dass die politische Kultur eines Landes, die sich in den Einstellungen und Überzeugungen der Bürger gegenüber dem politischen System widerspiegelt, eine entscheidende Rolle für das Funktionieren und die Stabilität der Demokratie spielt. Beide Bücher spiegeln den Schwerpunkt der Verhaltensrevolution wider, die Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen von Menschen zu untersuchen, um die Politik zu verstehen.
Die Verhaltensrevolution markierte eine bedeutende Wende in der Disziplin der Politikwissenschaft, indem sie die Bedeutung von Theorien bei der Analyse und dem Verständnis politischer Phänomene betonte. Diese Neuausrichtung auf einen stärker theoretisch orientierten Ansatz hat die Einführung neuer Konzepte und Analyseinstrumente ermöglicht und damit das Feld der Disziplin bereichert. Eine der wichtigsten Auswirkungen dieser Revolution war die Stärkung der theoretischen Argumente in der politischen Analyse. Anstatt sich nur auf deskriptive Beobachtungen und Annahmen zu stützen, begannen die Forscher, fundiertere Hypothesen und Theorien zur Erklärung des politischen Verhaltens zu formulieren. Dies führte zu differenzierteren Debatten und einem tieferen Verständnis der politischen Prozesse. Darüber hinaus hat die Verhaltensrevolution auch eine größere Raffinesse in die politische Theorie eingeführt. Mit der Annahme eines wissenschaftlicheren Ansatzes konnten die Forscher komplexere und präzisere theoretische Modelle entwickeln, um eine Vielzahl von politischen Verhaltensweisen und Phänomenen zu erklären. Schließlich, und vielleicht am wichtigsten, förderte die Verhaltensrevolution eine strengere Berücksichtigung der wissenschaftlichen Methode bei der Untersuchung der Politik. Das bedeutet, dass die Forscher begonnen haben, strengere und systematischere Forschungsmethoden anzuwenden, einschließlich der Verwendung von Statistiken und anderen quantitativen Instrumenten. Dies hat zu einer größeren Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Forschungsergebnisse geführt und damit die Glaubwürdigkeit der Disziplin der Politikwissenschaft insgesamt gestärkt.
Die dritte wissenschaftliche Revolution (1989 - Gegenwart) : Das neue Gesicht der Politikwissenschaft
Die dritte wissenschaftliche Revolution in der Politikwissenschaft, die in den 1970er Jahren begann, hatte einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Politikforschung heute betrieben wird. Diese Revolution führte strengere und systematischere Forschungsmethoden ein, einschließlich der Verwendung von Statistiken und mathematischen Modellen, um Hypothesen zu testen und die Auswirkungen verschiedener Faktoren auf politische Phänomene zu messen. Sie ermutigte die Forscher auch dazu, einen stärker empirischen Ansatz zu verfolgen, der auf Beobachtung und Erfahrung statt auf reiner Theorie beruht. Im Zuge der dritten wissenschaftlichen Revolution kam es auch zu einer Ausweitung der Studienbereiche der Politikwissenschaft. Die Wissenschaftler begannen, neue Bereiche wie Wahlverhalten, vergleichende Politik, Identitätspolitik, Umweltpolitik und andere zu erforschen. Diese neuen Studienbereiche haben unser Verständnis davon, wie Politik funktioniert und welche Rolle politische Faktoren in der Gesellschaft spielen, erheblich erweitert. Diese Revolution hat auch eine größere Vielfalt in die politikwissenschaftliche Forschung gebracht. Die Forscher begannen, ein breiteres Spektrum an politischen Kontexten zu untersuchen und unterschiedlichere Perspektiven zu berücksichtigen. Darüber hinaus hat diese Revolution auch eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert, bei der Forscher der Politikwissenschaft mit Experten anderer Disziplinen zusammenarbeiten, um komplexe politische Probleme zu lösen.
Die Rational-Choice-Theorie (RCT) ist ein wichtiger und einflussreicher Ansatz in der Politikwissenschaft, der hauptsächlich von der Wirtschaftstheorie inspiriert ist. Diese Theorie geht davon aus, dass Individuen rationale Akteure sind, die Entscheidungen auf der Grundlage ihrer persönlichen Interessen treffen und dabei versuchen, ihren Nutzen zu maximieren, d. h. den Gewinn oder die Freude, die sie aus einer bestimmten Handlung ziehen. Individuen, so die TCR, wägen die Kosten und den Nutzen verschiedener Optionen ab, bevor sie eine Entscheidung treffen. Bei dieser Kosten-Nutzen-Abwägung können viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, u. a. materielle Konsequenzen, Zeit, Aufwand, Risiken sowie emotionale und soziale Belohnungen. Die CRT dient in der politikwissenschaftlichen Forschung häufig als "Metatheorie". Das bedeutet, dass sie einen allgemeinen Rahmen bietet, um zu verstehen, wie und warum Menschen bestimmte politische Entscheidungen treffen. Sie kann zum Beispiel verwendet werden, um Fragen wie das Wahlverhalten (warum wählen die Menschen so, wie sie wählen?), die Koalitionsbildung (warum schließen sich bestimmte politische Parteien mit anderen zusammen?) oder die Entscheidungsfindung in der Außenpolitik (warum entscheiden sich Länder für Kriegserklärungen oder Friedensverträge?) zu analysieren.
Die dritte wissenschaftliche Revolution in der Politikwissenschaft hat den Schwerpunkt auf die Verwendung strenger logischer Argumentationen und formaler Methoden gelegt. In diesem Zusammenhang ist die Rational-Choice-Theorie (RCT) ein wichtiges Beispiel für diesen Ansatz. Die RCT und ähnliche Ansätze beginnen häufig damit, eine Reihe von Postulaten oder Grundannahmen aufzustellen. Diese Postulate sollen bestimmte grundlegende Aspekte des menschlichen Verhaltens oder des politischen Systems darstellen. Beispielsweise postuliert die CRT in der Regel, dass Menschen rationale Akteure sind, die ihren Nutzen zu maximieren versuchen. Aus diesen Grundannahmen leiten die Forscher dann logisch eine Reihe von Aussagen oder Hypothesen ab. Wenn man beispielsweise annimmt, dass Individuen rational sind und ihren Nutzen maximieren wollen, könnte man daraus ableiten, dass Individuen eher zur Wahl gehen, wenn sie glauben, dass ihre Stimme einen Einfluss auf das Wahlergebnis hat. Diese Aussagen oder Hypothesen werden dann empirisch getestet, häufig mithilfe von quantitativen Daten. Beispielsweise könnte ein Forscher Daten über das Wahlverhalten sammeln und mithilfe statistischer Verfahren die Hypothese testen, dass Einzelpersonen eher wählen gehen, wenn sie glauben, dass ihre Stimme eine Auswirkung hat. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er klare und testbare Vorhersagen liefert, und er hat dazu beigetragen, die Strenge und Genauigkeit der politikwissenschaftlichen Forschung zu verbessern. Wie bereits erwähnt, wurde sie jedoch auch kritisiert, vor allem wegen ihrer vereinfachten Annahmen über das menschliche Verhalten.
Die Spieltheorie, ein Zweig der Mathematik, der sich mit Entscheidungssituationen befasst, in denen mehrere Akteure interagieren, wurde im Rahmen der dritten wissenschaftlichen Revolution in die Politikwissenschaft integriert. Sie bietet einen formalen Rahmen für die Analyse von Situationen, in denen das Ergebnis für ein Individuum nicht nur von seinen eigenen Entscheidungen, sondern auch von denen anderer abhängt. Sie wird häufig in politischen Zusammenhängen eingesetzt, um Konflikt- und Kooperationssituationen zu modellieren, wie z. B. Verhandlungen, Wahlen, Koalitionsbildung und Entscheidungsfindung in der Außenpolitik. Die Spieltheorie eignet sich gut für die Rational-Choice-Theorie, da sie davon ausgeht, dass die Akteure rational sind und ihren Nutzen maximieren wollen. Sie geht jedoch über die bloße Maximierung des individuellen Nutzens hinaus und berücksichtigt, wie die Entscheidungen anderer Akteure das Ergebnis beeinflussen können. Was die statistische Analyse betrifft, so ist sie seit der dritten wissenschaftlichen Revolution zu einer Standardforschungsmethode in der Politikwissenschaft geworden. Forscher verwenden statistische Methoden, um große Datensätze zu analysieren und um Hypothesen über die Beziehungen zwischen verschiedenen Variablen zu testen. Die statistische Analyse kann dabei helfen, Trends zu erkennen, Korrelationen herzustellen, zukünftige Ergebnisse vorherzusagen und die Wirksamkeit verschiedener politischer Maßnahmen zu überprüfen. Durch den Einsatz dieser Werkzeuge - der Spieltheorie und der statistischen Analyse - hat die Politikwissenschaft an Strenge, Genauigkeit und der Fähigkeit, ihre Theorien zu testen und zu validieren, gewonnen. Wie immer haben diese Methoden jedoch ihre Grenzen und Herausforderungen, und die Forscher diskutieren weiterhin darüber, wie sie am besten in der Praxis eingesetzt werden können.
Die dritte wissenschaftliche Revolution in der Politikwissenschaft hatte große Auswirkungen auf alle Facetten des Fachs, einschließlich der qualitativen Forschungsmethoden. Als Reaktion auf die Strenge und Genauigkeit, die quantitative Methoden mit sich bringen, haben Forscher, die qualitative Methoden anwenden, versucht, ihre eigenen Ansätze zu stärken. So haben sie beispielsweise daran gearbeitet, systematischere Rahmen für die Erhebung und Analyse qualitativer Daten zu entwickeln und die Transparenz und Reproduzierbarkeit ihrer Forschung zu verbessern. Sie haben auch versucht, Elemente statistischer Strenge in ihre Arbeit zu integrieren, z. B. durch die Anwendung von Kodierungsmethoden zur systematischen Analyse von Texten oder Interviews. Darüber hinaus haben qualitative Forscher auch die einzigartigen Vorteile ihrer Methoden hervorgehoben. So betonten sie beispielsweise, dass die qualitative Forschung ein tieferes und differenzierteres Verständnis politischer Phänomene liefern kann, indem sie sich auf Kontext, Interpretation und Bedeutung konzentriert. Sie verteidigten auch die Rolle der qualitativen Forschung bei der Generierung neuer Theorien und bei der Untersuchung von Phänomenen, die schwer zu messen oder zu quantifizieren sind. Auf diese Weise hat der Druck durch quantitative Methoden und die Rational-Choice-Theorie tatsächlich zu einer Stärkung der qualitativen Forschung in der Politikwissenschaft geführt. Dies hat zu einem gesünderen Gleichgewicht zwischen qualitativen und quantitativen Methoden in der Disziplin beigetragen und einen integrativeren Ansatz gefördert, der den Beitrag jeder Methode zum Verständnis des Politischen wertschätzt.
Der Einfluss der dritten wissenschaftlichen Revolution hatte weitreichende Auswirkungen auf alle Bereiche der Politikwissenschaft, einschließlich der qualitativen Forschung. Als Reaktion auf diese Veränderungen wurden zahlreiche wichtige Bücher verfasst, die veranschaulichen, wie die Forscher versuchten, die Strenge und Systematik der qualitativen Forschung zu stärken. Zum Beispiel ist "Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research" von King, Keohane und Verba aus dem Jahr 1994 ein Schlüsselwerk, das einen Ansatz für die qualitative Forschung vorstellte, der sich auf ähnliche Prinzipien der wissenschaftlichen Strenge wie die quantitative Forschung konzentriert.[9] Brady und Collier folgten 2004 mit "Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards", in dem sie dafür plädierten, dass sich quantitative und qualitative Methoden ergänzen sollten, um ein tieferes Verständnis sozialer Phänomene zu erlangen. Außerdem stellten sie verschiedene Werkzeuge und Techniken vor, um die Qualität qualitativer Forschung zu verbessern.[10] George und Bennett veröffentlichten 2005 "Case Studies and Theory Development", ein Buch, das Strategien für die Verwendung von Fallstudien zur Entwicklung und Prüfung von Theorien in der Politikwissenschaft liefert.[11] Schließlich fügte Gerring 2007 diesem Korpus mit "Case Study Research: Principles and Practices" einen umfassenden Leitfaden für die fallstudiengestützte Forschung hinzu.[12] Diese Arbeiten zeigen, wie die qualitative Forschung in der Politikwissenschaft auf die dritte wissenschaftliche Revolution reagiert und sich weiterentwickelt hat. Sie unterstreichen die Bedeutung eines rigorosen und systematischen Ansatzes für die qualitative Forschung und erkennen gleichzeitig die einzigartigen Stärken dieser Methode an.
Um diese allgemeine Übersicht abzuschließen, können wir einige dieser wichtigen Paradigmen zu einer einzigen Idee vereinfachen. Tatsächlich kann jeder Ansatz in einem Spruch zusammengefasst werden, der die Beiträge des Behaviorismus und der Rational-Choice-Theorie gut einfängt:
- Der Behaviorismus bzw. Behaviorismus befasst sich mit den Handlungen und dem Verhalten von Individuen und nicht mit der bloßen institutionellen Struktur. Nach dem Grundsatz "Schau nicht nur auf die formalen Regeln, sondern darauf, was die Menschen wirklich tun" legt der Behaviorismus den Schwerpunkt auf die Beobachtung und Untersuchung der tatsächlichen Handlungen von Einzelpersonen und Gruppen, wobei sowohl die formalen als auch die informellen Regeln, die diese Handlungen leiten, berücksichtigt werden. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Verlagerung der politischen Analyse hin zu einem tieferen Verständnis des Verhaltens von Einzelpersonen und Gruppen.
- Die Rational-Choice-Theorie hingegen beruht auf der Annahme, dass "Individuen durch Macht und Interessen motiviert sind". Sie argumentiert, dass Individuen Entscheidungen auf der Grundlage ihrer persönlichen Interessen treffen und versuchen, ihren Nutzen zu maximieren. Diesem Gedankengang folgend hat die Rational-Choice-Theorie die Analyse politischer Handlungen formalisiert und die Vorhersage von Verhaltensweisen auf der Grundlage des Rationalitätspostulats ermöglicht.
Diese beiden Paradigmen haben bedeutende Beiträge zur Politikwissenschaft geleistet und prägen weiterhin unser Verständnis von politischem Verhalten. Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass jedes Paradigma seine Grenzen hat und dass ein umfassendes Verständnis politischer Phänomene oft eine Kombination verschiedener Ansätze und Methoden erfordert. Neben dem Behaviorismus und der Rational-Choice-Theorie sind zwei weitere wichtige Denkschulen der Politikwissenschaft der Systemismus und der Strukturalismus-Funktionsalismus. Der Systemismus operiert nach dem Prinzip "Alles ist miteinander verbunden, Rückkopplungen sind wesentlich". Diese Philosophie betont die Interdependenz aller Elemente eines politischen Systems. Sie betont die Bedeutung von Rückkopplungen, die durch die Schaffung von Ergebnissen wieder in neue Anforderungen an das politische System einfließen und so dessen Dynamik und Entwicklung beeinflussen. Andererseits wird der Strukturalismus-Funktionsalismus von der Idee geleitet, dass "die Form sich an die Funktion anpasst". Diese Perspektive postuliert, dass die Funktionen der politischen Institutionen ihre Formen bestimmen. Dies ist ein nützlicher Rahmen, um zu verstehen, wie sich politische Institutionen entwickeln und verändern, um den Bedürfnissen und Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden.
Schließlich ist der Institutionalismus eine weitere wichtige Denkschule in der Politikwissenschaft, die nach dem Prinzip "Institutionen zählen" operiert. In der Tat hat sich ein ganzer Zweig dieser Schule, der als historischer Institutionalismus bekannt ist, um diese Idee herum entwickelt. Der historische Institutionalismus konzentriert sich auf die Bedeutung von Institutionen bei der Bestimmung politischer Ergebnisse, wobei der Schwerpunkt auf ihrer Rolle als Spielregeln liegt, die das politische Verhalten prägen, sowie auf der Art und Weise, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln und verändern.
Die Geschichte, die wir gerade durchlaufen haben, entspricht dem, was Almond als die "progressiv-eklektische Perspektive" der Geschichte der Politikwissenschaft definiert hat.[13] Diese Perspektive, die als Mainstream der Politikwissenschaft angesehen werden kann, erkennt den Wert vieler verschiedener Ansätze innerhalb der Disziplin an. Sie betont den wissenschaftlichen Fortschritt, der durch die Integration von Elementen aus verschiedenen Denkschulen, einschließlich Behaviorismus, Rational-Choice-Theorie, Systemismus, Strukturalismus-Funktionsalismus und Institutionalismus, erzielt wurde. Nach dieser Perspektive bringt jeder Ansatz einzigartige Werkzeuge und Perspektiven mit sich, die zusammen zu einem umfassenderen Verständnis politischer Phänomene beitragen.
Diese "progressiv-eklektische Perspektive" ist nicht allgemein anerkannt, wird aber weitgehend von denjenigen akzeptiert, die sich an ihre Definition von Wissen und Objektivität halten, die auf der Trennung von Fakten und Werten und der Einhaltung von Standards für empirische Beweise beruht.
Der "progressive" Aspekt bezieht sich auf die Verpflichtung gegenüber der Idee des wissenschaftlichen Fortschritts, der sich sowohl in einer quantitativen Anhäufung von Wissen - in Form des Umfangs des im Laufe der Zeit angesammelten Wissens - als auch in einer qualitativen Verbesserung der Strenge und Genauigkeit dieses Wissens manifestiert.
Der "eklektische" Aspekt der Perspektive beschreibt einen nicht-hierarchischen und integrativen Ansatz zum Pluralismus. Das bedeutet, dass kein Ansatz oder eine Denkschule als den anderen überlegen angesehen wird. Alle Perspektiven und Methoden werden begrüßt und können zur Gesamtsumme des Wissens in dieser vorherrschenden Sicht der Politikwissenschaft beitragen. Daher können Ansätze wie die Rational-Choice-Theorie und der Institutionalismus Arbeiten hervorbringen, die sich gut in diese progressiv-eklektische Perspektive einfügen.
Diese Zusammenfassungen stellen die Entwicklung der Disziplin dar, indem sie die verschiedenen Revolutionen und Klassifizierungen beschreiben. Sie veranschaulichen auch die Entwicklung der Methoden im Laufe der Zeit :
Histoires alternatives de la discipline
Bien que la "perspective progressiste-éclectique" soit largement acceptée, il est important de noter qu'il existe d'autres écoles de pensée qui offrent des histoires alternatives de la science politique. Ces perspectives peuvent différer sur des questions clés, comme l'importance relative des différentes approches ou l'évolution de la discipline au fil du temps. Elles peuvent également mettre l'accent sur différents aspects de la science politique, ou interpréter différemment les mêmes événements ou tendances. Ces histoires alternatives contribuent à la richesse et à la diversité de la science politique en tant que discipline.
Les courants contestataires : Antiscience et post-science
Il existe des courants de pensée en science politique qui rejettent l'idée que la discipline est intrinsèquement scientifique et progressiste. Certains courants postmodernistes et post-structuralistes, par exemple, peuvent remettre en question l'idée que la science politique peut être une entreprise purement objective ou neutre. Ils suggèrent que toutes les connaissances sont enracinées dans des contextes culturels, sociaux et historiques spécifiques, et que la soi-disant "objectivité" peut souvent masquer des formes de pouvoir et de domination. D'autres courants, comme le féminisme ou la théorie critique, peuvent également rejeter l'idée du progrès linéaire en science politique. Ils pourraient souligner que les avancées dans la connaissance ne profitent pas toujours également à tous, et que certaines voix ou perspectives peuvent être marginalisées dans le processus. Ces courants offrent une critique importante de l'orthodoxie dominante en science politique, et ils ont contribué à stimuler un débat et une réflexion importants sur la nature de la connaissance et de la recherche en science politique.
L'antiscience : Une critique du scientisme
La position "antiscience" en science politique est généralement associée à des penseurs comme Claude Lévi-Strauss. Cette perspective critique la division weberienne entre faits et valeurs et remet en question l'idée que nous pouvons objectiver la réalité sociale. De plus, elle rejette le behavioralisme et, plus généralement, le positivisme, qui cherche à étudier les phénomènes politiques de manière causale et empirique.
Pour ceux qui adoptent une perspective antiscience, l'introduction de méthodes scientifiques en science politique est non seulement illusoire, mais elle peut aussi nuire à notre compréhension de la dynamique sociale. Ils suggèrent que l'accent mis sur la rigueur empirique et l'objectivité peut obscurcir les complexités et les nuances de la vie sociale et politique, et réduire ces phénomènes à des éléments triviaux ou simplistes.
Il est important de noter que bien que cette position soit critique à l'égard des méthodes scientifiques traditionnelles, elle n'est pas nécessairement contre toute forme de recherche ou d'analyse. Au contraire, beaucoup de ceux qui adoptent une position antiscience soutiennent des formes alternatives de recherche, qui mettent l'accent sur l'interprétation, le contexte et la signification.
Claude Lévi-Strauss défend une approche de la science sociale qui soit à la fois humaniste et engagée. Cette approche envisage une collaboration intime et passionnée avec les grands philosophes et les grandes philosophies pour discuter et comprendre le sens des idées centrales de la science politique. Pour Lévi-Strauss, la science sociale doit viser à interpréter les phénomènes sociaux plutôt qu'à simplement les expliquer de manière mécanique ou causale.
Selon lui, la méthode scientifique, lorsqu'elle est appliquée aux sciences sociales, peut créer une illusion de précision et d'objectivité qui masque la complexité et la subjectivité des phénomènes sociaux. Au lieu de cela, il soutient une approche qui valorise le contexte, le sens et la perspective humaine. Cette vision rejette l'idée que la science politique doit nécessairement suivre le modèle des sciences naturelles, et elle propose une vision alternative de ce que pourrait être une science sociale authentiquement humaniste et engagée.
La post-science : Vers une nouvelle compréhension de la réalité
La position "post-science" est souvent associée à certains courants de pensée constructivistes et postmodernistes. Elle se situe dans une perspective post-behavioriste et post-positiviste.
Parmi les figures emblématiques de ce courant, on trouve le philosophe Jacques Derrida, qui a introduit l'idée de "déconstruction". Cette approche critique et analytique remet en question les structures de pensée et les catégories conceptuelles traditionnellement acceptées. Pour Derrida, la déconstruction vise à révéler les sous-entendus, les suppositions et les contradictions souvent ignorées qui sous-tendent nos discours et nos compréhensions habituelles.
Dans le contexte de la science politique, une approche post-scientifique pourrait remettre en question les hypothèses et les méthodes de la recherche conventionnelle. Elle pourrait suggérer, par exemple, que les catégories et concepts traditionnels de la science politique sont culturellement spécifiques et historiquement contingents, plutôt que universels ou objectifs. Elle pourrait également remettre en question l'idée que la recherche politique peut être menée de manière neutre ou objective, en soulignant comment les chercheurs sont toujours situés dans des contextes politiques, culturels et historiques spécifiques.
La position post-scientifique, tout comme la position anti-scientifique, rejette la dichotomie classique entre les jugements de faits et les jugements de valeurs. Cette approche adopte une posture critique, affirmant que toute analyse ou interprétation est inévitablement teintée par les valeurs et les présupposés de celui qui l'entreprend. Les adeptes de cette école de pensée appellent à la fin du positivisme, c'est-à-dire de l'idée que les affirmations doivent être soutenues par des preuves empiriques pour être considérées comme valides. Ils contestent l'idée que la vérification empirique doit être l'unique critère de validité dans les sciences humaines. Plutôt que de chercher à établir des vérités objectives incontestables, les tenants de cette approche cherchent à révéler les différentes perspectives et interprétations possibles d'un phénomène. Ils soutiennent que la recherche en sciences humaines doit nécessairement tenir compte du contexte social, culturel et historique, ainsi que des valeurs et des présupposés du chercheur. Cette position invite à une réflexion plus approfondie sur la manière dont la connaissance est produite et utilisée en science politique.
Chaque perspective théorique est inextricablement liée à des choix fondamentaux qui structurent la manière dont nous appréhendons et étudions le monde. Ces choix concernent l'ontologie, l'épistémologie et la méthodologie:
- L'ontologie se rapporte à notre compréhension de la nature du monde social et politique, à ce qui "est". Elle englobe un ensemble de postulats et d'affirmations qu'une approche théorique spécifique fait sur la nature de la réalité sociale. Cela inclut des questions sur ce qui existe réellement et sur l'entité ou l'unité de base qui constitue le politique ou l'objet d'analyse en science politique.
- L'épistémologie concerne ce que nous pouvons connaître du monde social et politique. Elle explore les limites et les possibilités de notre connaissance, en se posant des questions sur la nature et la validité de la connaissance que nous pouvons acquérir.
- Enfin, la méthodologie fait référence aux procédures que nous utilisons pour acquérir cette connaissance. Elle détermine les outils, techniques et approches que nous employons dans notre recherche, et guide la manière dont nous collectons, analysons et interprétons nos données.
En somme, ces trois dimensions sont intimement liées et façonnent la manière dont nous concevons et menons notre recherche en science politique. Chaque approche théorique fait des choix distincts dans ces trois domaines, ce qui donne lieu à une diversité d'approches et de perspectives en science politique.
En ce qui concerne la nature de la réalité, ou ce qui "est", il existe en effet une distinction majeure entre les postmodernes et le courant dominant progressiste-éclectique. Le courant progressiste-éclectique adopte généralement une ontologie objective. Cela signifie qu'ils considèrent que la réalité existe indépendamment de nos perceptions ou de nos interprétations. Ils soutiennent que nous pouvons observer et étudier cette réalité à travers une recherche empirique rigoureuse, et qu'elle existe en dehors de nos constructions mentales ou sociales. Les postmodernes, en revanche, adoptent souvent une ontologie plus subjective ou constructiviste. Ils soutiennent que la réalité est socialement construite, et qu'elle est façonnée par nos perceptions, nos interprétations et nos discours. Pour eux, la réalité n'existe pas indépendamment de nos conceptions ou de notre langue, et ne peut donc pas être étudiée de manière objective ou indépendante. Cela conduit à une approche très différente de la recherche, qui met l'accent sur l'interprétation, la critique et la déconstruction des discours sociaux et politiques.
Pour les postmodernistes, la réalité et sa représentation sont intimement liées. Selon eux, notre compréhension du monde est intrinsèquement façonnée par la façon dont nous le représentons, que ce soit à travers le langage, la culture, l'art ou d'autres formes de discours social. Ils soutiennent que ces représentations ne sont pas simplement des reflets passifs de la réalité, mais qu'elles jouent un rôle actif dans la construction de notre réalité. Pour les postmodernistes, il n'y a pas de distinction claire entre la réalité objective et notre représentation subjective de celle-ci. Au lieu de cela, notre compréhension de la réalité est constamment construite et re-construite à travers nos interactions sociales et nos discours culturels. Ils s'intéressent donc à la façon dont les représentations et les discours façonnent notre compréhension du monde politique, et à la manière dont ces constructions peuvent être déconstruites et critiquées.
Ce tableau résume la position ontologique, épistémologique et méthodologique caractéristique de l’école postmoderne.
En ce qui concerne l'épistémologie, la perspective postmoderne souligne l'incertitude et le scepticisme. Plutôt que de chercher à établir des vérités absolues ou des faits indiscutables, les postmodernistes soutiennent que notre connaissance est toujours conditionnée par notre perspective et nos cadres de référence culturels et sociaux. Ils contestent donc l'idée que nous puissions atteindre une connaissance objective ou universelle. Cela signifie que, pour les postmodernistes, le savoir n'est jamais "fixe" ou "définitif". Au lieu de cela, notre compréhension du monde est constamment en évolution, à mesure que nous interagissons avec d'autres et que nous nous engageons dans de nouveaux discours et pratiques culturelles. Cette perspective défie l'idée que le savoir peut être défini uniquement par des preuves empiriques ou des tests scientifiques, et soutient que notre compréhension de la réalité est toujours façonnée par notre contexte social et culturel.
Selon la perspective postmoderne, toutes les connaissances sont intrinsèquement subjectives, dépendant du point de vue individuel de chaque chercheur ou observateur. Cette subjectivité entraîne nécessairement une diversité d'interprétations et de compréhensions du monde social et politique. De plus, le postmodernisme met l'accent sur l'importance de déconstruire les discours dominants. L'objectif n'est pas simplement d'accepter ces discours comme des vérités établies, mais de les examiner de manière critique et de remettre en question leurs hypothèses sous-jacentes et leurs effets de pouvoir. En particulier, les postmodernistes cherchent à faire entendre les voix dissonantes ou marginalisées qui sont souvent exclues ou négligées par les discours dominants. Ils soutiennent que ces voix ont une valeur et une légitimité égales dans l'analyse politique et doivent être intégrées dans la conversation académique. En somme, le postmodernisme met en avant une approche critique de la science politique, qui valorise la diversité des perspectives et s'engage activement à contester et à remettre en question les discours et les structures de pouvoir établis.
Les opposants à l'éclectisme : Néomarxistes et théoriciens du choix rationnel
Certains courants de la science politique rejettent l'éclectisme, c'est-à-dire le pluralisme dans le choix des théories et des méthodes. Ces courants, souvent plus dogmatiques, estiment qu'il y a une ou quelques approches théoriques ou méthodologiques qui sont supérieures aux autres et qui devraient être prédominantes dans la discipline. Par exemple, certains défenseurs de la théorie du choix rationnel soutiennent que cette approche, qui utilise des modèles économiques pour expliquer le comportement politique, est la plus précise et la plus utile pour comprendre la politique. Ils critiquent l'éclectisme pour son manque de rigueur et de cohérence théorique. De même, certains chercheurs qualitatifs critiquent l'éclectisme pour son accent sur les méthodes quantitatives et sa négligence des méthodes qualitatives. Ils estiment que l'analyse qualitative, qui se concentre sur l'interprétation et le contexte, offre une compréhension plus profonde et plus nuancée de la politique que ne le permettent les méthodes quantitatives. Ainsi, bien que l'éclectisme soit une caractéristique clé de la perspective progressiste-éclectique, il est loin d'être universellement accepté en science politique. Certaines écoles de pensée préfèrent une approche plus unifiée et plus spécifique à la discipline.
Les néomarxistes : Une perspective radicalement différente
Les néomarxistes sont un courant de la science politique qui s'appuie sur les idées de Karl Marx, mais qui cherche à les moderniser et à les adapter au monde contemporain. Leur objectif est d'utiliser les concepts et les théories marxistes pour comprendre et critiquer la politique contemporaine.
Selon les néomarxistes, la vérité de la science sociale a été découverte et élaborée par Karl Marx au XIXème siècle. Ils estiment que Marx a découvert les lois fondamentales du capitalisme et de la lutte des classes, qui sont toujours pertinentes pour comprendre la politique aujourd'hui. Cependant, les néomarxistes ne sont pas des marxistes orthodoxes. Ils ne se contentent pas de répéter les idées de Marx, mais cherchent à les développer et à les étendre. Par exemple, des auteurs néomarxistes comme Nico Poulantzas et Robert Cox ont cherché à incorporer des idées de la sociologie, de la théorie politique et des études internationales dans leur analyse marxiste. Ainsi, tout en restant fidèles à l'engagement de Marx envers une analyse critique du capitalisme, les néomarxistes cherchent à développer une interprétation plus riche et plus nuancée de la politique, qui tient compte des changements dans la structure du capitalisme et dans la nature de la lutte des classes depuis l'époque de Marx.
Les néomarxistes adhèrent à l'idée que les lois sociétales dévoilées par Marx représentent une vision intégrée des processus historiques, économiques, sociaux et politiques, ainsi que du comportement humain au sein de ces structures. Ils croient que ces éléments forment un tout indivisible, et que l'histoire suit une trajectoire évolutive unidirectionnelle. Cette vision se fonde sur la conviction que les structures économiques, notamment le système capitaliste, déterminent en grande partie les dynamiques sociales et politiques. De plus, elle présuppose que le cours de l'histoire est largement déterminé par des conflits de classe et des forces matérielles, qui poussent la société vers une certaine direction. C'est en ce sens que l'interprétation néomarxiste de la politique et de l'histoire est à la fois holistique et orientée vers le futur : elle considère que tous les aspects de la société sont interconnectés, et qu'ils évoluent ensemble vers une certaine destination historique, souvent conçue comme l'avènement d'une société post-capitaliste plus égalitaire.
La perspective néomarxiste est déterministe dans le sens où elle fait écho à la conception marxiste d'un antagonisme de classe inhérent au mode de production capitaliste. Selon cette perspective, cette tension de classe est destinée à entraîner l'effondrement du système de classe et à déclencher une révolution communiste. De ce fait, il y a un rejet de l'éclectisme, car l'idéologie néomarxiste suggère qu'il est difficile, voire impossible, d'intégrer de nouvelles idées ou perspectives qui ne correspondent pas à ce cadre théorique prédéterminé. En d'autres termes, cette approche donne peu de place à l'innovation ou à l'apport de nouvelles idées qui ne sont pas en phase avec les principes marxistes fondamentaux.
La perspective néomarxiste, en se concentrant principalement sur les conflits de classe et les forces économiques, peut négliger d'autres facteurs explicatifs importants en science politique. Par exemple, elle peut ne pas prendre suffisamment en compte le rôle des institutions politiques, qui peuvent structurer le comportement politique de manière indépendante des forces économiques. De plus, elle peut minimiser l'importance de facteurs identitaires comme l'ethnicité et le nationalisme, qui peuvent avoir une influence profonde sur la politique même en l'absence de conflits de classe clairs. Enfin, cette perspective peut aussi négliger le rôle du système international, en se concentrant plutôt sur les dynamiques internes des pays. Cela peut limiter sa capacité à expliquer les politiques étrangères et les relations internationales.
Les théories néomarxistes peuvent avoir du mal à expliquer des phénomènes comme le soutien du Parti social-démocrate allemand (SPD) pour les crédits de guerre en 1914. Selon la théorie de Marx, la classe ouvrière internationale devrait s'unir contre le système capitaliste plutôt que de se diviser sur des lignes nationales. Pourtant, dans cet exemple historique, nous voyons que le SPD, qui représentait la classe ouvrière en Allemagne, a choisi de soutenir l'effort de guerre de son propre pays plutôt que de s'opposer à la guerre au nom de la solidarité internationale de la classe ouvrière. Cela met en évidence certaines limites des théories néomarxistes. Il peut y avoir de nombreux facteurs, comme le nationalisme, qui peuvent pousser les travailleurs à agir de manière contraire aux prédictions de la théorie de Marx. Cela suggère qu'une compréhension complète de la politique nécessite d'examiner un large éventail de facteurs et de forces, et pas seulement les conflits de classe et les dynamiques économiques.
Les théoriciens du choix rationnel : Une approche axée sur l'individu
Les théoriciens du choix rationnel sont un groupe important dans le domaine de la science politique, et ils tirent leurs origines et leurs méthodes de l'économie. La théorie du choix rationnel est basée sur l'idée que les individus agissent toujours de manière à maximiser leur propre avantage ou leur propre utilité. Dans le contexte politique, cela signifie que les acteurs politiques - qu'il s'agisse de votants, de législateurs, de partis politiques, etc. - prennent leurs décisions en fonction de leurs intérêts personnels et de la façon dont ils perçoivent que différentes options pourraient les aider à atteindre leurs objectifs. Cette approche est souvent utilisée pour modéliser le comportement politique et pour expliquer un large éventail de phénomènes politiques, allant du vote à la formation des coalitions gouvernementales. Les théoriciens du choix rationnel utilisent souvent des outils mathématiques et statistiques sophistiqués, comme la théorie des jeux, pour élaborer et tester leurs modèles.
Les pionniers de la théorie du choix rationnel dans le domaine de la science politique, tels que Kenneth Arrow, Anthony Downs et Mancur Olson, ont été parmi les premiers à appliquer les méthodes et les modèles économiques à l'analyse des phénomènes politiques après la Seconde Guerre mondiale. Kenneth Arrow, un économiste de renom, a développé le fameux "théorème d'impossibilité" qui démontre les limites inhérentes à toute procédure de vote collective. Anthony Downs, dans son livre influent "An Economic Theory of Democracy", a établi un cadre pour comprendre le comportement des électeurs et des partis politiques comme étant guidé par l'auto-intérêt. De son côté, Mancur Olson, dans "La logique de l'action collective", a analysé pourquoi et quand les gens choisissent de participer à des actions collectives, telles que les syndicats ou les mouvements sociaux. Ces chercheurs ont jeté les bases de l'application de la théorie du choix rationnel à la science politique, et leur travail continue d'influencer la discipline à ce jour.
L'approche de la théorie du choix rationnel cherche à développer une théorie unifiée de la science politique. Elle procède par déduction à partir d'axiomes ou de postulats dérivés de l'économie. Parmi ces postulats fondamentaux, l'individu est considéré comme un homo economicus : un être rationnel qui est principalement motivé par l'intérêt personnel. Cet individu effectue constamment des calculs de coûts et de bénéfices dans le but de maximiser sa satisfaction. Ces postulats donnent naissance à des hypothèses qui sont ensuite soumises à des tests empiriques pour vérifier leur validité. Ainsi, la théorie du choix rationnel offre un cadre théorique strict et cohérent pour expliquer et prédire le comportement humain dans le domaine politique.
La théorie du choix rationnel est également reconnue pour sa parcimonie, car elle vise à expliquer la politique avec un nombre minimal d'axiomes et de postulats. Elle affiche une ambition universelle, cherchant à expliquer tous les phénomènes politiques. De plus, elle soutient que les théories spécifiques qu'elle génère pour des domaines précis peuvent être intégrées dans une théorie plus globale de la politique. En d'autres termes, elle aspire à créer un cadre théorique complet et englobant, capable de couvrir l'ensemble des phénomènes politiques à travers des principes simples et universels.
Dans cette optique, on peut constater que la théorie du choix rationnel rejette le pluralisme (ou l'éclectisme) en faveur d'une structure hiérarchique, en insistant sur la prééminence de son modèle. En d'autres termes, les théoriciens du choix rationnel tendent à voir leur approche comme supérieure, en affirmant qu'elle peut fournir une explication unifiée et universelle des phénomènes politiques. C'est donc dans cette perspective qu'ils contredisent le principe de l'éclectisme, qui valorise la coexistence et l'interaction de diverses théories et approches. En outre, la théorie du choix rationnel se présente comme une rupture majeure, considérant que tout ce qui l'a précédée est de l'ordre du préscientifique. En d'autres termes, elle propose une vision qui remet en question les approches antérieures, les qualifiant de moins rigoureuses ou moins systématiques dans leur méthodologie, et donc moins "scientifiques" en comparaison.
Anhänge
Referenzen
- ↑ Lasswell, Harold Dwight, 1902- Politics; who gets what, when, how. New York, London, Whittlesey house, McGraw-Hill book Co. [c1936] (OCoLC)576783700
- ↑ Goodin, R 2009, 'The State of the Discipline, The Discipline of the State', in Robert E. Goodin (ed.), Oxford Handbook of Political Science, Oxford University Press, Oxford, pp. 3-57.
- ↑ Duesenberry, 1960, S. 233
- ↑ Karl Marx (Übersetzung von R. Cartelle und G. Badia), éd. sociales, coll. Classiques du marxisme, 1972, Kap. Les origines du coup d'État du 2 Décembre, S. 161
- ↑ Herbert Baxter Adams (1883). The Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science . S. 12.
- ↑ Lasswell, Harold Dwight, and Dorothy Blumenstock. World Revolutionary Propaganda: A Chicago Study. New York: Knopf, 1939.
- ↑ Lipset, Seymour Martin. Political Man; the Social Bases of Politics. Garden City, NY: Doubleday, 1960.
- ↑ Almond, Gabriel A., and Sidney Verba. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton UP, 1963.
- ↑ King, Gary/ Keohane, Robert O./ Verba, Sidney: Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton University Press, 1994.
- ↑ Henry E. Brady & David Collier (Eds.) (2004). Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 362 Seiten, ISBN 0-7425-1126-X, USD 27,95
- ↑ Case Studies and Theory Development in the Social Sciences Alexander George, Andrew Bennett Cambridge, USA Perspectives on Politics - PERSPECT POLIT 01/2007; 5(01):256. DOI:10.1017/S15375927070491 Edition: 1st Ed., Publisher: MIT Press, pp.256
- ↑ Case Study Research: Principles and Practices. John Gerring (Cambridge University Press, 2007). doi:10.1017/S0022381607080243
- ↑ Almond, Gabriel A. "Political Science: The History of the Discipline." A new handbook of political science 75-82 (1996): 50.