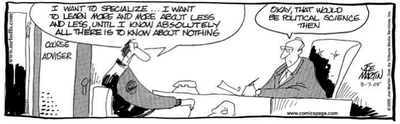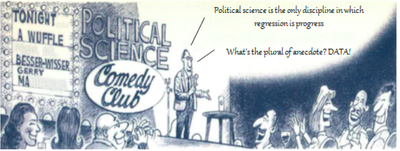Der Begriff des "Konzepts" in den Sozialwissenschaften
Das soziale Denken von Émile Durkheim und Pierre Bourdieu ● Zu den Ursprüngen des Untergangs der Weimarer Republik ● Das soziale Denken von Max Weber und Vilfredo Pareto ● Der Begriff des "Konzepts" in den Sozialwissenschaften ● Geschichte der Disziplin Politikwissenschaft: Theorien und Konzepte ● Marxismus und Strukturalismus ● Funktionalismus und Systemismus ● Interaktionismus und Konstruktivismus ● Die Theorien der politischen Anthropologie ● Die Debatte der drei I: Interessen, Institutionen und Ideen ● Die Theorie der rationalen Wahl und die Interessenanalyse in der Politikwissenschaft ● Analytischer Ansatz der Institutionen in der Politikwissenschaft ● Die Untersuchung von Ideen und Ideologien in der Politikwissenschaft ● Theorien des Krieges in der Politikwissenschaft ● Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen ● Die Staatsraison ● Staat, Souveränität, Globalisierung, Multi-Level-Governance ● Gewalttheorien in der Politikwissenschaft ● Welfare State und Biomacht ● Analyse demokratischer Regime und Demokratisierungsprozesse ● Wahlsysteme: Mechanismen, Herausforderungen und Konsequenzen ● Das Regierungssystem der Demokratien ● Morphologie der Anfechtungen ● Handlung in der politischen Theorie ● Einführung in die Schweizer Politik ● Einführung in das politische Verhalten ● Analyse der öffentlichen Politik: Definition und Zyklus einer öffentlichen Politik ● Analyse der öffentlichen Politik: Agendasetzung und Formulierung ● Analyse der öffentlichen Politik: Umsetzung und Bewertung ● Einführung in die Unterdisziplin Internationale Beziehungen ● Einführung in die politische Theorie
In den Sozialwissenschaften ist ein "Konzept" eine abstrakte Idee oder Kategorie, die es Forschern ermöglicht, die soziale Welt einzuordnen und zu verstehen. Konzepte sind wesentliche Werkzeuge, um soziale Phänomene zu denken, zu analysieren und zu erklären. Sie helfen uns, die Komplexität der sozialen Welt zu vereinfachen, indem wir verschiedene Beobachtungen, Ideen und Phänomene in analytischen Kategorien zusammenfassen und organisieren.
Je nach Disziplin können Konzepte verschiedene Formen annehmen. In der Soziologie werden beispielsweise Konzepte wie "Anomie", "Bürokratie" oder "Sozialkapital" verwendet, um bestimmte soziale Phänomene zu charakterisieren und zu analysieren. In der Wirtschaftswissenschaft werden Konzepte wie "Marktgleichgewicht", "Angebot und Nachfrage" oder "Humankapital" verwendet. In der Politikwissenschaft werden üblicherweise Konzepte wie "Demokratie", "Macht" oder "Governance" verwendet.
Die Konstruktion eines Konzepts ist ein wichtiger Schritt in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Dies beinhaltet in der Regel eine klare Definition des Konzepts sowie die Identifizierung seiner verschiedenen Dimensionen oder Merkmale. Manchmal können die Forscher die Konzepte auch operationalisieren, d. h. sie in messbare Variablen übersetzen, die in der empirischen Forschung verwendet werden können.
Ewige Debatten und Kontroversen[modifier | modifier le wikicode]
Die Politikwissenschaft ist von Natur aus dynamisch und durch eine Abfolge von sich ständig verändernden Debatten und Kontroversen geprägt. Diese Diskussionen beeinflussen die Forschungslandschaft in diesem Bereich tiefgreifend, unabhängig davon, ob es sich um theoretische, methodologische oder inhaltliche Fragen handelt. Wesentlich sind die Debatten beispielsweise in Bezug auf die Rolle des Staates in der Gesellschaft, wobei die Perspektiven von einem minimalistischen Staat bis hin zu einem stärker interventionistischen Staat reichen. Eine weitere grundlegende Debatte betrifft die Definition von Demokratie, ihre wesentlichen Bestandteile und die Frage, wie ihre Qualität gemessen werden kann. Darüber hinaus prägt die ewige Debatte über rationales individuelles Verhalten versus den Einfluss von Gruppennormen und -identitäten weiterhin das Verständnis von politischen Phänomenen wie der Stimmabgabe oder der Parteibildung. Schließlich bleibt auch die Debatte über die Methodik, insbesondere zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen, eine Schlüsselfrage. Die Art und Weise, wie diese Debatten angegangen und gelöst werden, beeinflusst die Entwicklung der politikwissenschaftlichen Forschung, indem sie unser Verständnis von politischen Phänomenen verbessert und die Theorien und Methoden in diesem Bereich verfeinert.
Diese Debatten in der Politikwissenschaft sind in dem Sinne immerwährend, dass sie trotz der Zeit und der Entwicklungen des Fachs fortbestehen. Sie sind oft schwer durch eine einfache empirische Analyse zu lösen, da sie eher grundlegende Fragen der Theorie und Philosophie umfassen als solche, die durch Datenerhebung oder direkte Beobachtung gelöst werden können. Darüber hinaus können unterschiedliche Methodologien, begriffliche Definitionen und theoretische Rahmen die Art und Weise beeinflussen, wie Forscher empirische Daten interpretieren, was wiederum diese Debatten anheizen kann. Darüber hinaus sind diese Debatten oft paradigmatisch, d.h. sie betreffen die Grundrahmen oder Paradigmen, die das Denken in der Politikwissenschaft strukturieren. Ein Paradigma ist eine spezifische Art und Weise, die Welt zu verstehen, die grundlegende Annahmen über die Natur der Realität und die Art und Weise, wie wir sie erkennen, umfasst. Paradigmatische Debatten können beispielsweise die Frage betreffen, ob Individuen im Wesentlichen rational sind oder ob ihr Verhalten stark von sozialen und kulturellen Faktoren beeinflusst wird, oder die Frage, ob es in der Politik hauptsächlich um den Kampf um die Macht geht oder ob sie auch von Idealen der Gerechtigkeit oder des Gemeinwohls beeinflusst werden kann. Diese Debatten sind von entscheidender Bedeutung, denn sie prägen die Art und Weise, wie Wissenschaftler der Politikwissenschaft ihre Studien konzipieren, ihre Ergebnisse interpretieren und die politische Welt verstehen. Sie tragen zur Weiterentwicklung des Fachs bei und regen zu kontinuierlicher Forschung und Reflexion an.
Analyseebenen in der Politikwissenschaft[modifier | modifier le wikicode]
Kenneth Waltz, ein bedeutender Theoretiker der internationalen Beziehungen, hat in seinem Werk "Man, The State, and War" (1959) eine Typologie der Analyseebenen internationaler Konflikte vorgeschlagen. Diese Typologie hat zu zahlreichen Debatten und Kontroversen im Bereich der internationalen Beziehungen und der Politikwissenschaft im Allgemeinen geführt.
Waltz identifizierte drei "Bilder" oder Analyseebenen:
- Die individuelle Ebene: Dies konzentriert sich auf Individuen und ihre Handlungen. Dazu gehört die Untersuchung der persönlichen Merkmale von Führungskräften, wie z. B. ihre Überzeugungen, Werte, Persönlichkeit und ihr Verhalten. Dies kann auch die Untersuchung psychologischer Prozesse wie Wahrnehmung, Kognition und Motivation beinhalten.
- Die Ebene des Staates: Dies beinhaltet die Untersuchung der inneren Merkmale von Staaten, wie z. B. ihre politische Struktur, Wirtschaft, Kultur und Demografie. Dies könnte auch die Untersuchung der politischen Prozesse innerhalb von Staaten beinhalten, wie z. B. Entscheidungsfindung, Politikformulierung und Konfliktmanagement.
- Die systemische Ebene: Dies konzentriert sich auf das internationale System als Ganzes. Dies beinhaltet die Untersuchung der Struktur des internationalen Systems, einschließlich der Machtverteilung zwischen den Staaten, der internationalen Normen und Institutionen und der Muster der Beziehungen zwischen den Staaten.
Diese verschiedenen Analyseebenen bieten unterschiedliche Perspektiven auf internationale Konflikte, und die Forscher können sich in ihren Analysen auf eine oder mehrere dieser Ebenen konzentrieren. Die Wahl der Analyseebene kann jedoch oftmals eine Quelle von Kontroversen sein, da sie beeinflussen kann, wie ein Konflikt verstanden wird und welche Strategien folglich als angemessen zur Lösung des Konflikts angesehen werden.
Im Rahmen der individuellen Analyseebene von Waltz werden die menschliche Natur und das individuelle Verhalten als entscheidende Faktoren bei der Erklärung von Konflikten und Krieg angesehen. Aus dieser Perspektive können menschliche Eigenschaften wie Egoismus, Aggressivität und Machtstreben als zugrunde liegende Ursachen für Krieg gesehen werden. Die Idee dahinter ist, dass bestimmte Aspekte der menschlichen Natur, insbesondere unsere Fähigkeit, egoistisch oder aggressiv zu handeln, uns dazu bringen können, mit anderen in Konflikt zu treten. Beispielsweise könnte ein Führer, der von Machtstreben getrieben wird und bereit ist, Gewalt anzuwenden, um diese Macht zu erlangen, eher dazu neigen, einen Krieg anzuzetteln. Wenn diese individuellen Verhaltensweisen auf die Ebene einer Gesellschaft oder Nation multipliziert werden, können sie dann zu großflächigen Konflikten führen. Wenn zum Beispiel viele Individuen in einer Gesellschaft starke nationalistische Gefühle haben und bereit sind, Gewalt anzuwenden, um ihre Nation zu verteidigen, könnte dies das Risiko eines Krieges erhöhen.
Diese Perspektive ist umstritten. Viele Forscher argumentieren, dass Krieg nicht einfach durch die menschliche Natur erklärt werden kann, und dass Faktoren wie die politische Struktur, die Wirtschaft und das internationale System ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus gibt es eine große Vielfalt an menschlichen Verhaltensweisen, und nicht jeder Einzelne oder jede Gesellschaft ist egoistisch, aggressiv oder machthungrig. Daher ist die Frage, inwieweit die menschliche Natur als Ursache für Krieg angesehen werden kann, eine Frage, die in der Politikwissenschaft und den internationalen Beziehungen immer wieder diskutiert wird.
Auf der internen Ebene legt das Modell von Waltz nahe, dass Außenpolitik und Konflikte von einer Vielzahl von inländischen Faktoren beeinflusst werden können. Die internen politischen Strukturen, die Art des Regimes, die öffentliche Meinung und die Interessen bestimmter Gruppen innerhalb des Staates können alle einen erheblichen Einfluss auf außenpolitische Entscheidungen haben. In einem autokratischen Regime können Entscheidungen beispielsweise stark von den Interessen des Herrschers oder der kleinen Gruppe, die die Macht innehat, beeinflusst werden. Dazu können persönliche oder wirtschaftliche Interessen gehören, wie der Wunsch, die politische Kontrolle zu behalten, oder die Gewinne, die der militärisch-industrielle Komplex durch den Verkauf von Waffen oder den Wiederaufbau nach einem Konflikt erzielen kann. In ähnlicher Weise kann auch die öffentliche Meinung eine Rolle in der Außenpolitik spielen. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung beispielsweise militärische Maßnahmen befürwortet, kann dies Druck auf die politischen Führer ausüben, eine härtere Linie in ihren internationalen Beziehungen einzuschlagen. Umgekehrt kann eine breite öffentliche Ablehnung von Krieg die Staatsführer davon abhalten, in einen Konflikt einzutreten. Wie bei der individuellen Analyseebene kann auch die interne Analyseebene nicht alle Aspekte der Außenpolitik oder von Konflikten erklären. Systemische Faktoren, wie die Machtverteilung zwischen den Staaten oder internationale Normen und Institutionen, können ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen.
Die Debatte um die interne Analyseebene in der Politikwissenschaft, wie von Waltz vorgeschlagen, ist aufgrund mehrerer Faktoren immerwährend. Erstens ist die Innenpolitik ein komplexes Feld, das eine Vielzahl von Dimensionen umfasst - von Institutionen über wirtschaftliche und kulturelle Praktiken bis hin zur öffentlichen Meinung -, deren Interaktion und Einfluss auf die Außenpolitik noch lange nicht klar definiert ist. Zweitens bleibt die Frage nach der relativen Bedeutung interner Faktoren im Vergleich zu den anderen Analyseebenen offen. Einige Forscher sind der Ansicht, dass interne Faktoren vorherrschend sind, während andere individuelle oder systemische Faktoren bevorzugen. Darüber hinaus schafft der ständige Wandel der politischen Systeme ein bewegtes Terrain für die Untersuchung der internen Faktoren. Das Aufkommen neuer Formen des Regierens, wie etwa des Populismus, wirft neue Fragen über ihre Auswirkungen auf die Außenpolitik auf. Schließlich bleibt die Debatte über die genaue Art der Kausalität - wie führen interne Faktoren spezifisch zu Verhaltensweisen auf internationaler Ebene und wie groß ist ihre relative Bedeutung - weitgehend offen. Diese grundlegenden Fragen sorgen dafür, dass die Debatte um die interne Analyseebene fortbesteht, und regen so die Forschung und Reflexion in der Politikwissenschaft und den internationalen Beziehungen an.
Die externe Analyseebene, auch systemische Ebene genannt, bezieht sich auf die Struktur des internationalen Systems als Ganzes. Inspiriert von Realismus und Neorealismus legt diese Ebene den Schwerpunkt auf die internationale Anarchie, d. h. das Fehlen einer globalen Autorität, die über den souveränen Nationalstaaten steht. In diesem Kontext der Anarchie werden die Staaten als Hauptakteure betrachtet und es wird davon ausgegangen, dass sie nach ihren eigenen Interessen handeln, um ihre Sicherheit und ihr Überleben zu gewährleisten. Diese Perspektive legt nahe, dass in einer Welt, in der jeder Staat für seine eigene Sicherheit verantwortlich ist und in der es keine übergeordnete Macht gibt, die Ordnung oder Recht durchsetzt, Konflikte unvermeidlich sind. Die Angst vor einem Angriff kann Staaten dazu veranlassen, sich durch Waffen zu schützen und manchmal sogar einen Krieg zu beginnen, um einen potenziellen Angriff zu verhindern. Mit anderen Worten: Die anarchische Natur des internationalen Systems als externer Faktor kann Staaten dazu veranlassen, sich zu bewaffnen und sich auf einen Krieg vorzubereiten, auch wenn dies zu einem Teufelskreis aus eskalierenden Spannungen und Konflikten führen kann.
Jede Analyseebene - individuell, intern und extern - bietet eine einzigartige Perspektive auf politische Phänomene und hat einen Anteil an der Wahrheit. Je nach der bevorzugten Analyseebene werden unterschiedliche Aspekte politischer Fragen in den Vordergrund gerückt, was sich auf die Ausrichtung der Forschung und die Gestaltung der Lösungsvorschläge auswirkt. Konzentriert man sich beispielsweise auf die individuelle Ebene, könnte die Aufmerksamkeit auf die Untersuchung der politischen Führer, ihrer Überzeugungen, Persönlichkeiten und Motivationen gerichtet werden. Die Lösungsvorschläge könnten dann die Ausbildung von Führungspersönlichkeiten oder die Förderung der positiven Psychologie umfassen. Wenn man sich hingegen auf die interne Ebene konzentriert, könnte sich die Forschung auf politische Strukturen, Regime und gesellschaftliche Faktoren konzentrieren. Die Lösungen könnten dann politische Reformen, demokratische Regierungsführung oder die Verbesserung der Bürgerbeteiligung betreffen. Wenn der Schwerpunkt auf der externen Ebene liegt, könnte die Forschung schließlich die Struktur des internationalen Systems, die Machtbeziehungen zwischen den Staaten und die Mechanismen von Krieg und Frieden untersuchen. Die Lösungen könnten dann Reformen des Völkerrechts, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit oder die Verbesserung der Konfliktlösungsmechanismen beinhalten.
Struktur-Agent: Interaktionen verstehen[modifier | modifier le wikicode]
In der Politikwissenschaft und im weiteren Sinne in den Sozialwissenschaften gibt es eine anhaltende Debatte zwischen zwei Hauptansätzen: dem Strukturalismus, der den Schwerpunkt auf soziale, politische und wirtschaftliche Strukturen legt, und dem Agentivismus, der die Handlungen und Entscheidungen von Individuen oder "Agenten" in den Vordergrund stellt. Strukturalistische Theorien argumentieren, dass Strukturen - seien sie wirtschaftlicher, politischer oder sozialer Art - bei der Bestimmung des Verhaltens von Individuen und Gruppen vorherrschend sind. Beispielsweise bestimmen nach der marxistischen Theorie wirtschaftliche Strukturen weitgehend die politischen und sozialen Beziehungen. Auf der anderen Seite gehen agentenorientierte Theorien davon aus, dass Individuen durch ihre Handlungen, Entscheidungen und Interaktionen die Macht haben, Strukturen zu formen und zu verändern. Ein Beispiel hierfür könnte die Theorie des rationalen Akteurs in der Wirtschaft sein, die davon ausgeht, dass Individuen nach ihren eigenen Interessen handeln und dass diese individuellen Handlungen die Märkte und die Wirtschaft formen.
Die meisten Theorien und Forscher erkennen die Bedeutung sowohl von Strukturen als auch von Agenten an, auch wenn sie sich möglicherweise darüber streiten, welche dieser beiden Dimensionen vorherrschend ist. In Wirklichkeit interagieren Strukturen und Agenten ständig miteinander und formen sich gegenseitig in einem Prozess, der von einigen Soziologen wie Anthony Giddens als "Dualität der Struktur" bezeichnet wird. Daher ist die Entscheidung, den Schwerpunkt auf Strukturen oder auf Agenten zu legen, nicht so sehr eine Frage der "richtigen" oder "falschen" Theorie, sondern vielmehr eine Frage der Perspektive und der theoretischen Priorität.
Die Debatte zwischen Individualismus (mit Betonung auf Agenten) und Strukturalismus (mit Betonung auf Strukturen) ist eine ontologische Debatte, d. h. sie betrifft die Natur des Seins und der Realität. Es handelt sich um zwei unterschiedliche philosophische Ansätze zum Verständnis der sozialen und politischen Welt. Der methodologische Individualismus beispielsweise geht davon aus, dass die Individuen und ihre Handlungen die grundlegenden Elemente jeder sozialen Analyse sind. Die sozialen Strukturen werden in dieser Perspektive als Produkt individueller Interaktionen und Entscheidungen gesehen. Umgekehrt vertritt der Strukturalismus die Ansicht, dass soziale Strukturen unabhängig von den Individuen existieren und einen entscheidenden Einfluss auf deren Verhalten haben. Strukturen werden in dieser Perspektive als reale Entitäten aufgefasst, die eine eigene Existenz haben und die Handlungen der Individuen einschränken oder erleichtern können. Die Präferenz für den Individualismus oder Strukturalismus kann nicht allein durch empirische Forschung ermittelt werden, da es sich um philosophische Postulate über die Natur der Realität handelt. Deshalb können Forscher auf die Philosophie zurückgreifen, um ihre ontologische Wahl zu rechtfertigen, und deshalb können verschiedene Forscher unterschiedliche Ansätze verfolgen, selbst wenn sie das gleiche Phänomen untersuchen.
Die marxistische Theorie und die Rational-Choice-Theorie sind zwei Beispiele für Metatheorien, die im Bereich der Politikwissenschaft verwendet werden. Die marxistische Theorie ist eine Metatheorie, die den Schwerpunkt auf die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen legt. Marx zufolge bestimmen die wirtschaftlichen Strukturen der Gesellschaft (Produktionsweise) weitgehend die sozialen und politischen Beziehungen (Überbau). Aus dieser Perspektive stehen Klassenkonflikte und wirtschaftliche Ungleichheiten im Mittelpunkt der politischen und sozialen Probleme. Andererseits ist die Rational-Choice-Theorie eine Metatheorie, die den Fokus auf das Individuum als Akteur legt. Diese Theorie geht davon aus, dass die Individuen rational sind und nach ihren eigenen Interessen handeln. Sie versuchen, ihren Nutzen zu maximieren, indem sie die Kosten und den Nutzen verschiedener Optionen abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Die Rational-Choice-Theorie wird bei der Untersuchung vieler Bereiche der Politikwissenschaft, wie Abstimmungen, Gesetzgebung, politische Koalitionen und internationale Beziehungen, häufig verwendet. Diese beiden Metatheorien bieten komplementäre Perspektiven auf politische Phänomene: Die eine legt den Schwerpunkt auf Strukturen, die andere auf Individuen. Die Kombination dieser beiden Perspektiven kann zu einem reichhaltigeren und differenzierteren Verständnis von Politik führen.
Die Debatte zwischen der Rolle von Strukturen und Agenten ist nicht auf unterschiedliche Paradigmen beschränkt, sondern kann auch innerhalb eines Paradigmas oder einer Denkschule stattfinden. Der Marxismus ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Nicos Poulantzas, ein strukturalistischer marxistischer Theoretiker, war der Ansicht, dass die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen das politische Verhalten und Handeln weitgehend bestimmen. Seiner Meinung nach führen die unausweichlichen Gesetze der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, zu Klassenkonflikten sowie zu sozialen und politischen Veränderungen. Andererseits betonten marxistische Denker wie Antonio Gramsci stärker die Rolle der Agenten, insbesondere der Intellektuellen und der Führer, bei der Umgestaltung der Gesellschaft. Für Gramsci erfordert die kommunistische Revolution einen "Stellungskrieg", in dem Intellektuelle und die Avantgarde eine entscheidende Rolle spielen, um die Massen für die kapitalistische Herrschaft zu sensibilisieren und eine kulturelle und ideologische Gegenhegemonie aufzubauen. Diese beiden Perspektiven spiegeln unterschiedliche Sichtweisen auf die Frage von Struktur und Agency innerhalb des marxistischen Paradigmas wider. Sie veranschaulichen die Vielfalt der möglichen theoretischen Ansätze, selbst innerhalb desselben Paradigmas, und den Reichtum, den diese Vielfalt für das Verständnis politischer Phänomene mit sich bringt.
Die Sozialwissenschaft und die Relevanz der Theorie[modifier | modifier le wikicode]
In der Sozialwissenschaft spielt die Theorie eine zentrale Rolle, aber sie ist nicht immer klar:
- Theorie als Abstraktion: Die Theorie ist ein Werkzeug, das uns hilft, die Welt auf abstraktere Weise zu verstehen. Im Gegensatz zu dem, was manche vielleicht denken, ist sie jedoch nicht nur Philosophen oder Intellektuellen vorbehalten. Jeder von uns verwendet ständig Theorien, um die Welt um uns herum zu interpretieren und zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel glauben, dass Belohnungen die Menschen dazu motivieren, härter zu arbeiten, wenden wir in Wirklichkeit eine vereinfachte Version der Anreiztheorie an. Theorien sind lediglich Denkrahmen, die uns dabei helfen, unsere Beobachtungen und Gedanken über die Welt zu strukturieren.
- Theorie als realitätsfremd: Es ist auch üblich zu glauben, dass Theorien realitätsfremd oder subjektiv sind. Eine gute Theorie in den Sozialwissenschaften basiert jedoch auf empirischer Beobachtung und wird ständig gegen diese getestet. Die Theorie kann mit abstrakten Ideen beginnen, aber diese Ideen werden dann mit spezifischen Hypothesen verknüpft, die durch Beobachtung oder Experimente getestet werden können. Eine gute Theorie ist also keineswegs von der Realität abgekoppelt, sondern steht ständig im Dialog mit ihr.
Der induktive und der deduktive Ansatz sind zwei zentrale Methoden des wissenschaftlichen Denkens, auch in den Sozialwissenschaften, und beschreiben, wie Fakten und Theorien interagieren.
- Induktiver Ansatz: Die induktive Methode geht von spezifischen Beobachtungen aus, um zu Verallgemeinerungen oder umfassenderen Theorien zu gelangen. Beispielsweise könnte ein Forscher mit ausführlichen Interviews mit Obdachlosen beginnen und diese Interviews dann nutzen, um eine allgemeinere Theorie über die Ursachen der Obdachlosigkeit zu entwickeln. Dieser Ansatz wird häufig in der qualitativen Forschung verwendet.
- Deduktiver Ansatz: Die deduktive Methode hingegen beginnt mit einer allgemeinen Theorie oder Hypothese und versucht dann, spezifische Beobachtungen zu finden, die diese stützen. Beispielsweise könnte ein Wirtschaftswissenschaftler mit der Hypothese beginnen, dass eine Erhöhung des Mindestlohns zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen wird, und dann nach Daten suchen, um diese Hypothese zu testen. Dieser Ansatz wird häufig in der quantitativen Forschung verwendet.
In der Praxis verwenden viele Forscher in ihrer Arbeit eine Kombination aus induktiven und deduktiven Ansätzen. Sie können mit einer allgemeinen Theorie beginnen (deduktiver Ansatz) und dann Beobachtungen verwenden, um diese Theorie zu verfeinern oder zu verändern (induktiver Ansatz). Oder sie können mit spezifischen Beobachtungen beginnen (induktiver Ansatz) und diese Beobachtungen dann nutzen, um eine neue Theorie oder Hypothese zu entwickeln, die sie dann mit weiteren Daten testen (deduktiver Ansatz). Die Komplementarität dieser beiden Ansätze hilft, die sozialwissenschaftliche Forschung zu bereichern und zu stärken, indem sie für einen ständigen Dialog zwischen Theorie und Beobachtungen sorgt.
Im Kontext der Sozialwissenschaften ist eine Theorie eine systematische Erklärung für beobachtete Phänomene. Sie bietet einen Rahmen für das Verständnis und die Interpretation der Realität, indem sie verschiedene Fakten und Beobachtungen miteinander verknüpft, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen, Motive, Verhaltensweisen und Trends in der Gesellschaft zu erklären. Eine Theorie ist nicht einfach nur eine Hypothese oder Vermutung. Sie basiert auf einer Reihe von klar definierten und überprüfbaren Annahmen und wird durch empirische Beweise gestützt. Darüber hinaus sollte eine gute Theorie in der Lage sein, genaue Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse zu machen. Oft gibt es mehrere verschiedene Theorien, die ein und dasselbe soziale Phänomen erklären können. Beispielsweise kann in der Soziologie wirtschaftliche Ungleichheit durch marxistische Theorien (die sich auf Klassenstrukturen und Kapitalismus konzentrieren), Theorien des sozialen Austauschs (die sich auf individuelle Interaktionen und Transaktionen konzentrieren) oder institutionelle Theorien (die sich auf Gesetze, Politik und soziale Strukturen konzentrieren) erklärt werden. Doch trotz ihrer Unterschiede haben alle diese Theorien das gleiche grundlegende Ziel: Sie helfen zu erklären, wie die soziale Realität funktioniert.
Eine gute sozialwissenschaftliche Theorie hat das Ziel, die Faktoren und Prozesse zu identifizieren, die einen Teil der sozialen Realität strukturieren. Sie dient dazu, zu erklären, wie und warum die Dinge geschehen, und zu antizipieren, wie die Dinge unter verschiedenen Bedingungen verlaufen könnten. Hier einige wichtige Punkte zu einer guten Theorie :
- Identifiziert wichtige Faktoren: Eine Theorie sollte die Variablen oder Faktoren, die für das zu untersuchende Phänomen oder die Forschungsfrage wichtig sind, klar benennen. Zu diesen Faktoren können individuelle Merkmale, Verhaltensweisen, soziale Prozesse, Institutionen, soziale Strukturen und vieles mehr gehören.
- Erklärt die Beziehungen zwischen diesen Faktoren: Eine Theorie sollte auch erklären, wie diese Faktoren miteinander verbunden sind. Sie könnte zum Beispiel erklären, wie sich Veränderungen in einer Variablen (z. B. Bildungsniveau) auf eine andere Variable (z. B. Einkommen) auswirken.
- Schlägt Gesetze oder allgemeine Prinzipien vor: Eine Theorie sollte allgemeine Prinzipien oder "Gesetze" vorschlagen, die das Verhalten der untersuchten Faktoren erklären. Beispielsweise könnte eine Wirtschaftstheorie ein Gesetz vorschlagen, wonach bei sonst gleichen Bedingungen eine höhere Nachfrage nach einem Produkt zu einem höheren Preis führt.
- Ist überprüfbar: Eine Theorie sollte so formuliert sein, dass sie durch Beobachtung und Erfahrung getestet werden kann. Das bedeutet, dass sie spezifische Vorhersagen machen sollte, die durch Daten bestätigt oder widerlegt werden können.
- Ist auf eine Vielzahl von Kontexten anwendbar : Eine gute Theorie sollte allgemein genug sein, um auf eine Vielzahl von Kontexten und Situationen anwendbar zu sein, auch wenn einige Theorien möglicherweise spezifisch für bestimmte kulturelle oder historische Kontexte sind.
In Doing Comparative Politics: An Introduction to Approaches and Issues beleuchtet Lim die Funktion einer Theorie als Mittel zur Filterung und Organisation unseres Verständnisses der Realität.[1] Il définit la théorie comme une représentation simplifiée de la réalité, c'est un prisme à travers lequel les faits sont sélectionnés, interprétés, organisés et reliés entre eux de manière à former un ensemble cohérent. Les points clés de cette définition sont :
- Simplification de la réalité : la réalité est incroyablement complexe. Une théorie fournit une représentation simplifiée qui facilite la compréhension de certains phénomènes. Elle permet de focaliser l'attention sur les aspects de la réalité les plus pertinents pour une question de recherche donnée.
- Prisme : une théorie agit comme un prisme et aide à sélectionner et à mettre en évidence certains faits, tout en laissant d'autres faits dans l'ombre. Cette sélection est cruciale, car il est impossible de considérer tous les faits à la fois.
- Interprétation et organisation : une théorie fournit un cadre permettant d'interpréter et d'organiser les faits. Elle aide à donner un sens aux observations et à les regrouper de manière pertinente.
- Cohérence : une bonne théorie présente un ensemble cohérent de faits et d'arguments. Elle relie différents éléments de manière logique et systématique.
Les théories jouent un rôle crucial dans la structuration de notre compréhension de la réalité. Elles aident à organiser et à relier les faits, à identifier les relations de cause à effet et à mettre en lumière des structures et des processus sous-jacents qui peuvent ne pas être immédiatement évidents. En sociologie, par exemple, la théorie des conflits aide à organiser les faits autour de l'idée que la société est structurée par des conflits de classe et d'autres formes de lutte pour le pouvoir. Elle relie différents faits - comme les inégalités économiques, la discrimination raciale et le sexisme - à une analyse plus globale de la manière dont le pouvoir est distribué et disputé dans la société. De la même manière, en économie, la théorie de l'offre et de la demande aide à organiser les faits en suggérant que les prix sont déterminés par l'interaction entre ce que les gens sont prêts à payer pour un bien ou un service (la demande) et la quantité de ce bien ou service disponible (l'offre). Ces théories ne réduisent pas seulement la complexité de la réalité en fournissant des simplifications utiles, elles aident également à ordonner la réalité en structurant notre compréhension des faits. Elles fournissent un cadre cohérent pour l'interprétation et l'explication des phénomènes que nous observons, ce qui permet aux chercheurs de formuler des hypothèses, de mener des enquêtes et de développer une compréhension plus approfondie de la réalité sociale.
Une théorie, dans son essence, est une argumentation cohérente qui repose sur une logique interne solide. Elle décrit et explique les mécanismes qui sous-tendent une relation causale et fournit un cadre qui lie les concepts, les variables et les faits d'une manière qui donne du sens. En sciences sociales, une théorie bien construite doit identifier les relations entre les concepts ou les variables, préciser la nature de ces relations (par exemple, si une augmentation d'une variable entraîne une augmentation ou une diminution d'une autre), et expliquer pourquoi ces relations existent. La théorie doit également être suffisamment précise pour permettre de faire des prédictions qui peuvent être testées empiriquement. Par exemple, dans la théorie du capital humain en économie, l'éducation est considérée comme un investissement qui augmente la productivité et le potentiel de gains d'un individu. Cette théorie suggère une relation causale : une augmentation de l'éducation entraîne une augmentation des revenus. Les mécanismes qui soutiennent cette relation incluent l'acquisition de compétences et de connaissances qui augmentent la productivité de l'individu. Cependant, une théorie n'est pas seulement une description de la réalité, c'est aussi un outil pour changer cette réalité. En identifiant les mécanismes qui sous-tendent les relations causales, une théorie peut aider à identifier les leviers d'action possibles pour influencer les résultats. Par exemple, si l'on accepte la théorie du capital humain, alors une politique possible pour augmenter les revenus serait d'investir dans l'éducation.
Man kann an zwei Analogien denken, um den Begriff der Theorie zu erfassen:
- Die Theorie als Brille : Diese Analogie verdeutlicht, wie eine Theorie uns dabei hilft, die Informationen, die wir wahrnehmen, zu filtern und zu interpretieren. So wie eine Brille dabei helfen kann, unsere Sicht zu verbessern, indem sie bestimmte Dinge fokussiert oder bestimmte Wellenlängen des Lichts herausfiltert, hilft eine Theorie dabei, bestimmte Aspekte der sozialen Realität hervorzuheben und andere zu minimieren. Jede Theorie bietet eine einzigartige Perspektive, die es uns ermöglicht, bestimmte Aspekte der Realität klarer zu sehen, während andere Aspekte potenziell ausgeblendet werden.
- Theorie als Karte: So wie eine Karte eine vereinfachte Darstellung der geografischen Realität ist, die bestimmte Details (wie Straßen, Grenzen oder Erhebungen) hervorhebt, während sie andere auslässt, ist eine Theorie eine vereinfachte Darstellung der sozialen Realität, die bestimmte Aspekte der Realität hervorhebt. Karten können sich je nach den Informationen, die man hervorheben möchte, unterscheiden, ebenso können sich Theorien je nach den Aspekten der sozialen Realität, die man betonen möchte, unterscheiden.
So wie es sinnvoll ist, verschiedene Arten von Karten zu haben (z. B. eine Straßenkarte, eine topografische Karte, eine politische Karte), so ist es auch sinnvoll, verschiedene Theorien zu haben, um die Komplexität der sozialen Realität vollständig zu verstehen. Jede Theorie bietet eine einzigartige Beleuchtung, und diese Beleuchtungen können sich oft ergänzen, um ein vollständigeres und differenzierteres Bild zu ergeben.
Die Unterscheidung zwischen den Perspektiven von Karl Marx und Max Weber veranschaulicht zwei grundlegende Herangehensweisen an die Theorie in den Sozialwissenschaften.
- Karl Marx' Ansatz: Marx betrachtete die Theorie nicht nur als Mittel zum Verständnis der gesellschaftlichen Realität, sondern auch als Werkzeug zu deren Veränderung. Seiner Ansicht nach bestand der Zweck der Theorie darin, die Macht- und Ausbeutungsstrukturen in der Gesellschaft (insbesondere im Kontext des Kapitalismus) zu identifizieren und eine Grundlage für politisches und soziales Handeln zu schaffen, um eine gerechtere Gesellschaft zu errichten. Seine berühmte Aussage "Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert, jetzt geht es darum, sie zu verändern", verdeutlicht diese Überzeugung, dass die Theorie praktisch angewandt werden muss, um die menschliche Situation zu verbessern.
- Max Webers Ansatz: Auf der anderen Seite sah Weber die Theorie eher als ein Werkzeug zum objektiven Verständnis der sozialen Realität. Für ihn bestand das Ziel der Theorie darin, die soziale Realität so genau und neutral wie möglich zu beschreiben und zu erklären, ohne sie notwendigerweise verändern zu wollen. Dieser Ansatz wird oft mit der Idee der "Wertneutralität" in den Sozialwissenschaften in Verbindung gebracht, die besagt, dass Forscher sich bemühen sollten, objektiv zu bleiben und ihre Forschung nicht von ihren eigenen Werten oder Ideologien beeinflussen zu lassen.
Diese beiden Ansätze schließen sich nicht unbedingt gegenseitig aus. Viele Sozialwissenschaftler halten es für wichtig, die soziale Realität objektiv zu verstehen (im Sinne von Weber), erkennen aber auch an, dass dieses Verständnis genutzt werden kann und sollte, um soziales und politisches Handeln zu informieren (im Sinne von Marx). Letztendlich hängt die Art und Weise, wie ein Forscher die Rolle der Theorie betrachtet, von seinen eigenen philosophischen und ethischen Perspektiven ab.
Karl Marx' Perspektive auf die Theorie betont deren Potenzial, als Hebel für sozialen und politischen Wandel zu fungieren. Für Marx ist die Theorie nicht nur ein Werkzeug, um die Welt zu verstehen, sondern ein Mittel, um sie aktiv zu verändern. In dieser Sichtweise ist die Theorie keine rein akademische oder intellektuelle Tätigkeit, sondern sie hat eine direkte Relevanz und Nützlichkeit für die reale Welt. In Marx' Werk ist diese Idee eng mit seiner Theorie des Klassenkampfes verbunden. Laut Marx kann die Theorie dabei helfen, die Macht- und Ausbeutungsstrukturen in der Gesellschaft zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den Klassen im kapitalistischen System. Indem er den Arbeiterklassen ihre Ausbeutung bewusst machte, glaubte Marx, dass die Theorie als Werkzeug dienen könnte, um zur Revolution und zur Errichtung einer kommunistischen Gesellschaft anzuspornen. Abgesehen davon ist es wichtig zu beachten, dass, obwohl Marx' Ansatz die aktive Rolle der Theorie bei der sozialen Veränderung betont, diese Perspektive nicht unbedingt von allen Sozialwissenschaftlern geteilt wird. Manche sehen die Theorie vielleicht eher als ein Werkzeug, um die Welt zu verstehen, und nicht, um sie zu verändern. Dennoch zeigt Marx' Perspektive eine der Möglichkeiten auf, wie Theorie als direkt relevant und nützlich für die Gesellschaft angesehen werden kann.
Robert Cox, ein bedeutender Theoretiker der internationalen Beziehungen, hat diese Perspektive in seinem Werk Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory gut artikuliert.[2]. Seiner Meinung nach hat jede Theorie eine Perspektive - sie ist "immer für jemanden und für bestimmte Ziele". Diese Aussage beruht auf der Vorstellung, dass eine Theorie nie völlig neutral oder objektiv ist, da sie immer von den Werten, Überzeugungen und Zielen der Menschen beeinflusst wird, die sie entwickeln und anwenden. Cox unterschied zwischen den von ihm so genannten "Problemlösungs"-Theorien und den "kritischen" Theorien. Problemlösungstheorien akzeptieren die Welt, wie sie ist, und versuchen, bestehende Systeme und Strukturen effizienter zu gestalten. Sie befürworten in der Regel den Status quo und die bestehende Ordnung. Andererseits stellen kritische Theorien die bestehende Ordnung in Frage und versuchen zu verstehen, wie und warum sie geschaffen wurde. Sie zielen darauf ab, die Kräfte und Machtstrukturen, die der sozialen Realität zugrunde liegen, offenzulegen und oftmals Wege zur Veränderung dieser Strukturen zu erwägen. Dies unterstreicht noch einmal, dass Theorien nicht einfach neutrale Beschreibungen der Realität sind. Sie werden von den Perspektiven und Zielen der Theoretiker beeinflusst, und diese können wiederum unser Verständnis der Realität und unser Handeln in der Welt beeinflussen.
Max Weber, einer der Begründer der modernen Soziologie, setzte sich stark für die Idee der Axiologischen Neutralität ein, d. h. die Trennung von Fakten und Werten in der wissenschaftlichen Forschung. Während Werte die Auswahl von Forschungsthemen leiten können, sollten Forscher laut Weber bei der Analyse und Interpretation von Daten versuchen, so objektiv und unparteiisch wie möglich zu sein. Weber argumentierte, dass die sozialwissenschaftliche Forschung zwar die möglichen Folgen verschiedener Handlungen oder Politiken beleuchten kann, sie uns aber nicht sagen kann, welche Handlung oder Politik wir wählen sollten. Das liegt daran, dass die Wahl zwischen verschiedenen Werten oder Zwecken letztlich eine Frage des persönlichen oder moralischen Urteils ist und keine wissenschaftliche Tatsache. Praktisch ausgedrückt bedeutet dies, dass Wissenschaftler die Fakten so darstellen sollten, wie sie sind, ohne sie nach ihren eigenen Maßstäben von gut und böse, richtig und falsch, besser oder schlechter zu beurteilen. Beispielsweise sollte ein Soziologe, der eine bestimmte kulturelle Praxis untersucht, versuchen, diese so objektiv wie möglich zu beschreiben und zu erklären, ohne seine persönliche Zustimmung oder Missbilligung zum Ausdruck zu bringen. Axiologische Neutralität bedeutet nicht, dass Forscher keine persönlichen Wertvorstellungen haben dürfen oder Forschungsthemen mit ethischen oder politischen Implikationen meiden sollten. Vielmehr bedeutet es, dass sie bei der Durchführung ihrer Forschung bestrebt sein sollten, ihre Analysen und Schlussfolgerungen von ihren eigenen Werturteilen zu trennen.
Webers Perspektive der Axiologie-Neutralität war sehr einflussreich und ist weiterhin ein wichtiger Standard in vielen Bereichen der Sozialwissenschaften. Allerdings ist sie auch kritisiert worden. Einige legen nahe, dass es für Forscher unmöglich ist, völlig zu vermeiden, dass ihre Werte ihre Arbeit beeinflussen. Andere argumentieren, dass es das Ziel sozialwissenschaftlicher Forschung sein sollte, die Welt nicht nur zu verstehen, sondern sie auch zu verändern - eine Position, die der Idee der axiologischen Neutralität entgegensteht. Dies ist eine Debatte, die in den Sozialwissenschaften heute noch andauert, und verschiedene Perspektiven können je nach Forschungsthema und verwendeter Methodik mehr oder weniger relevant sein.
Max Weber hat in seinem Essay "Politik als Beruf" seine Sicht der Axiologie-Neutralität entwickelt. Dieser 1919 verfasste Aufsatz wird oft als klassische Definition der Axiologie-Neutralität in den Sozialwissenschaften angesehen. In "Politik als Berufung" argumentierte Weber, dass die Wissenschaft (einschließlich der Sozialwissenschaften) zwar helfen kann, die Mittel zu klären, mit denen ein bestimmtes politisches Ziel erreicht werden kann, dass sie aber nicht bestimmen kann, welcher Zweck oder welches Ziel verfolgt werden sollte. Seiner Meinung nach fiel dies in den Bereich der Politik und des persönlichen Urteils und nicht in den der Wissenschaft. Die axiologische Neutralität ist aus Webers Perspektive ein Versuch, eine Trennung zwischen diesen Sphären aufrechtzuerhalten - um zu verhindern, dass die Wissenschaft zu sehr politisiert oder die Politik zu sehr verwissenschaftlicht wird. Es handelt sich um ein Ideal, nach dem Forscher versuchen, die Realität so objektiv und unparteiisch wie möglich darzustellen, ohne ihre Arbeit von eigenen Werten oder politischen Urteilen beeinflussen zu lassen.
Der folgende Auszug stammt aus einer Reihe von Vorlesungen, die 1919 an der Universität München gehalten wurden. Weber entwickelt eine Reflexion über das Wesen der wissenschaftlichen Arbeit: "Verweilen wir nun einen Augenblick bei den Disziplinen, die mir vertraut sind, nämlich bei der Soziologie, der Geschichte, der Volkswirtschaftslehre, der Politikwissenschaft und allen Arten der Kulturphilosophie, die die Interpretation der verschiedenen Arten des vorangegangenen Wissens zum Gegenstand haben. Es wird gesagt, und ich stimme dem zu, dass die Politik nicht in den Hörsaal einer Universität gehört. Sie hat dort keinen Platz, vor allem nicht auf der Seite der Studenten. Ich bedauere beispielsweise die Tatsache, dass sich im Hörsaal meines ehemaligen Kollegen Dietrich Schäfer in Berlin einmal eine Reihe pazifistischer Studenten um seinen Lehrstuhl herum versammelten und Lärm machten, ebenso wie das Verhalten der antipazifistischen Studenten, die anscheinend eine Demonstration gegen Professor Foerster organisierten, von dem ich jedoch aufgrund meiner eigenen Auffassungen aus vielen Gründen so weit entfernt bin wie nur möglich. Aber auch auf der Seite der Lehrer hat die Politik keinen Platz. Und schon gar nicht, wenn sie sich wissenschaftlich mit politischen Problemen auseinandersetzen. Weniger denn je hat sie dann dort ihren Platz. Denn es ist eine Sache, eine praktische politische Position zu beziehen, eine andere, politische Strukturen und Parteidoktrinen wissenschaftlich zu analysieren. Wenn in einer öffentlichen Versammlung über Demokratie gesprochen wird, wird aus der persönlichen Position, die man einnimmt, kein Geheimnis gemacht, und selbst die Notwendigkeit, klar Partei zu ergreifen, wird als eine verfluchte Pflicht angesehen. Die Worte, die man dabei verwendet, sind nicht mehr Mittel der wissenschaftlichen Analyse, sondern ein politischer Appell, um andere zu einer Stellungnahme aufzufordern. Sie sind nicht mehr Pflugscharen, um das riesige Feld des kontemplativen Denkens zu lockern, sondern Schwerter, um Gegner anzugreifen, kurzum Kampfmittel. Es wäre eine Gemeinheit, die Worte in einem Klassenzimmer so zu verwenden. Wenn man in einem akademischen Vortrag zum Beispiel die "Demokratie" untersuchen will, untersucht man ihre verschiedenen Formen, analysiert, wie sie funktionieren und welche Konsequenzen sie für das Leben haben; dann stellt man ihnen die nicht-demokratischen Formen der politischen Ordnung gegenüber und versucht, die Analyse so weit zu treiben, bis der Zuhörer selbst in der Lage ist, den Punkt zu finden, von dem aus er gemäß seinen eigenen grundlegenden Idealen Stellung beziehen kann. Ein echter Lehrer wird sich jedoch davor hüten, seinem Publikum von der Kanzel aus irgendeine Position aufzuzwingen, sei es offen oder durch Suggestion - denn die unlauterste Art ist natürlich, die Fakten sprechen zu lassen. Aus welchen Gründen sollten wir dies im Grunde genommen unterlassen? Ich nehme an, dass einige meiner Kollegen der Meinung sind, dass es im Allgemeinen unmöglich ist, diese persönliche Zurückhaltung in die Praxis umzusetzen, und dass es, selbst wenn es möglich wäre, eine Marotte wäre, solche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Dame! Man kann niemandem wissenschaftlich nachweisen, worin seine Pflicht als Universitätsprofessor besteht. Man kann von ihm nur intellektuelle Redlichkeit verlangen, d. h. die Verpflichtung, anzuerkennen, dass die Feststellung von Tatsachen, die Bestimmung mathematischer und logischer Realitäten oder die Feststellung der inneren Strukturen kultureller Werte einerseits und die Beantwortung von Fragen nach dem Wert der Kultur und ihrer besonderen Inhalte oder nach der Art und Weise, wie man in der Stadt und in politischen Gruppierungen handeln sollte, andererseits zwei völlig heterogene Arten von Problemen darstellen. Wenn man mich nun fragen würde, warum diese letzte Reihe von Fragen aus einem Hörsaal ausgeschlossen werden muss, würde ich antworten, dass der Prophet und der Demagoge keinen Platz auf einem Universitätslehrstuhl haben [...] Ich bin bereit, Ihnen anhand der Werke der Historiker den Beweis zu liefern, dass jedes Mal, wenn ein Mann der Wissenschaft sein eigenes Werturteil einfließen lässt, kein vollständiges Verständnis der Tatsachen mehr vorhanden ist".
Dieser Auszug beleuchtet Max Webers Perspektive auf die Unterscheidung zwischen Werturteil und Tatsachenurteil sowie die Idee der axiologischen Neutralität. Für Weber sollte der universitäre Hörsaal (und im weiteren Sinne auch der Bereich der akademischen Forschung) frei von Politik sein, in dem Sinne, dass weder Studenten noch Lehrkräfte ihre persönlichen politischen Überzeugungen ihre Herangehensweise an das Studium beeinflussen lassen sollten. Er ist besonders kritisch gegenüber Lehrern, die versuchen würden, ihren Schülern ihre eigenen Standpunkte aufzuzwingen, sei es auf offene oder subtile Weise. Weber hebt die Unterscheidung zwischen dem "Einnehmen einer praktischen politischen Position" und der "wissenschaftlichen Analyse politischer Strukturen und Parteidoktrinen" hervor. Während ersteres persönliches Engagement und den Einsatz von Sprache als "Kampfmittel" voraussetzt, beinhaltet letzteres eine objektive und uneigennützige Analyse, die darauf abzielt, dass die Schüler die Fakten so verstehen, dass sie ihre eigenen Urteile formulieren können. Das ist es, was Weber unter axiologischer Neutralität versteht: die Notwendigkeit für den Forscher, sich aus der Politik herauszuhalten, indem er darauf achtet, das Tatsachenurteil sorgfältig vom Werturteil zu trennen. Dies ist eine Sichtweise, die einen großen Einfluss auf die Sozialwissenschaften hatte, obwohl sie auch Gegenstand von Kritik und Debatten war.
Weber argumentierte, dass Forscher sich um Objektivität bemühen sollten, indem sie ihre eigenen Werturteile von ihrer Analyse der Fakten trennen. Dies ist der Grundsatz der "axiologischen Neutralität". Dies bedeutet jedoch nicht, dass normative Fragen - d. h. Fragen danach, was sein sollte, anstatt danach, was ist - in der Politikwissenschaft keinen Platz haben. Es gibt viele Bereiche der Politikwissenschaft, die sich mit normativen Fragen beschäftigen, wie z. B. die politische Theorie, die politische Ethik und bestimmte Aspekte der öffentlichen Politik und Verwaltung. Die "Rational-Choice-Revolution" hat zu einem stärker formalisierten und quantitativen Ansatz in der politischen Analyse geführt, der auf der Annahme beruht, dass Individuen so handeln, dass sie ihren persönlichen Nutzen maximieren. Doch obwohl dieser Ansatz wertvolle Einblicke in das menschliche Verhalten bieten kann, wurde er auch dafür kritisiert, dass er dazu neigt, andere wichtige Faktoren wie soziale Normen, kulturelle Werte und die Komplexität und Ungewissheit, die vielen politischen Situationen innewohnen, zu vernachlässigen. Letztendlich ist das Gleichgewicht zwischen der objektiven Analyse von Fakten und der Beschäftigung mit normativen Fragen ein ständiges Diskussionsthema in der Politikwissenschaft, und verschiedene Ansätze können in unterschiedlichen Kontexten angemessen sein.
Die normative politische Theorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie zu bewerten versucht, wie die Dinge sein sollten, anstatt zu beschreiben, wie sie sind. Dieses Studienfeld befasst sich mit Fragen der Ethik und der moralischen und politischen Philosophie und fragt beispielsweise, was eine Regierung gerecht oder ungerecht macht oder was eine gute oder schlechte Gesellschaft ausmacht. Im Zusammenhang mit der parlamentarischen Demokratie könnte eine normative Studie den Eigenwert der parlamentarischen Demokratie als Regierungssystem bewerten. Dies könnte die Untersuchung der der parlamentarischen Demokratie zugrunde liegenden philosophischen Prinzipien wie Gleichheit, Meinungsfreiheit und das Recht auf Teilnahme an der politischen Führung sowie weiter gefasste Fragen der politischen Ethik beinhalten. Die normative politische Theorie erhebt nicht den Anspruch auf die gleiche Objektivität wie andere Bereiche der Politikwissenschaft. Stattdessen beinhaltet sie häufig die Artikulation und Verteidigung spezifischer ethischer Positionen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es dieser Arbeit an intellektueller Strenge mangelt. Ganz im Gegenteil: Normative politische Theorie beinhaltet häufig rigorose und detaillierte Argumentationen, die sich auf etablierte philosophische Prinzipien stützen.
In der Sozialwissenschaft basiert die empirische Analyse oft auf normativen Postulaten, das sind die grundlegenden Überzeugungen oder Annahmen über die Welt, die einem bestimmten Forschungsansatz zugrunde liegen. Diese Postulate können sich auf die Natur der sozialen Realität beziehen, auf die Arten von Wissen, die möglich oder gültig sind, oder auf die geeigneten Methoden, um dieses Wissen zu erlangen. Bei der empirischen Analyse besteht das Hauptziel jedoch darin, diese Postulate durch Beobachtung und Erfahrung zu testen und zu bewerten. Das bedeutet, dass normative Postulate zwar die Art und Weise beeinflussen können, wie ein Forscher an eine bestimmte Forschungsfrage herangeht, die empirische Analyse sich jedoch hauptsächlich auf die systematische und objektive Prüfung der verfügbaren Daten konzentriert. In diesem Prozess werden Theorien oder Hypothesen im Lichte der empirischen Beweise ständig überprüft und verfeinert, in dem Bemühen, ein genaueres und umfassenderes Verständnis der sozialen Realität zu erlangen. Daher können normative Erwägungen zwar eine Rolle bei der Ausrichtung der sozialwissenschaftlichen Forschung spielen, sie stehen aber in der Regel nicht im Vordergrund der empirischen Analyse. Deren Ziel ist es, ein evidenzbasiertes Verständnis davon zu vermitteln, wie die Welt tatsächlich funktioniert, und nicht vorzuschreiben, wie sie funktionieren sollte.
Der erklärende Ansatz ist in vielen sozialwissenschaftlichen Disziplinen vorherrschend. Dieser Ansatz zielt darauf ab, zu erklären, warum soziale Phänomene auftreten, in der Regel durch die Identifizierung der Ursachen oder Mechanismen, die sie hervorbringen. Ziel ist es, Wissen zu generieren, das es ermöglicht, diese Phänomene vorherzusagen und möglicherweise zu kontrollieren. Forscher, die diesen Ansatz verfolgen, verwenden häufig quantitative Methoden wie Statistiken und ökonometrische Modelle, obwohl auch qualitative Methoden eingesetzt werden können. Der phänomenologische Ansatz hingegen konzentriert sich auf das Verständnis der subjektiven Erfahrungen von Individuen. Er versucht zu beschreiben und zu interpretieren, wie Menschen ihre Welt wahrnehmen, erleben und ihr einen Sinn verleihen. Forscher, die diesen Ansatz verfolgen, verwenden in der Regel qualitative Methoden wie Tiefeninterviews, teilnehmende Beobachtung und Diskursanalyse. Diese beiden Ansätze ergänzen sich und können in einer Studie oft gemeinsam verwendet werden. Beispielsweise kann ein Forscher einen erklärenden Ansatz verwenden, um die Faktoren zu identifizieren, die ein bestimmtes soziales Phänomen beeinflussen, und dann einen phänomenologischen Ansatz verwenden, um zu verstehen, wie diese Faktoren von den betroffenen Individuen erlebt und interpretiert werden.
Max Weber sagt über die Abgrenzung des Feldes der Politikwissenschaft und ihres Gegenstandes: "Nicht die Beziehungen zwischen den "Dingen" bilden das Prinzip der Abgrenzung der verschiedenen Wissenschaftsgebiete, sondern die begrifflichen Beziehungen zwischen Problemen"[3]. Das Zitat von Max Weber unterstreicht die Bedeutung der konzeptuellen Beziehungen zwischen Problemen bei der Definition von Forschungsbereichen in den Sozialwissenschaften. Aus dieser Perspektive werden Disziplinen nicht durch separate Studienobjekte (oder "Dinge") definiert, sondern vielmehr durch die spezifischen Fragen, die sie zu beantworten versuchen, und die konzeptuellen Rahmen, die sie verwenden, um diese Fragen anzugehen. Beispielsweise können sich Wirtschaft, Soziologie und Politikwissenschaft alle mit demselben Phänomen befassen - sagen wir, mit wirtschaftlicher Ungleichheit -, aber sie werden unterschiedliche Fragen dazu stellen und es mit unterschiedlichen konzeptuellen Rahmen angehen. Webers Sichtweise veranlasst uns zu der Erkenntnis, dass die Sozialwissenschaften weniger durch ihre "Studienobjekte" als vielmehr durch die Probleme und Fragen, die sie aufwerfen, definiert werden. In dieser Sichtweise gibt es keine strikte Abgrenzung zwischen den verschiedenen Sozialwissenschaften, sondern vielmehr eine Vielzahl von sich überschneidenden und ergänzenden Perspektiven. Aus diesem Grund kann ein und dasselbe Phänomen von verschiedenen Disziplinen aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht werden. Beispielsweise könnten sich ein Soziologe, ein Wirtschaftswissenschaftler und ein Politikwissenschaftler alle mit dem Thema Armut befassen, doch würden sie unterschiedliche Fragen stellen und unterschiedliche Methoden anwenden, um diese zu beantworten. Diese Perspektive fördert die interdisziplinäre Forschung und die Zusammenarbeit von Forschern aus verschiedenen Disziplinen, um komplexe Probleme aus mehreren verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
Konzepte spielen in der Politikwissenschaft (und den Sozialwissenschaften im Allgemeinen) eine zentrale Rolle, da sie dabei helfen, Forschungsprobleme zu definieren und Erklärungen für soziale und politische Phänomene zu strukturieren. Konzepte sind die grundlegenden Werkzeuge, die Forscher verwenden, um über die politische Welt nachzudenken, Forschungsfragen zu formulieren und Theorien zu konstruieren. Konzepte in den Sozial- und Politikwissenschaften sind oft Abstraktionen von komplexeren Realitäten. Beispielsweise stellen Begriffe wie "Demokratie", "Staat", "Ideologie", "Macht" oder "soziale Klasse" allesamt Aspekte der sozialen und politischen Realität dar, die zu komplex sind, um direkt erfasst zu werden. Diese Konzepte bieten eine Möglichkeit, diese Komplexität zu vereinfachen, indem sie sich auf bestimmte spezifische Merkmale oder Dimensionen der Phänomene konzentrieren, die sie repräsentieren. Durch die Verknüpfung dieser Konzepte können Theorien aufgestellt werden, die wiederum dazu beitragen, die soziale und politische Welt besser zu verstehen und zu erklären. In der Politikwissenschaft könnten wir beispielsweise das Konzept "Demokratie" verwenden, um Fragen darüber zu stellen, wie sich verschiedene Arten von politischen Regimen (ein weiterer begrifflicher Begriff) auf politische und wirtschaftliche Ergebnisse auswirken. Wir könnten das Konzept der "Macht" verwenden, um zu erforschen, wie verschiedene soziale und politische Akteure in der Lage sind, Entscheidungsprozesse und öffentliche Politik zu beeinflussen. Oder wir könnten das Konzept der "sozialen Klasse" verwenden, um zu verstehen, wie sich sozioökonomische Ungleichheiten auf die politische Beteiligung und die Präferenzen für die öffentliche Politik auswirken. Diese Konzepte sind nicht starr; sie entwickeln sich mit den theoretischen und methodologischen Entwicklungen in diesem Bereich sowie mit den Veränderungen in der politischen Welt selbst. Wissenschaftler diskutieren oft darüber, wie diese Konzepte am besten definiert und gemessen werden können, und diese Debatten sind ein wichtiger Teil der Entwicklung des Fachs. So sind Konzepte in der Politikwissenschaft sowohl Forschungsinstrumente als auch Themen der akademischen Debatte. Sie sind unverzichtbar, um unser Denken und unser Verständnis der politischen Welt zu strukturieren und um Forschung zu betreiben, die neues Wissen über diese Welt hervorbringt.
Das klassische Modell in der Politikwissenschaft[modifier | modifier le wikicode]
Konzeptualisierung: Den Kern von Konzepten definieren[modifier | modifier le wikicode]
Die Konzeptualisierung in der Politikwissenschaft ist ein entscheidender Schritt in jeder Analyse oder Studie. Sie beinhaltet die Definition, Klärung und Erklärung der Schlüsselkonzepte, die in der Analyse verwendet werden. Sie ist ein Mittel, um spezifische politische Phänomene zu beschreiben, zu verstehen und zu interpretieren. Beispielsweise sind Begriffe wie "Demokratie", "Macht", "Staat", "Regierung", "Liberalismus", "Sozialismus", "Nationalismus" usw. allesamt häufig verwendete politische Konzepte, die klar definiert und konzeptualisiert werden müssen, bevor sie in der Analyse verwendet werden können. Dabei ist zu beachten, dass diese Konzepte je nach Kontext, Kultur, Zeit und Raum unterschiedliche Bedeutungen haben können.
Die Definition eines Konzepts erfordert ein Verständnis seines Wesens und seiner grundlegenden Eigenschaften. Um beispielsweise den Begriff "Demokratie" zu definieren, könnte man sagen, dass es sich dabei um ein politisches System handelt, in dem die Bürger die Macht haben, ihre Führer durch freie und faire Wahlen zu wählen. Dies erfasst jedoch nicht notwendigerweise alle Nuancen der Demokratie, die Elemente wie Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit usw. umfassen können. Der Prozess der Konzeptualisierung kann auch die Entwicklung neuer Konzepte oder die Anpassung bestehender Konzepte beinhalten, um neue politische Realitäten zu verstehen. Beispielsweise entstand das Konzept der "digitalen Demokratie" mit der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien, was zu neuen Formen der politischen Beteiligung und des Engagements geführt hat.
Der Begriff "Konzept" stammt aus dem Lateinischen "conceptus", das sich vom Verb "concipere" ableitet. "Concipere" wiederum wird aus den Wörtern "con-", das "zusammen" bedeutet, und "capere", das "nehmen" bedeutet, gebildet. Wörtlich übersetzt bedeutet "concipere" also "zusammennehmen", was die Idee des "Verstehens" oder "Erfassens" einer Idee oder Sache als Ganzes impliziert. In der Politikwissenschaft, wie auch in jedem anderen Forschungsbereich, ist ein "Konzept" also eine Idee oder ein Phänomen, das "zusammengenommen" oder "verstanden" wurde, sodass es genauer untersucht und analysiert werden kann.
Das Konzept ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Forschung und Analyse, nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern in allen Wissensbereichen. Konzepte sind wie Bausteine, die wir verwenden, um der Welt um uns herum einen Sinn zu geben. Sie ermöglichen es uns, Informationen zu klassifizieren und zu organisieren, Beziehungen zwischen Phänomenen zu sehen und komplexe Ideen auf vereinfachte Weise zu kommunizieren. Ein Konzept wie "Demokratie" ermöglicht es uns beispielsweise, eine Vielzahl von Merkmalen und Erfahrungen unter einem Begriff zusammenzufassen, und hilft uns so, die spezifischen Aspekte der politischen Steuerung, die mit diesem Begriff verbunden sind, zu verstehen und zu kommunizieren. Darüber hinaus kann die Konzeptualisierung dabei helfen, präzisere Forschungsfragen zu stellen, Hypothesen zu formulieren, relevante Variablen zu identifizieren und theoretische Modelle zu konstruieren. Aus dieser Perspektive sind Konzepte mehr als eine Verständnishilfe, sie sind die Grundlage jeder ernsthaften akademischen Forschung.
Der Begriff "Konzept" ist polysem. Seine Bedeutung variiert stark je nach Benutzer und Kontext, in dem er verwendet wird. Im Allgemeinen wird ein Konzept als eine Idee oder ein abstrakter Begriff wahrgenommen. Dennoch kann seine Interpretation je nach Studienbereich stark voneinander abweichen. In der Philosophie beispielsweise wird ein Konzept im Allgemeinen als eine geistige Vorstellung oder Idee gesehen, die im Geist durch Beobachtung oder Reflexion gebildet wird. In der Wissenschaft hingegen ist ein Konzept eine allgemeine Idee, die durch die Untersuchung von Details und die Identifizierung gemeinsamer Merkmale gewonnen wird. In der Politikwissenschaft kann ein Konzept dazu dienen, politische Phänomene wie Macht, Demokratie oder Regierung zu verstehen und zu erklären. In der Informatik schließlich kann sich der Begriff "Konzept" auf eine Abstraktion oder Darstellung in einem System oder einer Programmiersprache beziehen. Bei der Verwendung des Begriffs "Konzept" ist es daher von entscheidender Bedeutung, den Kontext und die spezifische Bedeutung, die man damit verbindet, zu klären. Die Vielfalt der Interpretationen macht die Verwendung des Begriffs sowohl komplex als auch bereichernd.
Robert Adcock schlägt in seinem 2005 veröffentlichten Werk "The History of Political Science" eine Definition des Konzepts vor, die auf dem klassischen Modell basiert, das auch als "objektivistisches Paradigma" bekannt ist.[4] In dieser Perspektive werden Konzepte als mentale Repräsentationen von Kategorien der Welt betrachtet. Sie sollen die externe Realität repräsentieren. In dieser Sichtweise ist ein Konzept nicht einfach eine abstrakte Idee, sondern eine Art und Weise, die reale Welt zu klassifizieren und zu verstehen. Jedes Konzept ist eine mentale Kategorie, die einen bestimmten Ausschnitt der Realität darstellt. Beispielsweise sind in der Politikwissenschaft Konzepte wie "Demokratie", "Staat" und "Macht" mentale Repräsentationen der verschiedenen Aspekte und Strukturen der politischen Realität.
Die objektivistische Perspektive besagt, dass diese Konzepte präzise Abbildungen der Realität sind. Mit anderen Worten: Die äußere Realität existiert unabhängig von unseren Wahrnehmungen und es ist die Aufgabe der Konzepte, sie so genau wie möglich darzustellen. Dies ist eine sehr einflussreiche Perspektive, die jedoch nicht unumstritten ist. Einige Kritiker argumentieren, dass unsere Konzepte unweigerlich durch unsere eigenen Erfahrungen, Kulturen und Sprachen gefärbt sind und daher die Realität niemals vollkommen objektiv abbilden können.
In der objektivistischen Perspektive werden Konzepte als mentale Symbole, mentale Repräsentationen oder mentale Bilder betrachtet, die die externe Realität widerspiegeln. Dieser Ansatz geht davon aus, dass unser Geist symbolische Repräsentationen der Realität schafft, die es uns ermöglichen, die Welt zu verstehen und in ihr zu navigieren. Wenn wir beispielsweise das Konzept der "Demokratie" nehmen, haben wir in unserem Geist keine physische Demokratie, sondern ein mentales Bild oder eine Vorstellung davon, was Demokratie ist, die auf unseren Erfahrungen, unserer Bildung, unserer Kultur usw. beruht. Dieses mentale Bild der Demokratie ist ein Symbol, das die komplexe Realität dessen, was ein demokratisches politisches System ist, darstellt. Diese Fähigkeit, Konzepte als mentale Symbole zu verwenden, ist grundlegend für unsere Fähigkeit zu denken, zu verstehen und zu kommunizieren. Es ist jedoch wichtig, daran zu erinnern, dass unsere mentalen Repräsentationen Vereinfachungen der Realität sind und von Person zu Person aufgrund unserer individuellen Erfahrungen und unseres kulturellen und sozialen Kontexts variieren können.
Im klassischen Modell oder im objektivistischen Paradigma werden Konzepte (kognitive Objekte) so gesehen, dass sie eine Klasse oder Kategorie von realen Objekten oder Phänomenen darstellen, die auf ihren gemeinsamen Merkmalen beruhen. Beispielsweise steht das Konzept "Demokratie" für eine Klasse von politischen Systemen, die bestimmte gemeinsame Merkmale aufweisen, wie freie und faire Wahlen, Achtung der Menschenrechte, Gewaltenteilung etc. Ebenso könnte das Konzept "Macht" für eine Klasse von sozialen Beziehungen stehen, die durch Einfluss, Kontrolle oder Dominanz gekennzeichnet sind. Der Schlüssel hierbei ist, dass diese Konzepte nicht einfach nur abstrakte Ideen oder theoretische Konstrukte sind, sondern kognitive Werkzeuge, die es uns ermöglichen, die Realität auf sinnvolle Weise zu verstehen, zu erklären und zu kategorisieren. Von diesen Konzepten wird angenommen, dass sie die Realität so darstellen, wie sie ist, unabhängig von unseren subjektiven Wahrnehmungen oder Interpretationen. Wie bereits erwähnt, hat dieser Ansatz jedoch auch seine Kritiker. Einige legen nahe, dass Konzepte unweigerlich von unseren subjektiven und kulturellen Perspektiven beeinflusst werden und daher die Realität niemals vollkommen objektiv darstellen können. Darüber hinaus ist die Realität selbst komplex und dynamisch und lässt sich möglicherweise nicht ohne Weiteres in eine eindeutige und endgültige Kategorisierung einordnen, wie es dieses klassische Modell nahelegen könnte.
Giovanni Sartori, ein bekannter italienischer Politikwissenschaftler, entwickelte in seinem 1984 erschienenen Buch "Social Science Concepts: A Systematic Analysis" einen systematischen Ansatz zur Analyse sozialwissenschaftlicher Konzepte.[5] Für Sartori wird ein Konzept durch eine Reihe von notwendigen Merkmalen definiert, die es von anderen Konzepten unterscheiden. Er legt Wert auf eine klare und präzise Definition von Konzepten, um die Fehler der Überkonzeptualisierung (wenn ein Konzept zu weit gefasst ist, um nützlich zu sein) und der Unterkonzeptualisierung (wenn ein Konzept zu eng definiert ist, um seine vollständige Bedeutung zu erfassen) zu vermeiden.
Sartoris Ziel ist es, eine klare Unterscheidung zwischen dem, was zu einem Konzept gehört (A), und dem, was nicht dazu gehört (Nicht-A), zu schaffen. Dies ermöglicht eine genauere und effizientere Klassifizierung und Analyse. Mithilfe seiner Methode könnten wir beispielsweise sagen, dass ein politisches System, um als "Demokratie" zu gelten, bestimmte notwendige Merkmale aufweisen muss, wie z. B. die Abhaltung von freien und fairen Wahlen. Wenn ein politisches System dieses Merkmal nicht aufweist, würde es als "Nicht-Demokratie" (non-A) eingestuft werden.
Dieser Ansatz zielt durch die Betonung klarer und präziser Begriffsdefinitionen darauf ab, die sozialwissenschaftlichen Analysen strenger und systematischer zu gestalten. Wie alle Ansätze hat er jedoch seine Grenzen und Kritiker, wobei einige Personen darauf hinweisen, dass die soziale und politische Realität oftmals nuancierter und komplexer ist, als es klare und kategorische Definitionen zulassen.
Die Begriffsanalyse ist eine entscheidende methodologische Aufgabe in jeder Forschungsarbeit, insbesondere in den Sozial- und Politikwissenschaften. Sie ist entscheidend, um einen klaren und präzisen Rahmen für die Forschung zu schaffen und den wissenschaftlichen Diskurs vom Diskurs des gesunden Menschenverstandes zu unterscheiden. Der Diskurs des Common Sense ist oft ungenau und kann mehrdeutig oder widersprüchlich sein. Beispielsweise werden in der Alltagssprache Begriffe wie "Freiheit", "Gerechtigkeit", "Gleichheit" oder "Demokratie" oft vage oder uneinheitlich verwendet, ohne klare oder kohärente Definitionen. Dies kann es schwierig machen, genau zu verstehen, was gemeint ist, wenn diese Begriffe verwendet werden. Im Gegensatz dazu zielt der wissenschaftliche Diskurs darauf ab, präzise und kohärent zu sein und auf klaren und expliziten Definitionen der Begriffe zu basieren. Beispielsweise wird ein Politikwissenschaftler, der in seiner Forschung den Begriff "Demokratie" verwendet, genau definieren, was er unter "Demokratie" versteht, und die Merkmale angeben, die notwendig sind, damit ein politisches System als solches betrachtet werden kann. Indem sie dies tut, hilft die Begriffsanalyse, den wissenschaftlichen Diskurs zu klären und ihn vom Diskurs des gesunden Menschenverstandes zu unterscheiden. Sie hilft auch dabei, den wissenschaftlichen Diskurs stringenter zu gestalten, indem sie sicherstellt, dass die verwendeten Konzepte klar definiert und im Laufe der Forschung einheitlich verwendet werden.
Giovanni Sartori hat in seinem systematischen Ansatz zur Begriffsanalyse betont, dass Sozialwissenschaftler ihre Begriffe klar definieren müssen. Dazu gehört seiner Meinung nach die Entwicklung von Begriffsdefinitionen, die sowohl klar als auch intersubjektiv sind, d. h. die von der gesamten Wissenschaftsgemeinschaft verstanden und akzeptiert werden können. Diese Anforderung soll sicherstellen, dass die in der Forschung verwendeten Konzepte präzise, kohärent und allgemein verständlich sind, wodurch Missverständnisse und Mehrdeutigkeiten vermieden werden, die sich aus einer unklaren oder subjektiven Konzeptdefinition ergeben können. Darüber hinaus erkennt Sartori an, dass konzeptionelle Arbeit auch zur Schaffung neuer Konzepte führen kann. Bei der Erforschung und Analyse sozialer oder politischer Phänomene können Forscher neue Kategorien oder Muster erkennen, die nicht zu den bestehenden Konzepten passen. In diesen Fällen können sie neue Konzepte schaffen, um diese Phänomene zu beschreiben und zu erklären. Dies zeigt, dass die Begriffsanalyse nicht nur eine vorbereitende methodische Aufgabe ist, sondern einen integralen Bestandteil des Forschungsprozesses selbst darstellt. Sie ist entscheidend, um die Phänomene, die die Forscher untersuchen, effektiv zu verstehen, zu erklären und zu kommunizieren.
Charles Taylor, ein kanadischer politischer Philosoph, unterscheidet Kategorien im Sinne von notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Aus dieser Perspektive wird ein Konzept durch eine Reihe von Merkmalen definiert, die sowohl notwendig (d. h. sie müssen vorhanden sein, damit das Konzept angewendet werden kann) als auch hinreichend (d. h. wenn diese Merkmale vorhanden sind, wird das Konzept notwendigerweise angewendet) sind. Taylor betrachtet diese Bedingungen als binäre oder dichotome Variablen. Das bedeutet, dass jede Bedingung entweder vorhanden oder abwesend ist - es gibt keine Mitte. Wenn wir zum Beispiel "Demokratie" so definieren, dass freie und faire Wahlen erforderlich sind, dann würde ein politisches System, das keine freien und fairen Wahlen hat, nach dieser Definition nicht als Demokratie gelten.
Nach diesem Ansatz haben alle Mitglieder einer Kategorie den gleichen Status - wenn ein politisches System die notwendigen und hinreichenden Bedingungen erfüllt, um als "Demokratie" eingestuft zu werden, dann ist es genauso eine Demokratie wie jedes andere System, das diese Bedingungen erfüllt. Dies sorgt für Klarheit und Präzision bei der Definition von Begriffen, kann aber auch für seine Starrheit kritisiert werden. In der Realität können soziale und politische Phänomene oft nuancierter sein und lassen sich nicht so leicht in binäre Begriffe kategorisieren. Beispielsweise können einige politische Systeme Elemente der Demokratie aufweisen, ohne vollständig demokratisch zu sein, und stellen somit eine Herausforderung für diesen dichotomen Ansatz dar.
Die Bedeutung des Messens in der Politikwissenschaft[modifier | modifier le wikicode]
Theorien sind eigentlich intellektuelle Konstrukte, die uns helfen, die Beziehungen zwischen verschiedenen Konzepten zu verstehen und Phänomene in der realen Welt zu erklären. Doch obwohl die Konzepte selbst Abstraktionen sind, werden sie oft operationalisiert, damit sie gemessen und beobachtet werden können.
Operationalisierung ist der Prozess, bei dem Forscher festlegen, wie ein bestimmtes Konzept im Rahmen einer bestimmten Studie gemessen werden soll. Dies ist ein wesentlicher Schritt in der sozialwissenschaftlichen Forschung, da er den Übergang von einem abstrakten Konzept zu konkreten, messbaren Indikatoren ermöglicht. Beispielsweise ist der Begriff "Demokratie" eine Abstraktion, die viele verschiedene Vorstellungen darüber umfasst, was eine Regierung "des Volkes, durch das Volk, für das Volk" bedeutet. Um die Demokratie jedoch empirisch zu untersuchen, müssen die Forscher festlegen, wie sie sie messen wollen. Sie können sich dafür entscheiden, Demokratie in Form von bürgerlichen und politischen Freiheiten, politischem Pluralismus, Wahlbeteiligung, Transparenz der Regierung usw. zu operationalisieren. Diese Indikatoren werden dann verwendet, um Daten zu sammeln, die analysiert werden können, um die Hypothesen der Theorie zu testen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Operationalisierung eines Konzepts je nach dem Kontext der Studie und den spezifischen Forschungsfragen unterschiedlich ausfallen kann. Forscher müssen sich daher darüber im Klaren sein, wie sie ihre Konzepte operationalisieren, und ihre methodischen Entscheidungen begründen. Entscheidend ist auch, zu verstehen, dass Konzepte zwar abstrakt und Theorien unbeobachtbar sind, sie aber wesentlich sind, um unser Verständnis der Welt zu strukturieren und unsere Forschung zu leiten. Ohne sie wüssten wir nicht, wonach wir suchen sollen oder wie wir das, was wir finden, interpretieren sollen.
Die Operationalisierung ist ein entscheidender Prozess in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Es ist der Prozess, durch den ein abstraktes Konzept (wie Demokratie, Armut, Bildung usw.) in eine messbare Variable umgewandelt wird, häufig durch die Verwendung von Indikatoren. Wenn wir z. B. das Konzept "Demokratie" nehmen, müssen wir entscheiden, wie wir dieses Konzept in einer bestimmten Studie messen wollen. Hier kommt die Operationalisierung ins Spiel. Wir könnten beschließen, dass Demokratie anhand von Indikatoren wie freie und faire Wahlen, Schutz der Menschenrechte, Unabhängigkeit der Justiz usw. gemessen wird. Die Operationalisierung ist also ein wesentlicher Schritt, um von einer theoretischen Idee zu einer empirischen Untersuchung zu gelangen. Dadurch werden abstrakte Konzepte "real", so dass sie gemessen und analysiert werden können. Es ist auch ein Schritt, der sorgfältige Überlegungen und Begründungen erfordert, da die Wahl der Indikatoren einen erheblichen Einfluss auf die Forschungsergebnisse haben kann.
Eine Messung ist eine Quantifizierung oder Qualifizierung eines Konzepts, die es für eine empirische Untersuchung nutzbar macht. Messen bedeutet, dass das Konzept in eine messbare Variable umgewandelt wird, die für die Datenerhebung verwendet werden kann.
Betrachten wir das Konzept der "Demokratisierung". Um es zu operationalisieren, müssen wir die Indikatoren für Demokratisierung festlegen. Man kann beschließen, dass Demokratisierung anhand von Faktoren wie freie und faire Wahlen, Pressefreiheit, Achtung der Menschenrechte, Existenz mehrerer politischer Parteien, Gewaltenteilung usw. gemessen werden kann. Dann kann man eine Methode entwickeln, um Daten zu diesen verschiedenen Faktoren in einer Reihe von Ländern zu sammeln. Beispielsweise könnte man bestehende Datenbanken nutzen, die die Pressefreiheit, die Achtung der Menschenrechte usw. in verschiedenen Ländern bewerten. Alternativ kann man auch eine eigene Umfrage oder Beobachtungsmethode entwickeln, um diese Informationen zu sammeln. In diesem Fall wären die Daten zu diesen verschiedenen Indikatoren die Messgrößen für das Konzept der Demokratisierung. Wie im Beispiel des Glücks ist es jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Maße Repräsentationen des Konzepts der Demokratisierung sind und nicht das Konzept selbst. Außerdem haben alle Messungen eine gewisse Fehlerquote und sind nie perfekt, weshalb es wichtig ist, sorgfältig zu überlegen, wie man die Konzepte in seiner Forschung operationalisiert und misst.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Messung eine Darstellung des Konzepts ist und nicht das Konzept selbst. Darüber hinaus ist keine Messung perfekt und alle haben eine gewisse Fehlerquote. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sorgfältig darüber nachzudenken, wie man Konzepte in seiner Forschung operationalisiert und misst.
Die Operationalisierung ist ein wesentlicher Schritt in jedem empirischen Forschungsprozess. Ohne sie bleiben die Konzepte zu abstrakt, um systematisch und rigoros analysiert werden zu können. Durch Operationalisierung werden theoretische Konzepte in messbare Variablen umgewandelt, die beobachtet und analysiert werden können. Es ist ein Prozess, der abstrakte Konzepte in konkrete, beobachtbare Begriffe übersetzt, die es den Forschern ermöglichen, sie zu messen und zu analysieren. Durch die Operationalisierung von Konzepten können Forscher Hypothesen und Theorien mithilfe empirischer Methoden testen. Wenn ein Forscher beispielsweise die Theorie hat, dass Demokratisierung zu weniger Gewalt führt, muss er zunächst die Konzepte "Demokratisierung" und "Gewalt" operationalisieren. Erst wenn er diese Konzepte in messbaren Begriffen definiert hat, kann er Daten sammeln und die Beziehung zwischen ihnen analysieren. Ohne Operationalisierung wäre es unmöglich, Theorien und Hypothesen in den Sozial- und Politikwissenschaften empirisch zu testen.
= Die Entwicklung des Fachs: Von der Kunst zur Wissenschaft =. Die fünf Schlüsseltransformationen, die unser Verständnis des gegenwärtigen Zustands der Politikwissenschaft erhellen, die uns helfen, die Gegenstände dieser Disziplin zu definieren, und die uns dazu auffordern, tief über die intrinsische Natur der Politikwissenschaft nachzudenken, sind die folgenden:
- Übergang von Beschreibung/Urteil zu Erklärung/Analyse: Dieser Übergang hat einen grundlegenden Richtungswechsel von der persönlichen Meinungsäußerung oder dem normativen Urteil hin zur rigorosen Analyse politischer Phänomene markiert. Das bedeutet, dass die Forscher der Politikwissenschaft zu erklären versuchen, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen, anstatt zu sagen, wie sie geschehen sollten.
- Aufstieg der Methode: Die zunehmende Bedeutung, die der Methode beigemessen wird, hat dazu beigetragen, den wissenschaftlichen Charakter der Politikwissenschaft zu stärken. Das bedeutet, dass Politikwissenschaftler rigorose Forschungsmethoden anwenden, um ihre Hypothesen und Theorien zu testen.
- Spezialisierung: Mit der Entwicklung der Politikwissenschaft begannen die Forscher, sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren, wie z. B. vergleichende Politik, internationale Beziehungen, politische Theorie, öffentliche Politik etc. Diese Spezialisierung ermöglichte es, in diesen spezifischen Bereichen ein tieferes Wissen zu entwickeln.
- Übergang von metatheoretischen Ansätzen zu Theorien mittlerer Reichweite: Theorien mittlerer Reichweite sind Theorien, die versuchen, ein bestimmtes Phänomen oder eine Reihe zusammenhängender Phänomene zu erklären, im Gegensatz zu metatheoretischen Theorien, die versuchen, ein breites Spektrum an Phänomenen zu erklären. Dieser Übergang hat zu genaueren und nuancierteren Erklärungen politischer Phänomene geführt.
- Revolution bei den verfügbaren Daten: Die zunehmende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Daten hat die Art und Weise, wie politikwissenschaftliche Forschung betrieben wird, grundlegend verändert. Dies hat es den Forschern ermöglicht, politische Phänomene in einem nie dagewesenen Umfang und mit einer nie dagewesenen Genauigkeit zu analysieren.
Diese Veränderungen haben dazu beigetragen, die Politikwissenschaft zu einer rigorosen und dynamischen Disziplin zu formen, die sich weiterhin mit den neuen verfügbaren Daten, Theorien und Methoden weiterentwickelt.
Von der Beschreibung zur Erklärung: Eine wichtige Wende[modifier | modifier le wikicode]
Seit dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere seit den 1960er Jahren beobachten wir eine doppelte Bewegung bei der Untersuchung politischer Phänomene.
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Arbeiten der Politikwissenschaft hauptsächlich deskriptiv und normativ. Die Forscher konzentrierten sich auf die Beschreibung von politischen Strukturen, Verhaltensweisen und Ideologien, oft mit dem Ziel, die bestehende politische Ordnung zu reformieren oder zu verbessern. Zum einen verlagerte sich der Forschungsgegenstand von der bloßen Beschreibung hin zu einer tiefergehenden Erklärung politischer Phänomene. Mit anderen Worten: Die Forscher waren weniger an der Beschreibung politischer Tatsachen interessiert als vielmehr daran, die diesen Tatsachen zugrunde liegenden Ursachen und Wirkungen zu verstehen. Dieser Ansatz stellte jedoch nicht ausreichend die Frage nach dem "Warum? - eine Frage, die eine tiefere Erklärung der politischen Phänomene erfordert. Um diese Frage zu beantworten, müssen die Forscher eine Argumentation entwickeln, die auf Hypothesen, Beweisen und logischen Schlussfolgerungen beruht, mit anderen Worten: eine Analyse.
Erst später, insbesondere ab den 1960er Jahren, begannen die Forscher der Politikwissenschaft, sich stärker auf die Frage nach dem "Warum?" zu konzentrieren. Sie versuchten, die Ursachen und Auswirkungen politischer Phänomene zu erklären, indem sie analytische Methoden anwendeten und sich auf empirische Beweise stützten. Dadurch hat sich die Politikwissenschaft zu einer strengeren und wissenschaftlicheren Disziplin entwickelt. So haben wir auch eine Bewegung von normativen und beschreibenden Urteilen hin zu einem eher analytischen und rationalen Ansatz beobachtet. Anstatt politische Phänomene wertend zu beurteilen oder einfach nur zu beschreiben, versuchten die Wissenschaftler, sie objektiver zu verstehen, indem sie analytische Methoden und auf empirischen Beweisen basierende Argumentationen anwendeten. Dieser Wandel hat die wissenschaftliche Strenge der Disziplin verbessert und zu einem besseren Verständnis der Komplexität politischer Phänomene geführt.
Im Rahmen der Politikwissenschaft beschäftigen sich die Forscher häufig mit empirischen Mustern oder Regelmäßigkeiten, die in verschiedenen Gesellschaften und im Laufe der Zeit auftreten. Diese Regelmäßigkeiten können sich auf verschiedene Phänomene beziehen, wie z. B. das Wahlverhalten, die Entstehung sozialer Bewegungen, die Entwicklung politischer Systeme, den Verlauf von Konflikten etc. Wenn Forscher diese Regelmäßigkeiten identifizieren, können sie damit beginnen, Theorien oder Hypothesen über die zugrunde liegenden Mechanismen zu formulieren, die diese Phänomene erklären. Diese Mechanismen können verschiedene Faktoren beinhalten, wie z. B. politische Institutionen, soziale Prozesse, individuelle Motivationen, wirtschaftliche Faktoren etc. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, Wissen zu generieren, das uns helfen kann, die politische Welt besser zu verstehen. Indem wir die Mechanismen identifizieren, die bestimmte empirische Regelmäßigkeiten hervorbringen, können wir auch in der Lage sein, Vorhersagen darüber zu treffen, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln könnten oder wie bestimmte Interventionen die politischen Ergebnisse beeinflussen könnten.
Die Politikwissenschaft hat in ihrem Streben nach Erklärung und Analyse Methoden übernommen, die sie den Natur- und Physikwissenschaften entlehnt hat, wobei sie diese Methoden an die Komplexität und Besonderheit sozialer und politischer Phänomene anpasst. Eine dieser Methoden ist der vergleichende Ansatz, der die Untersuchung mehrerer Fälle beinhaltet, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihnen zu ermitteln. Diese Methode kann es Forschern ermöglichen, die Ursachen und Folgen politischer Phänomene besser zu verstehen, indem sie beobachten, wie sie sich in verschiedenen Kontexten manifestieren. Beispielsweise könnte ein Forscher in der Politikwissenschaft einen vergleichenden Ansatz verwenden, um die Demokratisierung zu untersuchen. Er könnte eine Reihe von Ländern untersuchen, die vor kurzem den Übergang zur Demokratie vollzogen haben, und dabei die Prozesse vergleichen, in denen diese Übergänge stattgefunden haben, die Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden, und die Faktoren, die zum Erfolg oder Misserfolg der Demokratisierung beigetragen haben. Doch obwohl die Politikwissenschaft Methoden aus den Natur- und Physikwissenschaften übernimmt, bleibt sie eine Sozialwissenschaft. Die Phänomene, die sie untersucht, sind tief im sozialen und kulturellen Kontext verwurzelt und werden oft von subjektiven und nicht greifbaren Faktoren beeinflusst, die möglicherweise schwer zu messen oder zu quantifizieren sind.
Diese Tabelle zeigt die Anzahl der Artikel, in denen kausalitätsbezogene Begriffe wie "Kausalanalysen" verwendet werden, und zwar nicht nur im Rahmen der amerikanischen Zeitschrift für Politikwissenschaft, sondern auch in einem breiteren Spektrum wissenschaftlicher Zeitschriften.
Die deutliche Zunahme der Verwendung von kausalitätsbezogenen Begriffen in diesen Publikationen verdeutlicht die zunehmende Rolle, die der Erklärung in der Arbeit der Politikwissenschaftler seit den 1960er Jahren beigemessen wird. Dies impliziert, dass sich das Feld der Politikwissenschaft in Richtung einer stärkeren Fokussierung auf die Kausalanalyse entwickelt hat. Mit anderen Worten: Wissenschaftler der Politikwissenschaft sind zunehmend daran interessiert, die Ursachen und Wirkungen in politischen Phänomenen zu verstehen. Sie versuchen, die Mechanismen zu identifizieren, die erklären, warum bestimmte Dinge in der Politik geschehen. Die zunehmende Verwendung der kausalen Sprache spiegelt auch den wachsenden Einfluss quantitativer und methodisch strenger Ansätze in der Politikwissenschaft wider. Diese Ansätze werden häufig verwendet, um kausale Beziehungen zwischen verschiedenen politischen Faktoren herzustellen. Schließlich könnte dies auch einen breiteren Trend in den Sozialwissenschaften hin zu empirischeren und datengetriebenen Methoden widerspiegeln. Die Forscher sind zunehmend in der Lage, große Datensätze zu sammeln und zu analysieren, was es ihnen ermöglicht, kausale Zusammenhänge detaillierter und rigoroser zu untersuchen. Davon abgesehen ist es wichtig zu beachten, dass eine stärkere Betonung der Kausalanalyse nicht zwangsläufig bedeutet, dass andere Ansätze weniger wichtig oder wertvoll sind. Es gibt viele Aspekte der Politik, die möglicherweise eher qualitative, interpretative oder theoretische Ansätze erfordern.
Methodologische Stärkung: Auf dem Weg zu einer wissenschaftlicheren Forschung[modifier | modifier le wikicode]
In der Politikwissenschaft wie auch in anderen Sozialwissenschaften hat die Betonung der Erklärung zu einer strengeren Methodik und einer stärkeren Wissenschaftlichkeit der Forschung geführt. Das bedeutet, dass die Forscher bei der Prüfung ihrer Hypothesen und der Interpretation ihrer Daten einen systematischeren und disziplinierteren Ansatz verfolgen. Sie stützen sich auf etablierte und rigorose Forschungsmethoden, um Daten zu sammeln, seien es Umfragen, Interviews, Fallstudien oder Dokumentenanalysen. Diese Methoden werden eingesetzt, um die Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Forschungsergebnisse zu gewährleisten. Darüber hinaus hat sich in der politikwissenschaftlichen Forschung auch der Einsatz quantitativer Methoden und statistischer Analysen verstärkt. Dies ermöglicht es den Forschern, große Datensätze zu verarbeiten und stärkere kausale Zusammenhänge zwischen verschiedenen politischen Variablen herzustellen. Letztendlich zielt dieser Trend hin zu einer strengeren Methodik und einer stärkeren Wissenschaftlichkeit der politikwissenschaftlichen Forschung darauf ab, zuverlässigeres und genaueres Wissen über die politische Welt zu produzieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Ansatz andere, eher qualitative oder theoretische Ansätze in der Politikwissenschaft nicht ersetzt, sondern ergänzt.
Die vergleichende Methode ist ein in der Politikwissenschaft häufig verwendeter Ansatz, der auf der Analyse und dem Vergleich einer kleinen Anzahl von Fällen beruht, in der Regel zwischen zwei und zwanzig. Die Idee ist, aus den Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den untersuchten Fällen Schlussfolgerungen zu ziehen. Dieser Ansatz ist besonders nützlich, um die Vielfalt der politischen Institutionen zu untersuchen. Beispielsweise kann man mithilfe der vergleichenden Methode analysieren, wie verschiedene Demokratien funktionieren, indem man spezifische Aspekte wie Wahlsysteme, Regierungsstrukturen oder öffentliche Politik vergleicht. Ebenso kann man autoritäre Regime vergleichen, um die Faktoren zu verstehen, die zu ihrer Stabilität oder ihrem Untergang beitragen. Einer der Hauptvorteile der vergleichenden Methode ist, dass man eine Reihe von Variablen kontrollieren und sich auf die spezifischen Faktoren konzentrieren kann, die man untersuchen möchte. Dies kann dabei helfen, kausale Zusammenhänge zu erkennen und robustere Theorien zu entwickeln. Allerdings ist es auch wichtig, die Grenzen dieser Methode zu erkennen, insbesondere die Tatsache, dass sie von der Qualität der ausgewählten Fälle und der Relevanz der durchgeführten Vergleiche abhängt.
Die Beobachtung von institutionellen und politischen Variationen in verschiedenen Ländern bildet eine Grundlage für die Anwendung der vergleichenden Methode in der Politikwissenschaft. Beispielsweise ist die Schweiz durch ein föderalistisches System gekennzeichnet, was bedeutet, dass die Macht zwischen der Zentralregierung und den Regierungen der Kantone aufgeteilt ist. Im Gegensatz dazu ist Frankreich ein stark zentralisierter Einheitsstaat, in dem die Macht auf der Ebene der Zentralregierung konzentriert ist, obwohl es lokale Regierungsebenen gibt. Ebenso hat die Schweiz ein parlamentarisches System, in dem die Exekutivgewalt beim Bundesrat liegt, der dem Parlament gegenüber verantwortlich ist. Frankreich hingegen hat ein semipräsidentielles System, in dem der Präsident über weitreichende Befugnisse verfügt, die vom Parlament unabhängig sind. Diese Unterschiede können erhebliche Auswirkungen auf die Funktionsweise der Politik in diesen Ländern haben, z. B. in Bezug auf Entscheidungsprozesse, politische Rechenschaftspflicht, Minderheitenschutz, Konfliktmanagement und so weiter. Eine vergleichende Studie dieser Systeme kann daher helfen zu verstehen, wie sich unterschiedliche institutionelle und politische Konfigurationen auf die politischen Ergebnisse auswirken.
Der Vergleich verschiedener politischer Institutionen bietet nicht nur eine breitere Perspektive auf die Vielfalt politischer Systeme, sondern liefert auch eine solide Grundlage für die Kausalanalyse in der Politikwissenschaft.
Zunächst einmal erweitert der Vergleich unseren Blick auf das, was in Bezug auf politische Strukturen möglich ist. Er zeigt die Vielfalt der weltweit existierenden institutionellen Arrangements auf und macht uns die Optionen bewusst, die uns für die Strukturierung unserer eigenen Gesellschaft zur Verfügung stehen. Sie ist eine Erinnerung daran, dass wir einen gewissen Spielraum haben, um unsere Institutionen entsprechend unserem historischen, kulturellen und sozialen Kontext zu gestalten. Darüber hinaus vermittelt es das Verständnis, dass es anderswo bereits wirksame Lösungen gibt, die an unseren eigenen Kontext angepasst werden könnten.
Zweitens bieten die Unterschiede zwischen politischen Institutionen einen wertvollen Ausgangspunkt für die Prüfung kausaler Hypothesen. Eine Kausalanalyse erfordert eine gewisse Variation (sei es institutioneller, politischer oder wirtschaftlicher Art) zwischen den Einheiten, die man vergleicht. Diese Unterschiede bilden die analytische Grundlage für die Erklärung der kausalen Beziehungen. Warum sind zum Beispiel einige politische Systeme stabiler als andere? Warum fördern einige politische Systeme die Gleichheit stärker als andere? Der institutionelle Vergleich kann bei der Beantwortung dieser Fragen helfen.
Das "most similar systems design" ist ein methodischer Ansatz in der vergleichenden Politik, bei dem Fälle (in der Regel Länder) ausgewählt werden, die sich in einer Vielzahl von Variablen ähneln, sich aber in der interessierenden Variablen oder dem Phänomen, das erklärt werden soll, unterscheiden. Nehmen wir zum Beispiel an, man möchte verstehen, warum einige Länder höhere Kriminalitätsraten haben als andere. Man könnte sich dafür entscheiden, zwei Länder zu vergleichen, die sich in Bezug auf die Bevölkerungsgröße, den wirtschaftlichen Entwicklungsstand, die Kulturgeschichte, die politische Struktur usw. ähneln, aber sehr unterschiedliche Kriminalitätsraten aufweisen. Indem man die interessierende Variable (in diesem Fall die Kriminalitätsrate) so weit wie möglich isoliert, kann man genauere Einblicke in die Frage gewinnen, was diesen Unterschied verursachen könnte.
Die Idee, die diesem Ansatz zugrunde liegt, ist, dass bei sehr ähnlichen Systemen jeder Unterschied in der interessierenden Variablen wahrscheinlich auf die Variable zurückzuführen ist, die man zu erklären versucht, und nicht auf andere Störfaktoren. Dies ist eine Art der Kontrolle von Störvariablen im Rahmen einer Vergleichsstudie. Diese Methodik ermöglicht es, eine Reihe von Variablen zu kontrollieren, die einen Einfluss auf die abhängige Variable haben könnten. Durch die Auswahl von Fällen (z. B. Länder oder Personen), die in Bezug auf diese anderen Variablen ähnlich sind, kann man sicherer sein, dass die unabhängige Variable die Ursache für die Veränderung in der abhängigen Variable ist.
Die Idee ist, eine erklärende unabhängige Variable wie eine Institution oder eine politische Praxis zu identifizieren siehe ein individuelles Merkmal des Wählers, wenn man sich für das Wahlverhalten interessiert; eine solche unabhängige Variable zu identifizieren, eine erklärende Variable, die in einem der beiden Fälle nicht vorhanden ist, aber in dem anderen Fall vorhanden ist, und dass sie mit unterschiedlichen Ergebnissen auf der Ebene der erklärten Variable in Verbindung gebracht wird. Die Idee hinter dem Ansatz "most similar systems design" ist es, eine unabhängige Variable zu identifizieren, die die Ursache für die Variation in der abhängigen Variable (der Variable, die man erklären möchte) sein könnte.
Bo Rothstein wählte in seinem 1992 veröffentlichten Artikel "Labor-market institutions and working-class strength" eine Reihe von europäischen OECD-Ländern für seine Untersuchung aus.[6] Diese Länder sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich: Geografisch gesehen befinden sie sich alle in Europa; historisch gesehen teilen sie eine Reihe gemeinsamer Erfahrungen, wie die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges; wirtschaftlich gesehen sind sie alle entwickelte Marktwirtschaften und OECD-Mitglieder. Indem er diese Länder als Analyseeinheiten verwendet, versucht Rothstein, institutionelle Variablen zu identifizieren, die die Unterschiede in der Stärke der Arbeiterklasse erklären könnten, wie sie durch Indikatoren wie den gewerkschaftlichen Organisationsgrad oder die Fähigkeit, die Wirtschafts- und Sozialpolitik zu beeinflussen, gemessen werden. In diesem Zusammenhang ermöglicht die Verwendung des "most similar systems design" Rothstein, sich auf die institutionellen Unterschiede zwischen diesen Ländern zu konzentrieren und gleichzeitig andere Faktoren, die die Stärke der Arbeiterklasse beeinflussen könnten, so weit wie möglich zu kontrollieren. Dies ist eine typische Anwendung dieser vergleichenden Forschungsmethode.
Bo Rothstein versucht in seiner Studie zu verstehen, warum die Stärke der Gewerkschaftsbewegungen in den verschiedenen europäischen Ländern so unterschiedlich ist. Er stellt erhebliche Unterschiede in der Organisation und Stärke der Gewerkschaften über diese Länder hinweg fest und versucht, die Faktoren zu ermitteln, die diese Unterschiede erklären können. Eine der institutionellen Variablen, die er untersucht, ist das Ghent-System. Dieses System, das in einigen Ländern vorhanden ist, in anderen jedoch nicht, zeichnet sich dadurch aus, dass die Arbeitslosenunterstützung von den Gewerkschaften verwaltet wird. Rothstein postuliert, dass diese Institution des Arbeitsmarktes eine wichtige Erklärung für die Unterschiede in der Stärke der Gewerkschaften in den europäischen Ländern sein könnte. Insbesondere stellt er fest, dass die skandinavischen Länder, in denen das Ghent-System vorhanden ist, einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad aufweisen. Daher schlägt er vor, dass das Ghent-System ein entscheidender Faktor bei der Erklärung der hohen gewerkschaftlichen Organisationsraten in diesen Ländern sein könnte.
Bo Rothsteins Hypothese ist, dass diese Länder zwar viele Gemeinsamkeiten aufweisen - z. B. geografisch, historisch und wirtschaftlich -, es aber eine wichtige Variable gibt, die sich zwischen ihnen unterscheidet: das Vorhandensein oder Fehlen des Ghent-Systems. Laut Rothstein könnte allein dieser Unterschied die beobachteten Schwankungen des gewerkschaftlichen Organisationsgrades von Land zu Land erklären. Diese Argumentation ist Teil eines vergleichenden Ansatzes, bei dem versucht wird, die Wirkung einer bestimmten Variablen zu isolieren, indem andere Variablen, die das untersuchte Phänomen ebenfalls beeinflussen könnten, kontrolliert werden.
In The Social Construction of an Imperative: Why Welfare Reform Happened in Denmark and the Netherlands but Not in Germany[7], Robert Cox untersucht die Frage der Reform des Wohlfahrtsstaates in drei europäischen Ländern: den Niederlanden, Deutschland und Dänemark. Diese drei Länder weisen eine Reihe von Ähnlichkeiten auf, wodurch sie sich für einen Vergleich in einem "most similar"-Forschungsrahmen eignen. Cox interessiert die Tatsache, dass zwei dieser Länder, die Niederlande und Dänemark, in der Lage waren, bedeutende Reformen ihres Wohlfahrtsstaates durchzuführen, während Deutschland dies nicht gelang. Er schlägt vor, dass die Fähigkeit, diese Reformen durchzuführen, nicht einfach durch wirtschaftliche Bedingungen oder externen politischen Druck erklärt werden kann, sondern im Sinne der "sozialen Konstruktion eines Imperativs" verstanden werden muss. Mit anderen Worten: Es geht darum, zu verstehen, wie der Reformbedarf in jeder Gesellschaft wahrgenommen und interpretiert wird und wie diese Interpretation die politischen Antworten prägt. Durch die Verwendung des "most similar"-Forschungsmodells kann sich Cox auf diese Variable - die soziale Konstruktion der Reformnotwendigkeit - konzentrieren und untersuchen, wie sie sich zwischen den drei Ländern unterscheidet. Dadurch kann er erklären, warum zwei von ihnen ihren Wohlfahrtsstaat reformieren konnten, während es dem anderen nicht gelang.
Die Regressionsanalyse ist eine statistische Technik, die in vielen sozialwissenschaftlichen Disziplinen, einschließlich der Politikwissenschaft, weit verbreitet ist. Sie stammt ursprünglich aus der Ökonometrie, wo sie zur Modellierung und Analyse der Beziehungen zwischen Variablen verwendet wird. Im Kontext der Politikwissenschaft kann die Regressionsanalyse verwendet werden, um die Beziehungen zwischen verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren zu untersuchen. Beispielsweise könnte sie eingesetzt werden, um die Auswirkungen von Bildung und Einkommen auf das Wahlverhalten zu analysieren oder um die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik auf die Höhe der Arbeitslosigkeit zu untersuchen. Der zunehmende Einsatz der Regressionsanalyse und anderer fortgeschrittener statistischer Techniken in der Politikwissenschaft spiegelt einen allgemeinen Trend zu größerer methodologischer Strenge und einem quantitativeren Forschungsansatz wider. Dies ist Teil der breiteren Bewegung zur Stärkung der Methoden und der Wissenschaftlichkeit der politikwissenschaftlichen Forschung.
Diese Grafik zeigt deutlich die allmähliche Zunahme der Verwendung von Regressionsanalysen in der Politikwissenschaft, einem wertvollen statistischen Werkzeug zum Nachweis von Kausalbeziehungen. Es ist bemerkenswert, dass die Verwendung dieses Werkzeugs ab Mitte des 20. Jahrhunderts erheblich zugenommen hat, was den immer stärkeren Fokus auf eine rigorose Methodik in der Disziplin widerspiegelt. Henry Brady hat in seiner Arbeit gut dargestellt, wie die Verwendung der Regressionsanalyse und generell rigoroser quantitativer Methoden in der Politikwissenschaft im Laufe der Zeit zugenommen hat.[8] Dies zeigt, wie sich die Disziplin allmählich von ihren eher qualitativen und deskriptiven Ursprüngen entfernt und mehr naturwissenschaftliche Methoden angenommen hat, wobei der Schwerpunkt auf der Feststellung von kausalen Beziehungen liegt. Die Regressionsanalyse ist für diese Aufgabe besonders nützlich, da sie es den Forschern ermöglicht, die Wirkung einer Variablen auf eine andere zu isolieren und gleichzeitig für die Wirkung anderer Variablen zu kontrollieren. Diese Fähigkeit, für die Effekte konfundierender Variablen zu kontrollieren, ist entscheidend für die Feststellung kausaler Zusammenhänge. Der Aufstieg dieser quantitativen Methoden bedeutet nicht, dass die qualitativen Ansätze ihren Wert verloren haben. Im Gegenteil: Qualitative Ansätze sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung für das Verständnis sozialer und politischer Mechanismen und Prozesse und werden oft in Kombination mit quantitativen Methoden in einem sogenannten gemischten Ansatz verwendet.
Mithilfe der Regressionsanalyse kann der Grad des Einflusses einer unabhängigen Variablen auf eine abhängige Variable ermittelt werden, während gleichzeitig eine Anpassung oder "Kontrolle" für die potenziellen Auswirkungen anderer Variablen vorgenommen wird. Durch diese Kontrolle wird das Risiko verringert, dass die beobachteten Beziehungen zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variable in Wirklichkeit das Ergebnis des Einflusses einer dritten Variablen sind. Mit anderen Worten, es gibt den Forschern mehr Vertrauen in die Tatsache, dass die beobachteten Beziehungen kausal und nicht nur korreliert sind.
Die Regressionsanalyse ist ein wertvolles Instrument, um den Effekt einer bestimmten Variablen zu isolieren und gleichzeitig die Effekte anderer Variablen zu kontrollieren. Um dies am Beispiel des Untergangs der Weimarer Republik zu verdeutlichen, könnte man die Hypothese aufstellen, dass das Proporzsystem (eine unabhängige Variable) eine bedeutende Rolle bei diesem Untergang gespielt hat (die abhängige Variable). Um diese Hypothese zu testen, könnten Daten über verschiedene Länder und historische Zeitpunkte gesammelt werden, in denen ähnliche Umstände aufgetreten sind. Diese Daten könnten auch andere relevante Variablen wie die Wirtschaftslage, die politische Stabilität, internationale Konflikte usw. umfassen. Die Regressionsanalyse würde es dann ermöglichen, die Auswirkungen des Verhältniswahlsystems auf die Stabilität der Republik zu messen und gleichzeitig die Auswirkungen dieser anderen Variablen zu kontrollieren. Wenn sich herausstellt, dass das Verhältniswahlsystem einen signifikanten Effekt hat, könnte man dann mit größerer Zuversicht behaupten, dass dieser Faktor zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen hat.
Spezialisierung: Der Schlüssel zu einem besseren Verständnis[modifier | modifier le wikicode]
Intellektuelle Figuren wie Marx, Weber, Darwin, Tolstoi, Dickens und Dostojewski zeichnen sich durch ihre bemerkenswerte Beherrschung zahlreicher Wissensgebiete aus. Ihr Werk, das oft durch eine Überschneidung von Disziplinen gekennzeichnet ist, profitierte von ihrer Fähigkeit, ganzheitlich zu denken und Ideen aus verschiedenen Fachbereichen zu integrieren. Ein Vergleich mit einer Liste einflussreicher zeitgenössischer Denker wie Bill Gates, Warren Buffet, Maria Vargas, Joe Stiglitz und Martin Wolf, die von der Zeitschrift Foreign Policy aufgedeckt wurde, könnte jedoch den Eindruck erwecken, dass diese weniger beeindruckend ist.
Es stellt sich also die Frage: Warum erscheint die zeitgenössische Liste weniger glanzvoll? Es gibt mehrere Faktoren, die erklären könnten, warum die Liste der zeitgenössischen Denker weniger beeindruckend erscheinen mag.
- Die Notwendigkeit einer historischen Perspektive: Manchmal ist eine gewisse zeitliche Distanz erforderlich, um die Wirkung und den Einfluss einer Person wirklich beurteilen zu können. Was als revolutionär oder wertvoll angesehen wird, wird vielleicht nicht sofort als solches erkannt, und der Wert eines intellektuellen Beitrags kann im Nachhinein deutlicher werden.
- Vertrautheit führt zu Banalisierung: Die zeitliche Nähe zu zeitgenössischen Denkern kann uns mit ihren Ideen vertrauter machen und uns daher dazu verleiten, ihr Genie oder ihren Einfluss zu unterschätzen. Von historischen Figuren sind wir aufgrund ihrer mythischen Statur und der Langlebigkeit ihres Einflusses oftmals stärker beeindruckt.
- Der Wandel im Umgang mit Wissen: In den letzten Jahrzehnten gab es einen strukturellen Wandel hin zu einer stärkeren Spezialisierung von Wissen. Die Universitäten fördern diese Spezialisierung, und der Wissensfortschritt erfolgt zunehmend durch die Zusammenarbeit und Interaktion von Spezialisten in immer spezifischeren Bereichen. Diese Spezialisierung wird durch neue Technologien wie das Internet erleichtert, die eine weltweite Zusammenarbeit ermöglichen. An der Universität Genf beispielsweise haben Professoren Lehrstühle inne, die spezifische Bereiche der Politikwissenschaft abdecken, und ein bestimmter Forscher neigt dazu, zu einem einzigen Unterbereich der Politikwissenschaft beizutragen.
Während historische intellektuelle Figuren also häufig Polymathematiker waren, die viele Wissensbereiche beherrschten, sind zeitgenössische Denker in der Regel Spezialisten in bestimmten Bereichen.
Die Bedeutung von Theorien mittlerer Reichweite (mid-range theories)[modifier | modifier le wikicode]
Theorien mittlerer Reichweite oder "mid-range theories" sind Konzepte, die aus der Soziologie und der Politikwissenschaft stammen. Sie sind eine Antwort auf die Herausforderung, universell gültige "große Theorien" zu konstruieren, die alle Facetten eines bestimmten Bereichs erklären. Diese "großen Theorien" werden häufig wegen ihrer mangelnden Genauigkeit und ihrer Unfähigkeit, spezifische und testbare Erklärungen für bestimmte Phänomene zu liefern, kritisiert. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich Theorien mittlerer Reichweite auf spezifische Erklärungen für bestimmte Aspekte der sozialen oder politischen Realität. Sie zielen darauf ab, spezifische Phänomene mithilfe eines begrenzten Satzes von Variablen zu erklären.
Das Konzept der "Theorie mittlerer Reichweite" wurde erstmals von dem Soziologen Robert K. Merton in den 1950er Jahren eingeführt. Merton argumentierte, dass die Sozialwissenschaften darauf abzielen sollten, solche Theorien zu entwickeln, die allgemein genug sind, um auf verschiedene Situationen anwendbar zu sein, aber spezifisch genug, um genaue und überprüfbare Vorhersagen zu liefern.
Theorien mittlerer Reichweite sind in der Politikwissenschaft weit verbreitet, wo sie häufig zur Erklärung spezifischer Phänomene wie Wahlverhalten, soziale Bewegungen, Politikgestaltung, Entscheidungsfindung von Regierungen usw. herangezogen werden. Beispielsweise ist die Theorie der rationalen Wahl, die postuliert, dass Individuen so handeln, dass sie ihren persönlichen Nutzen maximieren, eine Theorie mittlerer Reichweite, die in vielen Bereichen der Sozialwissenschaften, einschließlich der Politikwissenschaft, verwendet wird. Zu den Vorteilen von Theorien mittlerer Reichweite gehören ihre Anwendbarkeit auf eine Vielzahl von Situationen, ihre Fähigkeit, genaue und testbare Vorhersagen zu machen, und ihre Flexibilität bei der Anpassung an neue Daten und Kontexte.
In der heutigen Zeit ist ein Trend weg von den großen "Ismen" wie Marxismus, Liberalismus, Konstruktivismus und Realismus hin zu spezifischeren, kontextbezogenen Debatten und Theorien mittlerer Reichweite zu beobachten. Diese Debatten und Theorien haben in der Regel bestimmte Problemstellungen zum Gegenstand, die durch eine gründliche empirische Analyse gelöst werden können. Diese Verlagerung des Schwerpunkts auf Theorien mittlerer Reichweite zeugt von dem Wunsch nach einem besseren Verständnis der spezifischen Dynamiken, die verschiedenen sozialen und politischen Phänomenen zugrunde liegen. Statt sich auf breite und oft abstrakte theoretische Rahmen zu verlassen, konzentrieren sich die Forscher nun auf die Entwicklung und Erprobung konkreterer Theorien, die direkt mit spezifischen empirischen Daten verknüpft werden können und die in der Lage sind, präzise und überprüfbare Erklärungen für bestimmte Phänomene zu liefern. Dies ist eine Entwicklung, die das Streben nach einer genaueren, differenzierteren und direkteren Forschungsarbeit widerspiegelt, die für die Analyse von Problemen in der realen Welt relevant ist.
Metatheorie: Jenseits der Theorie[modifier | modifier le wikicode]
Eine Metatheorie ist ein Rahmen oder eine Struktur, die dazu dient, mehrere Teiltheorien miteinander zu verbinden und logisch zusammenzuführen. Sie spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer allgemeineren oder umfassenden Theorie. Mit anderen Worten: Eine Metatheorie fungiert als Brücke oder Bindeglied zwischen separaten Theorien und ermöglicht deren Integration in ein umfassenderes System des Verständnisses. Eine Metatheorie geht oft über die bloße Summe ihrer einzelnen theoretischen Komponenten hinaus, bietet neue Perspektiven und vertieft das Verständnis des Phänomens oder des Bereichs, den sie abdeckt. Sie hilft, vorhandenes Wissen zu organisieren und zu strukturieren, und kann auch die zukünftige Forschung lenken, indem sie Bereiche identifiziert, die einer weiteren Untersuchung bedürfen.
Eine Metatheorie im Bereich der Politikwissenschaft ist eine allgemeine Theorie, die zu zeigen versucht, wie verschiedene spezifische Theorien zusammenhängen und miteinander verbunden sind. Sie zielt darauf ab, einen kohärenten Rahmen zu schaffen, der verschiedene Perspektiven und Annahmen über politische Phänomene integriert. Dieser Ansatz ermöglicht ein breiteres und umfassenderes Bild von politischen Prozessen. Sie versucht, die Komplexität der Politik zu erfassen, indem sie verschiedene Theorien miteinander verbindet, die ansonsten disjunkt oder unvereinbar erscheinen könnten. Beispielsweise könnte eine Metatheorie versuchen, Verbindungen zwischen den Theorien des Wahlverhaltens, des kollektiven Handelns und der institutionellen Steuerung herzustellen. Das letztendliche Ziel der Metatheorie ist es, ein tieferes und differenzierteres Verständnis der Politik als Studienbereich zu liefern. Dieser Ansatz kann auch dazu beitragen, neue Forschungsrichtungen zu identifizieren und effektivere Strategien für die Analyse und Interpretation politischer Phänomene zu entwickeln.
Metatheorien wie der Strukturalismus, der Marxismus, der historische Institutionalismus oder die Rational-Choice-Theorie werden verwendet, um einen allgemeinen Rahmen zu schaffen, der ein breites Spektrum an spezifischen Theorien im Bereich der Politikwissenschaft umfasst. Der Strukturalismus versucht beispielsweise, politische Phänomene im Hinblick auf die zugrunde liegenden sozialen Strukturen und deren Einfluss auf individuelle Verhaltensweisen und Einstellungen zu erklären. Der Marxismus hingegen bietet eine Analyse der Politik, die sich auf die Klassenbeziehungen und den Kampf um wirtschaftliche Macht konzentriert. Der historische Institutionalismus konzentriert sich auf die Rolle der Institutionen bei der Gestaltung der politischen und wirtschaftlichen Pfade von Gesellschaften, wobei er die Bedeutung des historischen Kontexts hervorhebt. Die Rational-Choice-Theorie schließlich geht davon aus, dass politische Akteure wie alle Individuen so handeln, dass sie ihren persönlichen Nutzen oder Vorteil maximieren. Diese Theorie wird häufig zur Analyse von Phänomenen wie dem Wahlverhalten oder der politischen Entscheidungsfindung herangezogen. Diese Metatheorien bieten unterschiedliche und manchmal komplementäre Perspektiven auf die Politik und helfen Forschern dabei, ein breites Spektrum von Phänomenen zu verstehen und zu erklären.
Theorien mittlerer Reichweite: Spezifische Lösungen[modifier | modifier le wikicode]
Das Konzept der Theorien mittlerer Reichweite (oder mid-range theories) wurde von dem Soziologen Robert Merton eingeführt. Diese Theorien sind zwischen hochgradig abstrakten und universellen Theorien (oder großen "Ismen") und rein faktenbasierten und spezifischen Beschreibungen einzelner Phänomene angesiedelt.
Theorien mittlerer Reichweite sind so konzipiert, dass sie allgemein genug sind, um ein breites Spektrum von Situationen abzudecken, aber spezifisch genug, um in der Praxis testbar und nützlich zu sein. Sie konzentrieren sich in der Regel auf einen bestimmten Bereich oder einen begrenzten Aspekt der sozialen oder politischen Realität, wie z. B. eine bestimmte Art von Institutionen, Verhaltensweisen oder Prozessen. Eine Theorie mittlerer Reichweite im Bereich der Politikwissenschaft könnte sich beispielsweise damit befassen, wie Wahlsysteme das Verhalten politischer Parteien beeinflussen oder wie sich Institutionen zur Korruptionskontrolle auf die Qualität der Regierungsführung auswirken. Diese Theorien sollen präzise und nachprüfbare Erklärungen für die von ihnen erfassten Phänomene liefern, gleichzeitig aber flexibel genug bleiben, um sich an unterschiedliche Umstände anzupassen. Sie werden häufig als Analyseinstrumente in der empirischen Forschung verwendet.
Einige Forscher widmen sich ganz der Untersuchung von Prozessen des Theoretisierens. Dies kann eine Vielzahl von Themen umfassen, von den Mechanismen, die der Bildung von Theorien und ihrer Validierung zugrunde liegen, bis hin zu den Auswirkungen dieser Theorien auf die reale Welt. In der Politikwissenschaft kann sich ein Forscher beispielsweise darauf spezialisieren, die Prozesse der Theoriebildung zu untersuchen, die sich auf einen bestimmten Bereich beziehen, wie internationale Beziehungen, öffentliche Politik oder Regierungssysteme. Diese Forscher können untersuchen, wie Theorien entwickelt, getestet, modifiziert und schließlich von der wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert oder verworfen werden. Sie können auch untersuchen, wie diese Theorien verwendet werden, um die öffentliche Politik zu informieren und politische Phänomene zu verstehen und zu erklären. Die Theoriebildung selbst kann als dynamischer und sich ständig verändernder Prozess gesehen werden, der sowohl individuelle als auch kollektive Beiträge beinhaltet und von einer Vielzahl von Kontextfaktoren wie historischen Ereignissen, technologischen Entwicklungen sowie sozialen und politischen Veränderungen beeinflusst wird. Somit ist die Untersuchung von Theoretisierungsprozessen ein reiches und komplexes Forschungsgebiet, das wertvolle Einblicke in die Art und Weise bieten kann, wie wir die politische Welt verstehen und mit ihr interagieren.
Theorien mittlerer Reichweite (oder "mid-range theories") sind Theorien, die versuchen, spezifische Phänomene zu erklären, anstatt einen universellen Erklärungsrahmen anzustreben. Sie konzentrieren sich auf einen bestimmten Bereich oder einen spezifischen Aspekt der sozialen und politischen Realität und bieten so eine detailliertere und spezifischere Analyse. Beispielsweise können Spezialisten für Bürgerkonflikte Theorien mittlerer Reichweite entwickeln, die versuchen, die Ursachen und Folgen von Bürgerkonflikten zu erklären, und sich dabei auf spezifische Faktoren wie sozioökonomische Ungleichheiten, ethnische Spaltungen, die Rolle natürlicher Ressourcen usw. konzentrieren. Ähnlich ist die Theorie des Wahlverhaltens eine weitere Form der Theorie mittlerer Reichweite, die sich auf die Erklärung der Motive und des Verhaltens von Wählern bei Wahlen konzentriert. Sie kann Faktoren wie den Einfluss der Medien, die politische Ideologie, sozioökonomische Fragen und andere Faktoren, die das Wahlverhalten beeinflussen, untersuchen. Der Ansatz der "Varietäten des Kapitalismus" hingegen ist eine Theorie, die versucht, die Unterschiede in der Art und Weise zu erklären, wie Marktwirtschaften in verschiedenen Ländern organisiert sind. Sie untersucht Faktoren wie die Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft, die Regulierung des Arbeitsmarktes, die Rolle der Finanzinstitutionen usw. Diese Theorien mittlerer Reichweite sind wertvoll, da sie es ermöglichen, spezifische Aspekte der sozialen und politischen Realität detaillierter zu erforschen, und gleichzeitig Analyserahmen bieten, die empirisch getestet werden können.
Das Informationszeitalter in der Politikwissenschaft: Revolution bei den verfügbaren Daten[modifier | modifier le wikicode]
In den letzten Jahren haben wir eine wahre Revolution in Bezug auf die Verfügbarkeit von Daten für die sozialwissenschaftliche Forschung, einschließlich der Politikwissenschaft, erlebt. Dank des Aufkommens der Digitaltechnik, des Internets und der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien haben Forscher nun Zugang zu einer nie dagewesenen Menge an quantitativen Daten, die von Wahlergebnissen bis zu Meinungsumfragen, von Wirtschaftsdaten bis zu Konfliktdaten und vielem mehr reichen.
Darüber hinaus erleichtert die Entwicklung zentralisierter, öffentlich zugänglicher Datenbanken die international vergleichende Forschung. Diese Datenbanken stellen häufig Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen und bieten ausgefeilte Such- und Analysewerkzeuge, die Forschern dabei helfen können, Daten effizienter zu verarbeiten und zu analysieren. Beispiele für solche Datenbanken sind die Weltbank, die OECD, Eurostat, das Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) in Frankreich, das Census Bureau in den USA sowie zahlreiche Umfrage- und Forschungsinstitute, die regelmäßig Daten zu verschiedenen Aspekten von Politik und Gesellschaft veröffentlichen. Diese Explosion der verfügbaren Daten hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie politikwissenschaftliche Forschung betrieben wird, sondern auch neue Möglichkeiten für die Entdeckung und Analyse von politischen Trends und Phänomenen eröffnet.
Die zunehmende Verfügbarkeit quantitativer Daten hat den Einsatz statistischer Analysemethoden in der Politikwissenschaft stark begünstigt. Datenbanken ermöglichen heute den Zugang zu einer Vielzahl von Informationen über das Wählerverhalten, die Funktionsweise von Institutionen, öffentliche Politik, Konflikte, Wirtschaft und vieles mehr. Diese Daten, gekoppelt mit immer ausgefeilteren statistischen Werkzeugen, ermöglichen es Forschern, gründliche und rigorose Analysen politischer Phänomene durchzuführen. Regressionsmodelle, Zeitreihenanalysen, Hypothesentests, Faktorenanalysen oder Mehrebenenmodelle sind allesamt Werkzeuge, die zur Interpretation von Daten und zur Beantwortung von Forschungsfragen eingesetzt werden können.
So hat sich die quantitative Analyse als unumgängliche Methode in der Politikwissenschaft etabliert und trägt dazu bei, die Strenge und Genauigkeit dieser Disziplin zu stärken. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die quantitative Analyse andere Forschungsmethoden nicht ersetzt, sondern vielmehr ergänzt. Die Interpretation der statistischen Ergebnisse und ihre Kontextualisierung erfordern ein tieferes Verständnis der untersuchten politischen und sozialen Realitäten, das durch qualitative Methoden wie Diskursanalyse, Interviews oder teilnehmende Beobachtung erbracht werden kann.
Anhänge[modifier | modifier le wikicode]
- The State : Elements of Historical and Practical Politics W. Wilson
- Le Savant et le Politique [PDF] en texte intégral sur le site Les Classiques des sciences sociales (copyright variable selon les pays)
Referenzen[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Lim, T. C. (2005). Doing comparative politics : An introduction to approaches and issues. Lynne Rienner.
- ↑ Cox, Robert W.. "Beyond international relations theory: Robert W. Cox and approaches to world order", Approaches to World Order. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 3-18.
- ↑ M. Weber, Essays on the Theory of Science, op. cit. S.146
- ↑ Adcock, R. and Bevir, M. (2005), The History of Political Science. Political Studies Review, 3: 1-16. doi: 10.1111/j.1478-9299.2005.00016.x
- ↑ Social Science Concepts: A Systematic Analysis Giovanni Sartori Beverley Hills: Sage, 1984
- ↑ Rothstein, B. (1992). 'Labor-market institutions and working-class strength'. In S. Steinmo, K. Thelen and F. Longstreth, eds. Structuring Politics. Historical Institutionalism in Com¬parative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 33-56
- ↑ Cox RH. The social construction of an imperative: why welfare reform happened in Denmark and the Netherlands but not in Germany. World Polit. 2001;53(3):463-98. doi: 10.1353/wp.2001.0008. PMID: 17595731.
- ↑ Brady, Henry A. (2008): Causation and explanation in social science. Box-Steffensmeier, Janet M., Henry Brady and David Collier (Hrsg.): The Oxford handbook of political methodology. Oxford: Oxford University Press: 217-270.