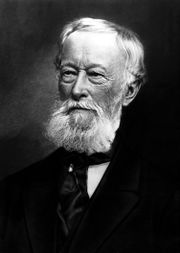Strukturelle Mechanismen der industriellen Revolution
Basierend auf einem Kurs von Michel Oris[1][2]
Agrarstrukturen und ländliche Gesellschaft: Analyse der vorindustriellen europäischen Bauernschaft ● Das demografische System des Ancien Régime: Homöostase ● Entwicklung der sozioökonomischen Strukturen im 18. Jahrhundert: Vom Ancien Régime zur Moderne ● Ursprünge und Ursachen der englischen industriellen Revolution ● Strukturelle Mechanismen der industriellen Revolution ● Die Verbreitung der industriellen Revolution in Kontinentaleuropa ● Die Industrielle Revolution jenseits von Europa: die Vereinigten Staaten und Japan ● Die sozialen Kosten der industriellen Revolution ● Historische Analyse der konjunkturellen Phasen der ersten Globalisierung ● Dynamik nationaler Märkte und Globalisierung des Warenaustauschs ● Die Entstehung globaler Migrationssysteme ● Dynamiken und Auswirkungen der Globalisierung der Geldmärkte: Die zentrale Rolle Großbritanniens und Frankreichs ● Der Wandel der sozialen Strukturen und Beziehungen während der industriellen Revolution ● Zu den Ursprüngen der Dritten Welt und den Auswirkungen der Kolonialisierung ● Scheitern und Blockaden in der Dritten Welt ● Wandel der Arbeitsmethoden: Entwicklung der Produktionsverhältnisse vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ● Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft: Die Glorreichen Dreißig (1945-1973) ● Die Weltwirtschaft im Wandel: 1973-2007 ● Die Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates ● Rund um die Kolonialisierung: Entwicklungsängste und -hoffnungen ● Die Zeit der Brüche: Herausforderungen und Chancen in der internationalen Wirtschaft ● Globalisierung und Entwicklungsmuster in der "Dritten Welt"
Dieser Kurs soll eine detaillierte und strukturierte Analyse der strukturellen Mechanismen liefern, die den Aufschwung der Industriellen Revolution ermöglicht haben, beginnend mit dem späten 18. Wir werden die anfängliche Entwicklung der Industrie mit einem Schwerpunkt darauf behandeln, wie bescheidene technologische Fortschritte und zugängliche Anfangsinvestitionen den Grundstein für die Umgestaltung der Gesellschaft legten. Wir beginnen mit einer eingehenden Untersuchung der kleinen Fertigungsbetriebe in England und heben hervor, wie diese von niedrigen Einstiegskosten profitierten und so die Entstehung einer neuen Unternehmerklasse erleichterten. Wir werden die variablen, aber oft hohen Gewinnraten dieser frühen Unternehmen und ihre Rolle bei der Förderung kontinuierlicher Reinvestitionen und Innovationen untersuchen. Anschließend untersuchen wir die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und ihre Auswirkungen auf die Größe und Reichweite von Unternehmen, die von der schützenden Isolation von lokalen Märkten bis hin zu einem durch niedrigere Transportkosten ausgelösten verstärkten Wettbewerb reichen. Besondere Aufmerksamkeit wird den sozialen Folgen der Industrialisierung gewidmet, insbesondere prekären Arbeitsbedingungen, dem Einsatz von Frauen- und Kinderarbeit und der sozialen Mobilität, die sich aus der Industrialisierung ergibt. Die Untersuchung der industriellen Entwicklungsmodelle und ihrer Ausbreitung in ganz Europa wird unsere Analyse vervollständigen und so ein Verständnis für den Einfluss der Industriellen Revolution auf die Weltwirtschaft ermöglichen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Kurs darauf abzielt, die zahlreichen Facetten der Industriellen Revolution auf deskriptive und methodische Weise zu untersuchen und dabei die wirtschaftlichen, technologischen, sozialen und menschlichen Dynamiken zu beleuchten, die diese grundlegende Periode geprägt haben.
Die niedrigen Investitionskosten[modifier | modifier le wikicode]
Der Beginn der Ersten Industriellen Revolution, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stattfand, startete mit einem relativ geringen technischen Niveau und einer geringen Kapitalintensität im Vergleich zu dem, was später daraus geworden ist. Anfangs waren die Unternehmen oft klein, und die Technologien waren zwar für die damalige Zeit innovativ, erforderten aber keine so massiven Investitionen wie die Fabriken des späten viktorianischen Zeitalters. Die Textilindustrie gehörte beispielsweise zu den ersten, die mechanisiert wurden, aber die ersten Maschinen wie die Spinning Jenny oder der mechanische Webstuhl konnten in kleinen Werkstätten oder sogar in Häusern betrieben werden (wie es im "putting-out" oder "domestic system" üblich war). Die Dampfmaschine von James Watt stellte zwar einen bedeutenden Fortschritt dar, wurde aber zunächst in relativ bescheidenem Umfang eingesetzt, bevor sie zur treibenden Kraft in großen Fabriken und im Transportwesen wurde. Das lag zum Teil daran, dass sich die Produktionssysteme noch im Übergang befanden. Die Fertigung blieb häufig eine kleine Tätigkeit, und obwohl der Einsatz von Maschinen zu einer Produktionssteigerung führte, waren dafür zunächst nicht die riesigen Anlagen erforderlich, die man mit der späteren industriellen Revolution in Verbindung bringt. Darüber hinaus war die erste Phase der industriellen Revolution durch inkrementelle Innovationen gekennzeichnet, die schrittweise Produktivitätssteigerungen ermöglichten, ohne enorme Kapitalausgaben zu erfordern. Die Unternehmen konnten ihr Wachstum oft selbst finanzieren oder sich auf familiäre oder lokale Finanzierungsnetzwerke verlassen, ohne auf die entwickelten Finanzmärkte oder große Kredite zurückgreifen zu müssen. Dennoch stiegen mit dem Fortschreiten der Revolution die Komplexität und die Kosten der Maschinen sowie die Größe der Industrieanlagen. Dies führte zu einem erhöhten Kapitalbedarf, zur Entwicklung dedizierter Finanzinstitute und zur Entstehung von Praktiken wie der Kapitalbeschaffung über Aktien oder Anleihen zur Finanzierung größerer Industrieprojekte.
Die Selbstfinanzierungskraft am Ende des 18. Jahrhunderts spiegelt die einzigartigen wirtschaftlichen Bedingungen dieser Zeit wider. Denn die relativ niedrigen Kosten der Anfangsinvestitionen für die ersten Manufakturen ermöglichten es Einzelpersonen aus der Handwerksklasse oder dem Kleinbürgertum, Industrieunternehmer zu werden. Diese Unternehmer konnten das erforderliche Kapital oftmals ohne große Kredite oder bedeutende externe Investitionen aufbringen. Die niedrigen Kosten der damaligen Technologien, die hauptsächlich von Holz und einfachem Metall abhingen, machten die Anfangsinvestitionen relativ erschwinglich. Außerdem stammten die Fähigkeiten, die zum Bau und Betrieb der ersten Maschinen erforderlich waren, häufig aus dem traditionellen Handwerk. Daher wurden zwar spezialisierte Arbeitskräfte benötigt, aber sie erforderten nicht das Ausbildungsniveau, das die späteren Technologien voraussetzten. Das bedeutet, dass die Arbeitskosten relativ niedrig blieben, vor allem im Vergleich zu den Lohn- und Qualifikationsniveaus, die für die Nutzung der fortgeschrittenen industriellen Technologien Mitte des 20. Jahrhunderts gefordert wurden. Jahrhunderts, wo die Einführung von Industrietechnologien ein viel höheres Niveau an Kapital und Fähigkeiten erforderte, das für die meisten einheimischen Arbeiter und sogar für einheimische Unternehmer ohne Unterstützung von außen unerreichbar war. Diese Situation stand in starkem Kontrast zu der in den Ländern der Dritten Welt Mitte des 20. Die für die Aufnahme einer industriellen Tätigkeit in diesen Entwicklungsländern erforderlichen Investitionen waren oft so hoch, dass sie nur durch staatliche Finanzierung, internationale Kredite oder ausländische Direktinvestitionen gedeckt werden konnten. Der anfängliche Erfolg der Unternehmer während der britischen industriellen Revolution wurde also durch diese Kombination aus niedrigen Einstiegskosten und angepassten handwerklichen Fähigkeiten erleichtert, die ein günstiges Umfeld für Innovation und industrielles Wachstum schufen. Dies führte zur Bildung einer neuen sozialen Klasse von Industriellen, die eine führende Rolle beim Vorantreiben der Industrialisierung spielten.
In den frühen Stadien der Industriellen Revolution waren die Anforderungen an die Einrichtungen für Fabriken relativ bescheiden. Bestehende Gebäude, wie Scheunen oder Schuppen, konnten leicht in Produktionsräume umgewandelt werden, ohne dass große Investitionen in Bau oder Einrichtung erforderlich waren. Dies stand im Gegensatz zu den späteren Industrieanlagen, bei denen es sich oft um große Fabriken handelte, die eigens für komplexe Produktionslinien und große Arbeiterteams gebaut wurden. Was das Umlaufkapital betrifft, d. h. die Mittel, die zur Deckung der laufenden Ausgaben wie Rohstoffe, Löhne und Betriebskosten benötigt wurden, war es oft höher als die Investition in Anlagekapital (Maschinen und Anlage). Um diese Betriebskosten zu finanzieren, konnten Unternehmen Bankkredite in Anspruch nehmen. Die damaligen Banken waren in der Regel bereit, Kredite auf der Grundlage von Eigentumstiteln für Rohstoffe, Halbfertig- oder Fertigprodukte zu gewähren, die als Sicherheiten dienen konnten. Das Kreditsystem war in England zu dieser Zeit bereits recht weit entwickelt, da etablierte Finanzinstitute das notwendige Betriebskapital für Industrieunternehmer bereitstellen konnten. Darüber hinaus halfen auch Zahlungsfristen in der Lieferkette - z. B. Rohstoffe auf Kredit zu kaufen und die Lieferanten erst nach dem Verkauf des fertigen Produkts zu bezahlen - bei der Finanzierung des Umlaufkapitals. Es ist wichtig zu beachten, dass der Zugang zu Krediten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Industrie gespielt hat. Er ermöglichte es den Unternehmen, ihre Produktion schnell auszuweiten und Marktchancen zu nutzen, ohne im Vorfeld große Mengen an Kapital anhäufen zu müssen. Dies erleichterte ein schnelles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, das für das Industriezeitalter charakteristisch wurde.
Die Reinvestition der durch die Industrielle Revolution erwirtschafteten Gewinne war eine der treibenden Kräfte für ihre Ausbreitung über die Grenzen Großbritanniens hinaus. Diese Gewinne, die aufgrund der durch neue Technologien erzielten Effizienz- und Produktivitätssteigerungen sowie der Ausweitung der Märkte oftmals beträchtlich waren, wurden für verschiedene Zwecke zugeteilt. Zum einen steckten die Industriellen einen Teil dieser Summen in technologische Innovationen, erwarben neue Maschinen und perfektionierten ihre Produktionsprozesse. Dies führte zu einer positiven Spirale der kontinuierlichen Verbesserung, bei der jeder Fortschritt zu mehr Gewinnen führte, die reinvestiert werden konnten. Gleichzeitig ermutigte die Suche nach neuen Märkten und billigeren Rohstoffquellen britische Unternehmen dazu, ihre Aktivitäten auf internationaler Ebene auszuweiten. Dieser Expansionismus nahm häufig die Form von Investitionen in Kolonien oder anderen Regionen an, wo sie Industrien aufbauten oder Industrieprojekte finanzierten und so britische Praktiken und britisches Kapital verpflanzten. Auch die Infrastruktur, die für die Industrialisierung von entscheidender Bedeutung ist, profitierte von diesen Gewinnen. Eisenbahnnetze, Kanäle und Häfen wurden nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch im Ausland ausgebaut oder verbessert, wodurch Handel und Industrieproduktion effizienter wurden. Neben diesen Direktinvestitionen diente der koloniale Einfluss Großbritanniens als Vehikel für die Verbreitung von Technologien und industriellen Methoden. Dies schuf ein günstiges Ökosystem für die Ausweitung der Industrialisierung in den Kolonien, die wiederum wichtige Rohstoffe lieferten, um die britischen Fabriken zu beliefern. Im Bereich des internationalen Handels ermöglichte der Kapitalüberschuss den britischen Unternehmen, ihren globalen Fußabdruck zu vergrößern, indem sie Fertigwaren in großen Mengen exportierten und gleichzeitig die für ihre Produktion benötigten Ressourcen importierten. Schließlich erleichterte die Mobilität von Ingenieuren, Unternehmern und Facharbeitern, die häufig durch Industriegewinne finanziert wurde, den Austausch von Fähigkeiten und Know-how zwischen den Nationen. Dieser Technologietransfer spielte eine Schlüsselrolle bei der weltweiten Verbreitung von Industriepraktiken. All diese Faktoren zusammengenommen trugen dazu bei, dass die Industrielle Revolution zu einem globalen Phänomen wurde, das nicht nur die nationalen Volkswirtschaften, sondern auch die internationalen Beziehungen und die globale Wirtschaftsstruktur veränderte.
Die hohen Gewinne[modifier | modifier le wikicode]
Die hohen Profitraten während der Ersten Industriellen Revolution, die je nach Branche oft zwischen 20 und 30 Prozent lagen, waren entscheidend für die Kapitalakkumulation und das Wirtschaftswachstum der damaligen Zeit. Diese beträchtlichen Gewinnspannen versorgten die Unternehmen mit den notwendigen Mitteln für Reinvestitionen und zur Unterstützung der industriellen Expansion und ermöglichten so ein nachhaltiges Wachstum und den Aufbau einer immer ausgefeilteren industriellen Infrastruktur. Vergleicht man diese Gewinnraten mit denen der 1950er Jahre, die auf rund 10 % und in den 1970er Jahren sogar noch weiter auf rund 5 % fielen, wird deutlich, dass die frühen Industrieunternehmer über einen erheblichen Vorteil verfügten. Dieser Vorteil ermöglichte es ihnen, erhebliche Summen in ihre Unternehmen zu reinvestieren, neue industrielle Möglichkeiten zu erkunden und immer wieder neue Innovationen zu schaffen. Dieser Geist der Akkumulation und Reinvestition von Kapital war ein entscheidender Motor der Industrialisierung. Er wurde nicht nur durch die wirtschaftlichen Gewinne ermöglicht, sondern auch durch ein bestimmtes Ethos, das in England während dieser Zeit vorherrschte. Die Vorstellung, dass Geld produktiv eingesetzt werden sollte, um die Beschäftigung anzukurbeln und Wohlstand zu schaffen, war ein Leitprinzip, das die britische Gesellschaft prägte. Das relativ bescheidene Anfangskapital, das von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen von Investoren aufgebracht werden konnte, ermöglichte eine erste Welle industrieller Aktivitäten. Es waren jedoch die Gewinne aus diesen ersten Unternehmen, die größere Investitionen antrieben und eine rasche Ausweitung der industriellen Kapazitäten und der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt ermöglichten. Dieser positive Kreislauf aus Investitionen und Innovationen beschleunigte den Industrialisierungsprozess und führte zu technologischen Fortschritten, Produktionssteigerungen und schließlich zu einer tiefgreifenden Veränderung von Gesellschaft und Wirtschaft.
Die Größe der Unternehmen[modifier | modifier le wikicode]
Das Fehlen einer optimalen oder minimalen Größe[modifier | modifier le wikicode]
Ein Vergleich der unternehmerischen Dynamik zwischen der Zeit der Industriellen Revolution und der Gegenwart unterstreicht die Veränderungen der Volkswirtschaften und der Kontexte, in denen die Unternehmen tätig sind. Während der Industriellen Revolution ermöglichten die niedrigen Einstiegskosten in den Industriesektor die Entstehung vieler kleiner Unternehmen. Die niedrigen Kosten der damaligen Technologien, die hauptsächlich mechanisch waren und häufig durch Wasserkraft oder Dampf angetrieben wurden, schufen in Verbindung mit reichlich vorhandenen und billigen Arbeitskräften ein Umfeld, in dem selbst Unternehmen mit wenig Kapital starten und gedeihen konnten. Die steigende Nachfrage, die von der Urbanisierung und dem Bevölkerungswachstum getragen wurde, sowie das Fehlen strenger Vorschriften haben die Entstehung und das Wachstum dieser kleinen Unternehmen ebenfalls begünstigt. Umgekehrt kann in der heutigen Welt die Größe eines Unternehmens ein entscheidender Faktor für seine Krisenresistenz sein. Hohe Fixkosten, fortschrittliche Technologien, strenge Regulierungsstandards und ein intensiver internationaler Wettbewerb erfordern erhebliche Investitionen und eine Anpassungsfähigkeit, die kleine Unternehmen möglicherweise nur schwer aufbringen können. Auch die Arbeitskraft, die aufgrund des höheren Lebensstandards und der sozialen Regulierungen teurer geworden ist, stellt für die Unternehmen von heute einen weitaus bedeutenderen Kostenfaktor dar. Daher geht der Trend heute in Richtung Unternehmenskonzentration, wobei die größeren Unternehmen von Größenvorteilen profitieren können, leichteren Zugang zu Finanzmitteln haben und in der Lage sind, den Markt zu beeinflussen und Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs zu überstehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das heutige unternehmerische Ökosystem auch sehr dynamisch ist, mit Technologie-Start-ups und innovativen Unternehmen, die trotz ihrer manchmal geringen Größe dank radikaler Innovationen und agiler Strukturen ganze Märkte disruptieren können.
Das Beispiel Krupp[modifier | modifier le wikicode]
Der Fall Krupp ist ein gutes Beispiel für den Übergang, der sich seit der Industriellen Revolution in der Industrielandschaft vollzogen hat. Das 1811 gegründete Unternehmen Krupp begann als kleiner Betrieb und wuchs zu einem internationalen Industriekonglomerat heran, das das Wachstumspotenzial symbolisierte, das diese Zeit des wirtschaftlichen Wandels kennzeichnete. Zu Beginn der industriellen Revolution war die Flexibilität kleiner Unternehmen ein Vorteil in einem sich schnell verändernden Markt, in dem technische Innovationen schnell übernommen und umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus ermöglichte der oftmals laxe Rechtsrahmen kleinen Einheiten zu gedeihen, ohne die bürokratischen und finanziellen Hürden, die große Unternehmen in modernen Volkswirtschaften begleiten können. Mit dem Fortschreiten des Industriezeitalters begannen jedoch Faktoren wie die Entwicklung von Transportsystemen (Schiene, See, Straße) und die Globalisierung des Handels Unternehmen zu begünstigen, die in der Lage waren, in großem Maßstab zu produzieren und ihre Produkte breiter zu vertreiben. Diese Unternehmen, wie Krupp, waren in der Lage, in große Infrastrukturen zu investieren, fortschrittliche Technologien zu übernehmen, ihren Einfluss auf die Lieferketten auszuweiten und Zugang zu internationalen Märkten zu erhalten, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Unternehmen verschaffte. Der Aufstieg von Krupp spiegelt diese Dynamik wider. Das Unternehmen war in der Lage, mit der Zeit zu gehen und sich von einer Eisengießerei zu einem multinationalen Stahlproduzenten und Rüstungskonzern zu entwickeln, der aus Kriegen, der steigenden Nachfrage nach Baustahl und der allgemeinen Industrialisierung sowie aus technologischen Innovationen Kapital schlug. In diesem Zusammenhang sahen sich kleine Unternehmen mit großen Herausforderungen konfrontiert. Ohne Zugang zu denselben Ressourcen hatten sie Schwierigkeiten, in Bezug auf Preise, Effizienz und Marktreichweite zu konkurrieren. Viele wurden von größeren Einheiten geschluckt oder mussten sich auf Nischen spezialisieren, um zu überleben. Die Fähigkeit, Krisen zu widerstehen, wurde dann zu einem mit Größe assoziierten Attribut, und große Unternehmen wie Krupp waren besser gerüstet, um mit wirtschaftlicher Volatilität, Kriegen, Finanzkrisen und politischen Veränderungen umzugehen. Ihre Größe ermöglichte es ihnen, Schocks abzufedern, Risiken zu streuen und langfristig zu planen - eine Fähigkeit, die kleineren Unternehmen weniger zugänglich war. Der Weg von Krupp ist somit Teil der breiteren Logik der industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung, bei der sich die Unternehmensstrukturen an die neuen Gegebenheiten einer sich schnell verändernden Welt anpassen mussten.
Die Kosten für den Transport[modifier | modifier le wikicode]
Hohe Kosten: ein Vorteil zu Beginn der Industrialisierung[modifier | modifier le wikicode]
Vor der Verbreitung von Dampfschiffen und der Entwicklung von Eisenbahnen hatten die hohen Transportkosten einen erheblichen Einfluss auf die Industrie- und Handelsstruktur. Fabriken neigten dazu, für lokale Märkte zu produzieren, da es oft zu teuer war, Waren über große Entfernungen zu transportieren. In dieser Zeit kam es zur Verbreitung kleiner, verstreuter Fabriken, die den unmittelbaren Bedarf der lokalen Bevölkerung deckten, wobei jede Region oft ihre eigenen Spezialitäten entwickelte, die auf den vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten basierten. Die industrielle Produktion fand in der Nähe der Rohstoffquellen wie Kohle und Eisenerz statt, um die Transportkosten zu minimieren. Diese Einschränkung förderte auch erhebliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, wie Kanäle und Eisenbahnen, und ermutigte den Ausbau bestehender Straßen. Als Eisenbahnen allgemein üblich wurden und sich Dampfschiffe verbreiteten, änderte sich die Dynamik radikal. Der Transport wurde billiger und schneller, sodass größere und zentralisierte Fabriken in der Lage waren, in Massen zu produzieren und ihre Produkte auf größeren Märkten zu verkaufen und so von Größenvorteilen zu profitieren. Dies begann kleine lokale Fabriken in Bedrängnis zu bringen, die nicht mit der Großproduktion und dem weitreichenden Vertrieb der großen Unternehmen mithalten konnten, wodurch sich die Industriewirtschaft grundlegend veränderte.
Die hohen Transportkosten zu Beginn der industriellen Revolution schufen tatsächlich eine Form von natürlichem Protektionismus, der die aufstrebenden lokalen Industrien vor der Konkurrenz durch größere und etabliertere Firmen bewahrte. Diese Transportkosten fungierten als inoffizielle Barrieren, die Märkte isolierten und es den Unternehmen ermöglichten, sich auf die Versorgung der Nachfrage in unmittelbarer Nähe zu konzentrieren. Zu dieser Zeit war der Wettbewerb hauptsächlich lokal; ein Unternehmen musste nur in einem begrenzten Umkreis wettbewerbsfähig sein, in dem die prohibitiven Transportkosten die Konkurrenz aus der Ferne abblockten. Die industrielle Revolution war in ihren Anfängen stark von ihrem lokalen und regionalen Charakter geprägt. In England war es zum Beispiel die Region Lancashire um Manchester, die die Wiege vieler industrieller Innovationen und Entwicklungen war. Ähnlich entwickelten sich in Frankreich der Norden und das Elsass zu industriellen Schlüsselzentren, ebenso wie Katalonien in Spanien und Neuengland in den USA. Diese Regionen verfügten über ihre eigenen günstigen Voraussetzungen für die Industrialisierung, wie den Zugang zu Rohstoffen, handwerklichen Fähigkeiten oder Kapital. Auf internationaler Ebene spielten dieselben Transportkosten eine entscheidende Rolle beim Schutz der kontinentaleuropäischen Industrien vor der industriellen Vormachtstellung Großbritanniens. England, ein Pionier der Industrialisierung mit einem bedeutenden technischen Vorsprung, konnte aufgrund dieser hohen Transportkosten den Rest Europas nicht ohne Weiteres mit seinen Produkten überschwemmen. Dies verschaffte den Industrien auf dem Kontinent eine Atempause, in der sie sich weiterentwickeln und technologisch vorankommen konnten, ohne von der britischen Konkurrenz überrollt zu werden. In diesem Zusammenhang hatten die hohen Transportkosten eine paradoxe Wirkung: Sie schränkten den Handel und die Verbreitung von Innovationen ein, aber gleichzeitig förderten sie die industrielle Diversifizierung und den Aufbau lokaler Kapazitäten. Dadurch konnten viele Regionen in Europa und Nordamerika vor dem Zeitalter des globalisierten Handels und des großflächigen Vertriebs den Grundstein für ihren eigenen industriellen Aufschwung legen.
Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere der Eisenbahnen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts senkte die Reisekosten und -zeiten erheblich. Vor allem die Eisenbahn revolutionierte den Transport von Waren und Personen und ermöglichte den Handel über größere Entfernungen und mit deutlich geringeren Kosten als bei herkömmlichen Methoden wie dem Transport mit Karren, Pferden oder auf Wasserwegen. Diese Senkung der Transportkosten hatte große Auswirkungen auf die Organisation der Industrie. Kleinere Industrien, die in einem Umfeld hoher Transportkosten gediehen waren und daher vor der Konkurrenz von außen geschützt waren, begannen den Druck größerer, technologisch fortschrittlicher Unternehmen zu spüren, die in der Lage waren, Massenproduktion zu betreiben. Diese Großunternehmen konnten nun ihre Handelsreichweite ausweiten und ihre Produkte auf weitaus größeren Märkten vertreiben. Mit der Eisenbahn konnten große Unternehmen nicht nur weit entfernte Märkte erreichen, sondern auch von Größenvorteilen profitieren, indem sie ihre Produktion in größeren Fabriken zentralisierten und so ihre Stückkosten senkten. So konnten sie ihre Produkte zu Preisen anbieten, mit denen die kleinen lokalen Industrien mit ihren höheren Kostenstrukturen nicht konkurrieren konnten. Vor diesem Hintergrund mussten viele kleine Unternehmen schließen oder sich umwandeln, während die zuvor isolierten Industrieregionen in eine nationale und sogar internationale Wirtschaft integriert wurden. Die Industrielandschaft wurde neu gestaltet, wobei Gebiete mit bevorzugtem Zugang zur neuen Verkehrsinfrastruktur bevorzugt wurden, und legte den Grundstein für die Globalisierung der Märkte, wie wir sie heute kennen.
Soziale Bedingungen in Bezug auf die Beschäftigung[modifier | modifier le wikicode]
Die Industrielle Revolution brachte tiefgreifende Veränderungen in der Sozialstruktur mit sich, vor allem durch die Bewegung der Bevölkerung vom Land in die Städte. Diese massive Umsiedlung war größtenteils auf die Einhegungen beispielsweise in England zurückzuführen, die viele Bauern von ihrem angestammten Land vertrieben, sowie auf die Umgestaltung der Landwirtschaft, die den Bedarf an Arbeitskräften verringerte. Landlose Bauern und solche, die aufgrund der Einführung neuer landwirtschaftlicher Methoden oder der Mechanisierung ihre Lebensgrundlage verloren hatten, suchten plötzlich Arbeit in den Städten, wo die aufstrebenden Industriebetriebe Arbeitskräfte benötigten. Diese Migration war nicht durch die Verlockung einer sozialen Verbesserung motiviert, sondern durch die Notwendigkeit. Die Arbeitsplätze in der Industrie boten oftmals niedrige Löhne und schwierige Arbeitsbedingungen. Das Fehlen einer Sozialgesetzgebung zu dieser Zeit bedeutete, dass die Arbeitnehmer kaum geschützt waren: Sie arbeiteten viele Stunden unter gefährlichen und unhygienischen Bedingungen, ohne Arbeitsplatzsicherheit, Versicherung gegen Arbeitsunfälle und ohne Rentenansprüche. Historiker sprechen in dieser Zeit oft von "negativer sozialer Fluidität", um das Phänomen zu beschreiben, dass die Menschen nicht die soziale Leiter hinaufkletterten, sondern vielmehr in ein unsicheres und oft ausbeuterisches Arbeitsumfeld hineingezogen wurden. Trotzdem war die Fabrikarbeit für viele die einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, auch wenn dies bedeutete, harte Bedingungen zu ertragen. Erst nach und nach, oft als Folge von Krisen, gewerkschaftlichen Kämpfen und politischem Druck, begannen die Regierungen, Gesetze zum Schutz der Arbeiter einzuführen. Die ersten Gesetze zu Kinderarbeit, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Sicherheit legten den Grundstein für die Sozialschutzsysteme, die wir heute kennen. Doch diese Veränderungen brauchten Zeit und viele Menschen mussten leiden, bevor diese Schutzmaßnahmen eingeführt werden konnten.
Die Arbeitsbedingungen während der industriellen Revolution spiegelten die damalige Marktdynamik wider, bei der das Überangebot an Arbeitskräften es den Arbeitgebern ermöglichte, sehr niedrige Löhne durchzusetzen. Frauen und Kinder wurden häufig beschäftigt, weil sie eine noch billigere Arbeitskraft als erwachsene Männer darstellten und weil sie im Allgemeinen weniger geneigt waren, sich gewerkschaftlich zu organisieren und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Diese Gruppen erhielten oft nur einen Bruchteil des Lohns erwachsener Männer, was die Gewinnspanne der Unternehmen weiter erhöhte. In diesem Zusammenhang war der den Arbeitern gezahlte Lohn oft nur das Existenzminimum, das nach dem berechnet wurde, was für das Überleben des Arbeiters und seiner Familie unbedingt notwendig war. Dieser Ansatz, der manchmal als "Subsistenzlohn" beschrieben wird, ließ kaum Raum für persönliche Ersparnisse oder die Verbesserung des Lebensstandards. Das Fehlen von Regulierungen und sozialen Absicherungen hatte zur direkten Folge, dass ein System entstand, in dem niedrigere Löhne als Hebel zur Erhöhung der Gewinnspannen eingesetzt werden konnten. Die Unternehmer der industriellen Revolution, die oft für ihren Einfallsreichtum und ihren Unternehmergeist gelobt wurden, profitierten ebenfalls von einem System, in dem die Produktionskosten auf Kosten des Wohlergehens der Arbeitnehmer gedrückt werden konnten. Die Tatsache, dass die Gewinne nicht geteilt werden mussten, bedeutete, dass die Fabrikbesitzer einen größeren Teil ihrer Gewinne in die Expansion ihrer Unternehmen, den Kauf neuer Maschinen und die Verbesserung der Produktionsprozesse reinvestieren konnten. Dies trug zweifellos zur Beschleunigung der Industrialisierung und zum allgemeinen Wirtschaftswachstum bei, aber dieses Wachstum kam zu hohen sozialen Kosten. Es bedurfte jahrzehntelanger Kämpfe der Arbeitnehmer, sozialer Aktivisten und Gesetzesreformen, um damit zu beginnen, ein ausgewogeneres und gerechteres Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Arbeitnehmer Schutz genießen und einen gerechteren Anteil an den Früchten des Wirtschaftswachstums erhalten.
Die Industrialisierung, insbesondere in ihren frühen Phasen, profitierte erheblich von der Beteiligung von Frauen- und Kinderarbeitern, oft unter Bedingungen, die heute als inakzeptabel gelten würden. Die Textilindustrie beispielsweise stellte massiv Frauen und Kinder ein, zum Teil weil die neu erfundenen Maschinen weniger Körperkraft erforderten als die früheren manuellen Produktionsmethoden. Geschicklichkeit und Präzision wurden wichtiger als rohe Kraft, und diese Eigenschaften wurden oft mit weiblichen Arbeitern in Verbindung gebracht. Außerdem konnten die Arbeitgeber Frauen und Kindern weniger bezahlen als Männern und so ihre Gewinne steigern. Im Kontext der damaligen Zeit war die Kinderarbeit zu Beginn der industriellen Revolution nicht geregelt. Kinder wurden häufig für gefährliche Arbeiten oder in engen Räumen eingesetzt, in denen Erwachsene nicht ohne Weiteres arbeiten konnten. Ihre Löhne waren im Vergleich zu denen der erwachsenen Männer lächerlich gering, oft bis zu zehnmal niedriger. Dies stärkte die vorteilhafte Position der Arbeitgeber: Die Fülle an verfügbaren Arbeitskräften drückte die Löhne insgesamt und erhöhte den Wettbewerb um Arbeitsplätze, was zu einer unsicheren Lage der Arbeitnehmer beitrug. Frauen erhielten für die gleiche Arbeit etwa ein Drittel des Lohns von Männern, eine Diskrepanz, die die sozialen Normen der damaligen Zeit widerspiegelte, in der Frauenarbeit oft als weniger wertvoll angesehen wurde. Diese Ausbeutung von Frauen- und Kinderarbeit wird heute als eine der dunkelsten Perioden der westlichen Geschichte angesehen und führte zur Entstehung der ersten Gesetze gegen Kinderarbeit und zu einer kritischeren Betrachtung der Arbeitsbedingungen in den aufkommenden Industrien. Während die Industrialisierung also große wirtschaftliche und technische Fortschritte mit sich brachte, unterstrich sie auch die Notwendigkeit von Vorschriften, um die schwächsten Arbeitnehmer vor Ausbeutung zu schützen. Die sozialen Bewegungen und Reformen, die darauf folgten, waren von der Erkenntnis getrieben, dass wirtschaftlicher Fortschritt nicht auf Kosten der Würde und Gesundheit des Einzelnen gehen sollte.
Die Vielfalt der Managementpraktiken unter den Arbeitgebern zur Zeit der industriellen Revolution spiegelte die unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichen Haltungen wider. Auf der einen Seite entschieden sich einige Arbeitgeber, die vor allem durch Gewinnmaximierung motiviert waren, dafür, Frauen und Kinder einzustellen, die weit weniger als Männer bezahlt werden konnten. Diese Strategie der Kostensenkung ermöglichte es ihnen, wettbewerbsfähigere Preise anzubieten und höhere Gewinne zu erzielen. Die Arbeitsbedingungen in diesen Unternehmen waren oft sehr hart und das Wohlergehen der Beschäftigten stand in der Regel nicht im Vordergrund. Auf der anderen Seite gab es Chefs, die einen eher paternalistischen Ansatz verfolgten. Sie konnten sich dafür entscheiden, nur Männer einzustellen, teilweise aufgrund des weit verbreiteten Glaubens, dass es die Aufgabe des Mannes sei, für die Familie zu sorgen. Diese Arbeitgeber konnten sich als verantwortlich für das Wohlergehen ihrer Angestellten betrachten, oft indem sie Wohnungen, Schulen oder medizinische Dienste zur Verfügung stellten. Dieser Ansatz war zwar humaner, aber auch eine Möglichkeit, sich stabile und engagierte Arbeitskräfte zu sichern. In Unternehmen, in denen diese paternalistische Mentalität vorherrschte, konnte es ein Gefühl der moralischen Verpflichtung oder eine wahrgenommene soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern geben. Diese Unternehmer konnten glauben, dass es nicht nur gut für das Geschäft war, sich um ihre Arbeiter zu kümmern, indem sie eine produktive und loyale Belegschaft aufrechterhielten, sondern auch eine Pflicht gegenüber der Gesellschaft. Diese beiden Ansätze spiegeln die komplexen und oft widersprüchlichen Einstellungen der damaligen Zeit gegenüber der Arbeit und der Gesellschaft wider. Während die Arbeitsbedingungen für Frauen und Kinder in den Fabriken oft hart und gefährlich waren, begannen die ersten Arbeitsgesetze, wie der Factory Act von 1833 in Großbritannien, der Ausbeutung der schwächsten Arbeiter Grenzen zu setzen. Diese Reformen waren der Beginn eines langen Prozesses zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der noch lange nach dem Ende der industriellen Revolution fortgesetzt werden sollte.
Die Einfachheit der Technik[modifier | modifier le wikicode]
Die Anpassung der Fähigkeiten der Arbeitnehmer in der ersten Phase der industriellen Revolution war aus mehreren Gründen relativ einfach. Zunächst einmal unterschieden sich die frühen industriellen Technologien nicht grundlegend von denen, die in der Protoindustrie oder in Handwerksbetrieben verwendet wurden. Maschinen wie der mechanische Webstuhl waren schneller und effizienter als ihre manuellen Vorgänger, aber die Grundprinzipien des Arbeitsablaufs waren ähnlich. So konnten Bauern und Handwerker, die bereits über Fähigkeiten in der Handarbeit verfügten, ohne große Schwierigkeiten auf die neu entstehende Industrie umstellen. Darüber hinaus ermöglichte das relativ einfache Design der ersten Industriemaschinen ihren Nachbau durch diejenigen, die in die Industrie einsteigen oder ihre Produktion ausweiten wollten, ohne dass ein komplexer Wissenstransfer erforderlich war. Was damals als mangelnder Schutz des geistigen Eigentums angesehen werden konnte, förderte in Wirklichkeit die schnelle Verbreitung technologischer Innovationen und das Wachstum neuer Industrien. Allerdings hatte dieser leichte Zugang zu den ursprünglichen industriellen Fähigkeiten auch soziale und bildungspolitische Implikationen. Im weitgehend analphabetischen England des Jahres 1830 wurde Bildung für die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung noch nicht als wesentlich angesehen. Mangelnde Bildung trug zu einer Arbeiterschaft bei, die als wendiger und weniger anfällig dafür angesehen wurde, Autoritäten in Frage zu stellen oder bessere Löhne oder Arbeitsbedingungen zu fordern. Einige Industrielle und Wirtschaftslobbys sahen in der Massenbildung eine potenzielle Bedrohung für diesen Zustand, da eine besser gebildete Bevölkerung sich ihrer Rechte bewusster werden und höhere soziale und wirtschaftliche Ansprüche stellen könnte. Erst viel später, mit dem Aufstieg komplexerer Technologien wie der Dampfmaschine und der Feinmechanik, wurde die Ausbildung von Arbeitskräften notwendiger und spezialisierter, was zu einer Aufwertung der technischen Bildung führte. Dies war auch der Beginn einer veränderten Einstellung gegenüber der Bildung von Arbeitern, da Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse zunehmend notwendig wurden, um die komplexen Maschinen des fortgeschrittenen Industriezeitalters zu bedienen und zu warten. Die Einführung der obligatorischen Grundschulbildung im Jahr 1880 in England war ein Wendepunkt und erkannte schließlich die Bedeutung der Bildung für die individuelle Entwicklung und das Wirtschaftswachstum an. Sie markierte den Beginn der Erkenntnis, dass Bildung eine Rolle bei der Verbesserung der Lebensbedingungen der arbeitenden Klassen und bei der Förderung der sozialen Mobilität spielen konnte und sollte.
Die Industrielle Revolution markierte eine radikale Veränderung der sozioökonomischen Struktur in Europa und darüber hinaus. Denn nach Jahrhunderten, in denen die Mehrheit der Bevölkerung in Agrargesellschaften lebte, die von den natürlichen Zyklen und der landwirtschaftlichen Produktion abhängig waren, leitete dieses neue Paradigma einen drastischen Wandel ein. Der technologische Fortschritt, der Aufschwung des Unternehmertums, der Zugang zu neuen Formen von Kapital und die Erschließung von Energieressourcen wie Kohle und später Öl waren die treibenden Kräfte hinter diesem Umbruch. Die Dampfmaschine, Innovationen bei Fertigungsverfahren wie der Stahlherstellung, die Automatisierung der Textilproduktion und das Aufkommen der Eisenbahn spielten alle eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Industrialisierung. Diese Zeit des raschen Wandels wurde auch durch ein anhaltendes Bevölkerungswachstum angetrieben, das sowohl einen Markt für neue Produkte als auch reichlich Arbeitskräfte für die Fabriken bereitstellte. Die Entwicklung der Städte war spektakulär und lockte die Landbevölkerung mit dem Versprechen von Arbeitsplätzen und besseren Lebensbedingungen an, obwohl dieses Versprechen oft nicht eingehalten wurde, was zu schwierigen städtischen Lebensbedingungen führte. Die Wirtschaft begann, sich auf die industrielle Produktion statt auf die Landwirtschaft zu spezialisieren, und der internationale Handel entwickelte sich, um diese neuen Industrien zu unterstützen und zu erweitern. Die Nationalstaaten begannen, in die Infrastruktur zu investieren und die Wirtschaft zu regulieren, um die Industrialisierung zu fördern. Auch der soziale Kontext veränderte sich. Alte Hierarchien wurden in Frage gestellt und neue soziale Klassen entstanden, darunter eine industrielle Bourgeoisie und eine proletarische Arbeiterklasse. Diese Veränderungen legten den Grundstein für die modernen Gesellschaften mit ihren eigenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Der Übergang von Agrar- zu Industriegesellschaften war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Er brachte soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten mit sich, oftmals schlechte Arbeitsbedingungen und hatte erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, die bis heute nachwirken. Trotzdem ist die Dynamik, die durch die Industrielle Revolution in Gang gesetzt wurde, der Grund für das beispiellose Wirtschaftswachstum und die technologische Entwicklung, die die heutige Welt geprägt haben.