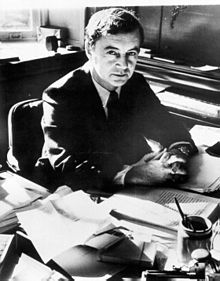Interaktionismus und Konstruktivismus
Das soziale Denken von Émile Durkheim und Pierre Bourdieu ● Zu den Ursprüngen des Untergangs der Weimarer Republik ● Das soziale Denken von Max Weber und Vilfredo Pareto ● Der Begriff des "Konzepts" in den Sozialwissenschaften ● Geschichte der Disziplin Politikwissenschaft: Theorien und Konzepte ● Marxismus und Strukturalismus ● Funktionalismus und Systemismus ● Interaktionismus und Konstruktivismus ● Die Theorien der politischen Anthropologie ● Die Debatte der drei I: Interessen, Institutionen und Ideen ● Die Theorie der rationalen Wahl und die Interessenanalyse in der Politikwissenschaft ● Analytischer Ansatz der Institutionen in der Politikwissenschaft ● Die Untersuchung von Ideen und Ideologien in der Politikwissenschaft ● Theorien des Krieges in der Politikwissenschaft ● Der Krieg: Konzeptionen und Entwicklungen ● Die Staatsraison ● Staat, Souveränität, Globalisierung, Multi-Level-Governance ● Gewalttheorien in der Politikwissenschaft ● Welfare State und Biomacht ● Analyse demokratischer Regime und Demokratisierungsprozesse ● Wahlsysteme: Mechanismen, Herausforderungen und Konsequenzen ● Das Regierungssystem der Demokratien ● Morphologie der Anfechtungen ● Handlung in der politischen Theorie ● Einführung in die Schweizer Politik ● Einführung in das politische Verhalten ● Analyse der öffentlichen Politik: Definition und Zyklus einer öffentlichen Politik ● Analyse der öffentlichen Politik: Agendasetzung und Formulierung ● Analyse der öffentlichen Politik: Umsetzung und Bewertung ● Einführung in die Unterdisziplin Internationale Beziehungen ● Einführung in die politische Theorie
Interaktionismus und Konstruktivismus sind zwei zentrale theoretische Rahmen, die unser Verständnis von Dynamiken in der Politikwissenschaft bereichern.
Der Interaktionismus ist eine Theorie, die den Schwerpunkt auf die Beziehungen zwischen Individuen legt, um politisches Verhalten zu entschlüsseln. Sie postuliert, dass Individuen nicht einfach das Produkt ihrer Umwelt oder sozialer Strukturen sind, sondern dass sie durch ihre Interaktionen eine aktive Rolle bei der Bildung und Veränderung dieser Strukturen spielen. Im politischen Kontext kann der Interaktionismus helfen zu analysieren, wie Politiker, Bürokraten und Wähler interagieren und wie diese Interaktionen die öffentliche Politik und die Wahlergebnisse bestimmen.
Auf der anderen Seite konzentriert sich der Konstruktivismus darauf, wie politische Akteure ihre Ideen und Überzeugungen nutzen, um ihre soziale und politische Realität zu konstruieren. Nach diesem Ansatz sind politische und soziale Strukturen nicht vorgegeben, sondern werden vielmehr von den politischen Akteuren durch ihre Reden, Ideen und Handlungen konstruiert. Im Bereich der Politikwissenschaft wird mithilfe des Konstruktivismus untersucht, wie die Überzeugungen und Ideen der politischen Akteure die politischen Strukturen und die öffentliche Politik prägen.
Diese beiden theoretischen Rahmen können gemeinsam für ein tieferes Verständnis der Politik verwendet werden. Beispielsweise kann mithilfe des Interaktionismus untersucht werden, wie politische Akteure bei der Gestaltung von Politik zusammenarbeiten, während mithilfe des Konstruktivismus analysiert werden kann, wie diese Politik von den Ideen und Überzeugungen dieser Akteure beeinflusst wird.
Die Ansätze Interaktionismus und Konstruktivismus[modifier | modifier le wikicode]
Interaktionismus und Konstruktivismus sind zwei wesentliche theoretische Rahmen, die aus unterschiedlichen Produktionskontexten hervorgegangen sind und unser Verständnis von sozialen und politischen Prozessen geprägt haben.
Interaktionismus[modifier | modifier le wikicode]
Der Interaktionismus, insbesondere der symbolische Interaktionismus, hat seine Wurzeln in der Chicagoer Schule zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die schnellen und massiven Veränderungen, die die Stadt Chicago zu dieser Zeit erlebte, bildeten den Hintergrund für die Entwicklung dieses theoretischen Ansatzes.
Chicago entwickelte sich in nur wenigen Jahrzehnten von einer Kleinstadt zu einer blühenden Metropole mit einer Bevölkerung, die aufgrund von Einwanderung und Binnenmigration explosionsartig anstieg. Dies führte zu tiefgreifenden Veränderungen in der sozialen und räumlichen Struktur der Stadt. Neuankömmlinge mit unterschiedlichem ethnischem und kulturellem Hintergrund ließen sich in separaten Stadtvierteln nieder und schufen so ein Mosaik aus kulturellen Gemeinschaften in der Stadt. Angesichts dieser Veränderungen versuchten die Soziologen der Chicagoer Schule zu verstehen, wie Einzelpersonen und Gruppen in diesen neuen städtischen Umgebungen interagieren. Sie begannen, interaktionistische Theorien zu entwickeln, die die Rolle sozialer Interaktionen bei der Bildung individueller und kollektiver Identität, dem Aufbau von Gemeinschaften und der Schaffung sozialer Ordnung betonten. Die Soziologen der Chicagoer Schule, wie Robert E. Park, Ernest Burgess und Herbert Blumer, spielten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Interaktionismus. Sie legten den Schwerpunkt auf die direkte Beobachtung sozialer Interaktionen und setzten innovative Forschungsmethoden wie die ethnografische Studie und die teilnehmende Beobachtung ein, um die sozialen Interaktionen in der sich schnell verändernden Metropole zu untersuchen.
Der Interaktionismus entstand also aus dem Bemühen, die sozialen und räumlichen Veränderungen zu verstehen, die sich in einer sich schnell verändernden Metropole vollziehen. Er ist weiterhin ein zentraler theoretischer Ansatz in der Soziologie und Politikwissenschaft und hilft zu erklären, wie soziale Interaktionen Einzelpersonen, Gruppen und die Gesellschaft als Ganzes prägen.
Die Soziologen der Chicagoer Schule gehörten zu den ersten, die sich frontal mit diesen komplexen und miteinander verknüpften Herausforderungen auseinandersetzten. Ihre Arbeiten zeigten die Schwierigkeiten bei der sozialen, beruflichen und kulturellen Integration auf, mit denen Neuankömmlinge in der Stadt konfrontiert waren. Sie beobachteten, wie diese Herausforderungen zu einer Ethnisierung der Stadt führten, bei der sich die verschiedenen ethnischen Gruppen in getrennten Vierteln niederließen und ein komplexes "ethnisches Mosaik" schufen. Sie untersuchten auch die Entstehung von sozialer Marginalität, einschließlich Kriminalität und Delinquenz, in diesem sich wandelnden städtischen Kontext. Phänomene der Marginalität und der sozialen Devianz, wie Banden und organisierte Kriminalität, waren für diese Soziologen ein wichtiges Anliegen. Sie wollten verstehen, warum sich bestimmte Einzelpersonen und Gruppen für illegale Aktivitäten entscheiden und wie diese Entscheidungen von ihrem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld geprägt werden. Besonders einflussreich war die Arbeit der Chicagoer Schule zum Thema soziale Devianz. Forscher wie Clifford R. Shaw und Henry D. McKay entwickelten die Theorie der sozialen Desorganisation, die darauf hindeutet, dass Kriminalität hauptsächlich das Ergebnis des Zerfalls traditioneller sozialer Institutionen in benachteiligten städtischen Gebieten ist. Diese Theorie hat die Art und Weise, wie wir heute Kriminalität und Devianz verstehen, stark beeinflusst. Die Soziologen der Chicagoer Schule leisteten Pionierarbeit bei der Untersuchung städtischer Phänomene und sozialer Probleme, die mit der raschen Urbanisierung und Industrialisierung einhergehen. Ihr interaktionistischer Ansatz ebnete den Weg für ein differenzierteres Verständnis davon, wie Einzelpersonen und Gruppen mit ihrem sozialen Umfeld interagieren und wie diese Interaktionen ihre Erfahrungen und Verhaltensweisen prägen.
Der Interaktionismus, wie er von der Chicagoer Schule konzeptualisiert wurde, stellt die Interaktion in den Mittelpunkt der sozialen Erfahrung. Dieser Ansatz betont die Vorstellung, dass individuelles Verhalten durch die Interaktion und den Austausch mit anderen geprägt wird. Mit anderen Worten: Individuen handeln nicht isoliert, sondern sind ständig in einen Prozess der Interaktion mit den Menschen um sie herum eingebunden. Aus dieser Perspektive ist die Gesellschaft nicht einfach eine Ansammlung starrer Strukturen, die das Verhalten der Individuen bestimmen, sondern ein dynamisches Netzwerk sozialer Interaktionen. Die Individuen sind nicht einfach passive Empfänger sozialer Normen, sondern spielen durch ihre Interaktionen eine aktive Rolle bei der Schaffung und Veränderung dieser Normen. Das bedeutet, dass wir, um das Verhalten von Individuen zu verstehen, die Art der Interaktionen untersuchen müssen, in die sie involviert sind. Wie interagieren Individuen zum Beispiel in verschiedenen Kontexten wie Familie, Arbeit, Schule usw.? Wie beeinflussen diese Interaktionen ihre Überzeugungen, Einstellungen und Verhaltensweisen? Und wie tragen diese Interaktionen zur Schaffung und Veränderung von sozialen Strukturen bei? Darüber hinaus argumentiert der Interaktionismus, dass alle menschlichen Beziehungen eine Form des Austauschs oder der Interaktion beinhalten, unabhängig davon, ob diese verbal oder nonverbal, formell oder informell, positiv oder negativ ist. Daher bietet der Interaktionismus einen wertvollen Rahmen für die Untersuchung sozialer Phänomene, die von alltäglichen Interaktionen zwischen Menschen bis hin zu umfassenderen Prozessen des sozialen und politischen Wandels reichen.
Der Interaktionismus betont, dass das Verhalten eines Individuums zutiefst von seinen Interaktionen mit anderen beeinflusst wird und dass es nicht isoliert von seinem sozialen Kontext existiert. Diese Perspektive betont, dass das Verhalten niemals statisch oder konstant ist, sondern sich durch soziale Interaktionen stets verändert. Darin unterscheidet sich der Interaktionismus von der funktionalistischen Theorie. Der Funktionalismus konzentriert sich auf die Art und Weise, wie die verschiedenen Teile der Gesellschaft zusammenarbeiten, um Gleichgewicht und Harmonie aufrechtzuerhalten, und neigt dazu, das Verhalten des Einzelnen als weitgehend durch die funktionale Rolle bestimmt zu sehen, die er in der Gesellschaft spielt. Diese Perspektive kann manchmal dafür kritisiert werden, dass sie Machtdynamiken, Konflikte und sozialen Wandel nicht berücksichtigt. Im Gegensatz dazu betont der Interaktionismus die Art und Weise, wie Individuen ihre sozialen Rollen durch die Interaktion mit anderen aushandeln, interpretieren und anfechten. Er betont die Komplexität und Dynamik des menschlichen Verhaltens und nicht dessen Übereinstimmung mit vorgegebenen funktionalen Normen. Darüber hinaus sieht der Interaktionismus die Gesellschaft nicht als eine starre Struktur, sondern als einen sich ständig verändernden Prozess, der durch menschliche Interaktionen geformt wird. Somit bietet der Interaktionismus eine differenziertere und dynamischere Perspektive auf das menschliche Verhalten und die Gesellschaft. Er betont die aktive Rolle der Menschen bei der Schaffung und Veränderung ihrer sozialen Realität und wie Verhaltensweisen durch die Interaktion und den Austausch mit anderen geprägt werden.
Es gibt vier Prinzipien bei der Interaktion :
- Interaktionseinheiten: Der Interaktionismus erkennt an, dass Interaktionen zwischen Einzelpersonen (interpersonelle Interaktion) oder Gruppen (Gruppeninteraktion) stattfinden können. Diese Interaktionseinheiten sind die grundlegenden Akteure der Gesellschaft.
- Interaktionsregeln: Interaktionen werden durch Regeln gesteuert, die explizit (wie Gesetze oder Vorschriften) oder implizit (wie ungeschriebene soziale Normen) sein können. Diese Regeln helfen dabei, die Interaktionen zu strukturieren und dem Verhalten einen Sinn zu verleihen.
- Geordneter Prozess: Der Interaktionismus sieht soziale Interaktionen als einen geordneten Prozess. Das bedeutet, dass die Interaktionen bestimmten Sequenzen und Mustern folgen, die analysiert und verstanden werden können. Beispielsweise wurde der Interaktionismus verwendet, um Phänomene wie Gewalt zu untersuchen, indem man sie in ihren spezifischen Interaktionskontext einordnet.
- Austausch: Der Interaktionismus betont die Idee, dass soziale Interaktionen grundsätzlich auf Austausch beruhen. Dies kann ein Austausch von Waren oder Dienstleistungen, aber auch von Informationen, Gefühlen, Ideen usw. sein. Dies unterstreicht den wechselseitigen und sich gegenseitig beeinflussenden Charakter sozialer Interaktionen.
Diese Prinzipien bieten einen Rahmen, um zu verstehen, wie Einzelpersonen und Gruppen miteinander interagieren, wie diese Interaktionen strukturiert und reguliert werden und wie sie zur Schaffung und zum Wandel der Gesellschaft beitragen.
Der Konstruktivismus[modifier | modifier le wikicode]
Der Konstruktivismus, der seinen Aufschwung in den 1960er und 1970er Jahren erlebte, ist eine Denkrichtung, die viele Bereiche wie Soziologie, Philosophie, Anthropologie und Linguistik tiefgreifend beeinflusst hat. Der Konstruktivismus basiert auf der Vorstellung, dass Wissen nicht einfach entdeckt wird, sondern vom Einzelnen oder der Gesellschaft aktiv konstruiert wird. Jean Piaget, ein berühmter Schweizer Psychologe, ist eine Schlüsselfigur des Konstruktivismus, auch wenn seine Arbeit in der Regel der Entwicklungspsychologie zugeordnet wird. Piaget schlug vor, dass Kinder ihr Verständnis der Welt durch die Interaktion mit ihrer Umwelt aktiv aufbauen. Seiner Theorie zufolge vollzieht sich die kognitive Entwicklung durch eine Reihe von Stadien, wobei jedes Stadium eine komplexere und anspruchsvollere Ebene des Weltverständnisses darstellt. Im Bereich der Linguistik sah Piaget die Sprache als ein soziales und kognitives Konstrukt. Seiner Ansicht nach erwerben Kinder Sprache nicht einfach durch das Auswendiglernen von Wörtern und Regeln, sondern indem sie ihr Sprachverständnis durch die Interaktion mit anderen aktiv aufbauen. Dies spiegelt den allgemeinen Ansatz des Konstruktivismus wider, der die Interaktion und den aktiven Aufbau von Wissen betont.
Die grundlegende Prämisse des Konstruktivismus ist, dass Wissen keine statische Ansammlung von Fakten ist, die darauf wartet, entdeckt zu werden, sondern dass es aktiv von Einzelpersonen und Gruppen konstruiert wird. Das bedeutet, dass Wissen nicht einfach etwas ist, das wir haben, sondern etwas, das wir tun. Jede neue Information oder Erfahrung wird in unsere bestehende Wissensbasis integriert, wodurch unser Verständnis der Welt verändert und erweitert wird. Aus dieser Perspektive ist die Realität keine von uns unabhängige objektive Entität, sondern wird durch unsere Interaktionen mit der Welt und mit anderen ständig konstruiert und rekonstruiert. Das bedeutet, dass sich unser Wissen über die Welt immer weiterentwickelt, immer "konstruiert" wird. Darüber hinaus erkennt der Konstruktivismus an, dass unser Wissen über die Welt immer von unserem sozialen und kulturellen Kontext beeinflusst wird. Unsere Überzeugungen, Werte, Erfahrungen und Interaktionen mit anderen spielen alle eine Rolle dabei, wie wir unser Wissen über die Welt konstruieren. Aus diesem Grund wird der Konstruktivismus häufig mit methodischen Ansätzen in Verbindung gebracht, die den Schwerpunkt auf die Erforschung der Wahrnehmungen, Interpretationen und Erfahrungen von Individuen legen, wie z. B. Fallstudien, Ethnografie oder narrative Analyse. Diese Methoden zielen darauf ab, zu verstehen, wie Einzelpersonen und Gruppen ihr Wissen über die Welt konstruieren und wie dieses Wissen ihr Verhalten und ihre Interaktionen beeinflusst.
Der Konstruktivismus vertritt die Ansicht, dass unser Verständnis der Realität sozial konstruiert und nicht objektiv beobachtet ist. Die Realität, wie wir sie kennen, wird von unseren Wissenssystemen geformt, die ihrerseits von sozialen Normen, Werten und Praktiken beeinflusst werden. Die Realität wird nicht direkt wahrgenommen, sondern durch diese sozialen Konstruktionen interpretiert. Daher müssen wir laut Konstruktivismus, um die Realität wirklich zu verstehen, die Prozesse verstehen, durch die sie konstruiert wird. Das bedeutet, dass wir die Wissenssysteme - Wissenschaften, Normen, Regeln, Ideologien usw. - untersuchen müssen. - die unsere Wahrnehmung und Interpretation der Welt prägen. Das bedeutet eine Analyse auf einer "zweiten Ebene": Wir müssen nicht nur die Realität untersuchen, wie sie konstruiert wird, sondern auch die Konstruktionsprozesse selbst. Aus dieser Perspektive ist Wissen niemals neutral oder objektiv, sondern wird immer von dem sozialen und kulturellen Kontext beeinflusst, in dem es produziert wird. Dies unterstreicht die grundlegend subjektive Natur von Wissen und Realität. Der Konstruktivismus hat wichtige Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir in vielen Bereichen - von der Soziologie über die Politik bis hin zu Bildung und Psychologie - an Forschung und Praxis herangehen. Er erinnert uns daran, dass unsere Wahrnehmungen und Interpretationen der Welt immer durch unseren sozialen und kulturellen Kontext geprägt werden und dass die Realität immer eine Konstruktion und niemals ein Faktum ist.
Konstruktivistische Theoretiker argumentieren, dass die Realität im Laufe der Zeit von einer Vielzahl von Akteuren in einer bestimmten Gesellschaft konstruiert wird. Dies ist ein kollektiver und komplexer Prozess, der zahlreiche Interaktionen und Verhandlungen zwischen Einzelpersonen und Gruppen beinhaltet. Der Konstruktivismus konzentriert sich auf die Analyse sozialer Strukturen und nicht auf Einzelpersonen. Er untersucht, wie soziale Ideen, Normen, Werte, Überzeugungen und Praktiken unser Verständnis der Realität prägen. Im Bereich der Politik können Konstruktivisten zum Beispiel analysieren, wie politische Ideen und Ideologien die Gestaltung der öffentlichen Politik beeinflussen. Darüber hinaus erkennen Konstruktivisten an, dass soziale Konstruktionen der Realität eine Zwangsmacht besitzen. Mit anderen Worten: Sie strukturieren unser Denken und Verhalten und drängen uns dazu, uns ihnen anzupassen. Beispielsweise können soziale und kulturelle Normen dazu führen, dass wir uns verpflichtet fühlen, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln, auch wenn wir persönlich nicht mit diesen Normen übereinstimmen. Der Konstruktivismus erkennt jedoch auch an, dass soziale Konstruktionen der Realität angefochten und verändert werden können. Einzelpersonen und Gruppen können sich sozialen Normen widersetzen, vorherrschende Ideen in Frage stellen und neue Wege vorschlagen, um die Welt zu verstehen und zu interpretieren. Folglich bietet der Konstruktivismus eine dynamische und flexible Perspektive auf die soziale Realität, die sowohl ihre Stabilität als auch ihr Veränderungspotenzial betont.
Der Konstruktivismus bietet wertvolle Werkzeuge für die Analyse und den Vergleich von Realitäten, die in verschiedenen Kontexten konstruiert werden. Zwei wichtige Dimensionen des Konstruktivismus sind :
- Vergleich der konstruierten Realitäten : Der Konstruktivismus erkennt an, dass verschiedene Gesellschaften unterschiedliche Realitäten konstruieren können. Daher kann ein konstruktivistischer Ansatz den Vergleich dieser verschiedenen konstruierten Realitäten beinhalten. Wie unterscheiden sich beispielsweise Normen und Werte zwischen verschiedenen Gesellschaften? Wie beeinflussen diese Unterschiede das Verhalten und die Einstellungen der Menschen in diesen Gesellschaften?
- Internationale Beziehungen: Der Konstruktivismus hat einen bedeutenden Einfluss auf den Bereich der internationalen Beziehungen gehabt. Er bietet eine einzigartige Perspektive auf Fragen der Macht, des Konflikts und der Zusammenarbeit zwischen Nationen. Dem Konstruktivismus zufolge werden internationale Beziehungen nicht nur von materiellen Faktoren wie militärischer oder wirtschaftlicher Stärke beeinflusst, sondern auch von Ideen, Normen und Identitäten. Die konstruierten Realitäten der einzelnen Länder, die durch ihre spezifischen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Systeme geprägt werden, können miteinander in Konflikt geraten und zu internationalen Spannungen und Konflikten führen.
Diese beiden Dimensionen unterstreichen die Rolle der sozialen Konstruktion bei der Bildung unseres Verständnisses der Realität und wie diese Konstruktion zwischen verschiedenen Gesellschaften und internationalen Kontexten stark variieren kann.
Der Konstruktivismus fördert die Konzeptualisierung des Raums nicht als feste physische Entität, sondern als Produkt unserer sozialen und kulturellen Konstruktionen. Der Raum wird in dieser Perspektive als eine Reihe von "konstruierten Realitäten" gesehen, die von den Individuen und Gesellschaften, die sie bewohnen, geformt und definiert werden. Das bedeutet, dass unser Verständnis und unsere Erfahrung von Raum von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unsere Überzeugungen, Werte, sozialen Normen, politischen und wirtschaftlichen Systeme und unsere Interaktionen mit anderen. Beispielsweise kann ein städtischer Raum von verschiedenen Gruppen je nach sozioökonomischem Status, ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht usw. unterschiedlich wahrgenommen werden. Darüber hinaus können die Räume selbst als einflussreiche Akteure bei der Konstruktion unserer Realitäten betrachtet werden. Sie haben das Potenzial, unser Verhalten, unsere Einstellungen und unsere Interaktionen maßgeblich zu prägen. Beispielsweise können die Gestaltung einer Stadt, das Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Infrastrukturen, die Anordnung von Wohn- und Geschäftsvierteln usw. allesamt die Art und Weise beeinflussen, wie wir unsere Umgebungen erleben und interpretieren. So bietet der Konstruktivismus eine reiche und nuancierte Perspektive darauf, wie wir den Raum verstehen und mit ihm interagieren, und betont seine Rolle bei der Bildung unserer konstruierten Realitäten.
Interaktionisten und Konstruktivisten als kritische Alternativen zu funktionalistischen, strukturalistischen und systemischen Theorien[modifier | modifier le wikicode]
Interaktionistische und konstruktivistische Theorien bieten kritische Alternativen zu funktionalistischen, strukturalistischen und systemischen Theorien in der Politikwissenschaft und der Soziologie.
Der Interaktionismus mit seinem Fokus auf mikrosoziale Interaktionen und die Art und Weise, wie diese das Verhalten von Individuen und das Funktionieren der Gesellschaft prägen, bietet eine direkte Kritik am Funktionalismus. Der Funktionalismus neigt dazu, die Gesellschaft als ein organisiertes System zu betrachten, in dem jeder Teil eine bestimmte Funktion hat, die er zum Wohle des Ganzen erfüllen muss. Der Interaktionismus hingegen betont die Rolle der Individuen und ihrer Interaktionen bei der Strukturierung der Gesellschaft. Der Konstruktivismus bietet seinerseits eine Kritik an strukturalistischen und systemischen Ansätzen. Der Strukturalismus neigt dazu, die Gesellschaft als eine strukturierte Gesamtheit von Beziehungen wahrzunehmen, die das Verhalten der Individuen bestimmen. Der Konstruktivismus hingegen betont die Rolle von Individuen und Gruppen bei der Konstruktion ihrer sozialen Realität, einschließlich der sozialen Strukturen selbst. Ebenso steht der Konstruktivismus im Gegensatz zum Systemismus, der die Gesellschaft als ein System miteinander verbundener Elemente betrachtet, die miteinander interagieren. Der Konstruktivismus hingegen konzentriert sich mehr auf die Analyse spezifischer Fälle und darauf, wie soziale Realitäten konstruiert werden und sich im Laufe der Zeit verändern.
Beide Ansätze - Interaktionismus und Konstruktivismus - bieten somit eine dynamischere und flexiblere Sicht der Gesellschaft und betonen die aktive Rolle der Menschen bei der Gestaltung ihrer sozialen Realität.
Die interaktionistische Theorie[modifier | modifier le wikicode]
Die Ursprünge: Die Chicagoer Schule[modifier | modifier le wikicode]
In Chicago fanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeutende soziodemografische und wirtschaftliche Veränderungen statt. Die Stadt entwickelte sich rasch zu einer Metropole, was größtenteils auf die schnelle Industrialisierung und die Masseneinwanderung aus Europa und dem ländlichen Süden der USA zurückzuführen war. Der massive Zuzug dieser neuen Bewohner, die in der aufstrebenden Industrie nach Arbeitsplätzen suchten, führte zu einer raschen Expansion der Stadt. Sie verschärfte jedoch auch die Rassen- und ethnischen Spannungen, schuf prekäre Lebensbedingungen und führte zu einem Anstieg der Kriminalität. Neue Einwanderer ließen sich häufig in ethnisch homogenen Vierteln nieder, die manchmal auch als "Ghettos" bezeichnet werden und in denen die Lebensbedingungen oft schwierig waren. Die rassische und ethnische Segregation führte häufig zu Spannungen, die manchmal in Gewalt und Rassenunruhen ausarteten. Gleichzeitig trug der Mangel an wirtschaftlichen Chancen und Bildung für viele junge Menschen zu einem Anstieg der Jugendkriminalität bei. Ebenso haben Armut und Verzweiflung dazu geführt, dass einige Menschen sich der Prostitution als Lebensunterhalt zugewandt haben. All diese Faktoren führten zu einem angespannten sozialen Klima und stellten die städtischen Behörden und die damaligen Soziologen vor zahlreiche Herausforderungen, die diese Probleme verstehen und lösen wollten. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die Chicago School of Sociology, die einen interaktionistischen Ansatz zur Untersuchung dieser sozialen Phänomene verfolgte.
Jahrhunderts revolutionierte die Chicagoer Schule der Soziologie das Feld der Soziologie, indem sie den Fokus von strukturellen Faktoren und repressiven Reaktionen auf abweichendes Verhalten auf eine differenziertere Analyse sozialer Interaktionen und der Dynamik von Marginalität verlagerte. Indem sie sich auf marginalisierte und entwurzelte Gemeinschaften in der wachsenden Metropole Chicago konzentrierten, versuchten die Soziologen der Chicagoer Schule, die Motivationen, Rationalitäten und sozialen Interaktionen zu verstehen, die abweichendem Verhalten zugrunde liegen. Sie verfolgten einen empirischen Ansatz, der auf direkter Beobachtung und Feldforschung beruhte, was damals ein Novum in der Soziologie war. So hoben diese Forscher die Rolle sozialer Interaktionen bei der Entstehung abweichenden Verhaltens hervor und zeigten, dass dieses Verhalten nicht einfach das Ergebnis individueller Faktoren ist, sondern auch durch soziale Bedingungen und Interaktionen innerhalb der Gemeinschaft geprägt wird. Dies ebnete den Weg für ein tieferes und differenzierteres Verständnis von sozialer Devianz und legte den Grundstein für den interaktionistischen Ansatz in der Soziologie.
Die Chicago School of Sociology baute auf dem interaktionistischen Ansatz auf und stellte in ihrer Forschung mehrere wichtige Themen in den Vordergrund:
- Rassische und ethnische Minderheiten: Die Untersuchung von Minderheitengruppen hat dazu beigetragen, die Prozesse der Assimilation, Diskriminierung und Segregation sowie die Auswirkungen dieser Prozesse auf die Sozialstruktur und die Dynamiken zwischen den Gruppen zu verstehen.
- The marginal man: Dieses von Robert E. Park eingeführte Konzept beschreibt Individuen, die an der Grenze zweier Kulturen oder sozialer Gruppen leben und Schwierigkeiten haben, sich vollständig in die eine oder andere Kultur oder soziale Gruppe zu integrieren. Diese Marginalität kann zu Gefühlen der Entfremdung, Verwirrung und des Konflikts führen.
- Die Stadt: Die Verwandlung Chicagos in eine schnelle Metropole war ein beliebtes Studienfeld, um die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Prozesse zu verstehen, die in städtischen Gebieten stattfinden.
- Devianz: Die Soziologen der Chicagoer Schule gehörten zu den ersten, die Devianz nicht als isolierte Handlung, sondern als sozialen Prozess untersuchten, der von Interaktionen und der Dynamik der Gemeinschaft beeinflusst wird.
- Kriminalität und Delinquenz: Durch die Konzentration auf die kriminalitätsbelasteten Stadtteile Chicagos versuchten diese Forscher, die zugrunde liegenden Ursachen von Kriminalität und Delinquenz zu verstehen, wobei der Schwerpunkt eher auf sozialen und Umweltfaktoren als auf individuellen Dispositionen lag.
Diese Themen trugen wesentlich zum Verständnis der sozialen Dynamiken in städtischen Umgebungen bei und beeinflussten viele spätere Forschungen in der Soziologie und der Politikwissenschaft.
Die Arbeiten der Chicago School of Sociology über Minderheiten haben gezeigt, dass diese Gruppen als Reaktion auf die Herausforderungen des sozialen Umfelds häufig robuste Interaktionssysteme entwickeln. Diese Systeme, die gemeinsame Normen, Werte und Praktiken beinhalten, dienen sowohl als Verteidigungs- als auch als Schutzmechanismen gegen äußere Kräfte, insbesondere Diskriminierung und Ausgrenzung. Beispielsweise können sich Angehörige von Minderheiten in Einwanderungs- oder Marginalisierungskontexten zusammenschließen und Solidargemeinschaften bilden, um Widrigkeiten zu begegnen. Diese Gemeinschaften können um bestimmte gemeinsame Merkmale wie Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Sprache, Religion oder soziale Klasse herum organisiert sein. Diese Interaktionssysteme bieten nicht nur soziale und emotionale Unterstützung, sondern können auch die Anpassung und Integration des Einzelnen in die größere Gesellschaft erleichtern. Sie können den Mitgliedern der Gemeinschaft helfen, sich durch die Herausforderungen des Alltags zu navigieren, Zugang zu wertvollen Ressourcen zu erhalten und ihre kulturellen Identitäten zu bewahren. So haben die Arbeiten der Chicago School of Sociology gezeigt, dass Interaktionssysteme innerhalb von Minderheiten nicht nur Ausdruck von Solidarität und Widerstandsfähigkeit sind, sondern auch wesentliche Elemente für das Verständnis der Dynamik sozialer und politischer Beziehungen in städtischen Kontexten darstellen.
Zu den Schlüsselwörtern des Interaktionismus gehören :
- Sozialisation: Dieser Prozess bezeichnet die Art und Weise, wie Menschen die Normen, Werte und Verhaltensweisen ihrer Gesellschaft erlernen und internalisieren. Dies geschieht während des gesamten Lebens und prägt die Art und Weise, wie Menschen mit anderen interagieren und ihren Platz in der Gesellschaft verstehen.
- Symbolischer Interaktionismus: Diese Perspektive legt den Schwerpunkt auf die Schaffung sozialer Bedeutungen durch Interaktionen. Die Menschen stehen der Gesellschaft nicht einfach nur passiv gegenüber, sondern spielen eine aktive Rolle bei der Schaffung ihrer sozialen Realität durch ihre Interpretation von Symbolen und Zeichen.
- Teilnehmende Beobachtung: Diese Forschungsmethode beinhaltet, dass sich der Forscher aktiv in die Gemeinschaft oder Gruppe, die er untersucht, einbringt. Dies ermöglicht es dem Forscher, die Erfahrungen und Perspektiven der Teilnehmer von innen heraus zu verstehen.
- Sozialdarwinismus: Diese Theorie wendet Darwins Prinzipien der natürlichen Selektion auf die Gesellschaft an und legt nahe, dass diejenigen Individuen oder Gruppen, die am anpassungsfähigsten sind, erfolgreich sind, während andere scheitern.
- Funktionalismus: Diese Theorie betrachtet die Gesellschaft als ein komplexes System, in dem alle Teile zusammenarbeiten, um Stabilität und Harmonie zu gewährleisten. Jeder Teil hat eine bestimmte Funktion, die zum Funktionieren der Gesellschaft insgesamt beiträgt.
- Ethnomethodologie: Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Methoden, die Menschen in ihrem täglichen Leben anwenden, um ihre soziale Welt zu verstehen und sich darin zurechtzufinden.
- 'Urbane Ökologie: Diese Perspektive untersucht, wie die räumlichen und physischen Merkmale einer Stadt die sozialen Interaktionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen.
- Desorganisation: Dieser Begriff bezieht sich auf einen Bruch oder eine Verschlechterung der sozialen Ordnung, die oft durch schnelle Veränderungen oder Konflikte verursacht wird. Dies kann dazu führen, dass der Einfluss kollektiver Normen und Werte auf den Einzelnen abnimmt.
Erwin Goffman (1922-1982): Die Inszenierung des Alltagslebens[modifier | modifier le wikicode]
Erving Goffman ist ein bekannter Soziologe, der einen bedeutenden Beitrag zur Soziologie der Interaktion geleistet hat. Er wurde 1922 geboren und starb 1982. Besonders bekannt ist er für seine Arbeit über die "Inszenierung des Alltagslebens" und die Theorie des "sozialen Dramas". In "Die Inszenierung des Alltagslebens" verwendet Goffman die Metapher des Theaters, um zu beschreiben, wie Menschen sich selbst und anderen im Alltag präsentieren. Er spricht vom "Gesicht" (dem Selbstbild, das man anderen präsentiert), von "Rollen" (den Verhaltensweisen, die aufgrund sozialer Erwartungen erwartet werden) und von der "Bühne" (dem Kontext, in dem die Interaktion stattfindet). Laut Goffman "spielen" die Menschen ständig Rollen und passen ihr Verhalten an die Situation und die Erwartungen der anderen an. Er legt nahe, dass wir alle Schauspieler auf der "Bühne" des Alltags sind, verschiedene Rollen spielen und unsere "Auftritte" manipulieren, um die Eindrücke, die wir auf andere machen, zu steuern. Im Zusammenhang mit seiner Arbeit über psychiatrische Krankenhäuser untersuchte Goffman, wie Individuen durch diese Institutionen navigieren und wie Interaktionen und Verhaltensweisen durch den institutionellen Kontext geformt werden. Seine Arbeit enthüllte, wie Institutionen soziale Kontrolle über Individuen ausüben können und wie Individuen diesen Zwängen widerstehen oder sich ihnen anpassen. Diese Arbeit hat wesentlich zu unserem Verständnis beigetragen, wie soziale Interaktionen strukturiert sind und wie Individuen ihre Identität und ihre sozialen Leistungen steuern.
Erving Goffman, obwohl er oft mit dem symbolischen Interaktionismus in Verbindung gebracht wird, hat auch zur konstruktivistischen Theorie beigetragen. Der Konstruktivismus legt den Schwerpunkt darauf, wie Einzelpersonen und soziale Gruppen die Realität durch ihre Interaktionen und Darstellungen konstruieren und interpretieren.
Goffman argumentiert, dass die Realität durch die Vorstellungen, die wir uns von ihr machen, und durch die Vorstellungen, die wir mit anderen teilen, geformt wird. Seiner Meinung nach gibt es zwei Aspekte der Realität:
- Repräsentationen der Realität: Wir bilden Bilder, Ideen und Überzeugungen über die Realität aufgrund unserer persönlichen Erfahrungen und der Interaktion mit anderen. Diese Vorstellungen beeinflussen unser Verständnis der Welt und lenken unser Verhalten.
- Die Realität der Vorstellungen : Wenn Vorstellungen von der Realität von einer Gruppe oder Gesellschaft geteilt und akzeptiert werden, erlangen sie reale Kraft und wirken auf Einzelpersonen und soziale Interaktionen ein. Mit anderen Worten: Kollektive Vorstellungen werden zu einer sozialen Realität an sich.
So sind für Goffman die Individuen durch ihre Darstellungen und Interaktionen aktiv an der Konstruktion ihrer sozialen Realität beteiligt. Die Individuen sind nicht einfach passive Empfänger der Realität, sondern aktive Akteure, die durch ihre Darstellungen und sozialen Erfahrungen gestalten und geformt werden. Dieser Ansatz betont die dynamische und veränderliche Natur der sozialen Realität und unterstreicht die Bedeutung von Interpretations- und Aushandlungsprozessen bei der Konstruktion der Realität.
Der Begriff der "sozialen Dramaturgie" ist im Werk von Erving Goffman zentral. Seiner Ansicht nach spielt sich das soziale Leben wie ein Theaterstück ab, mit Schauspielern (den Individuen), einer Bühne (dem sozialen Umfeld) und einem Publikum (den anderen anwesenden Personen). Jedes Individuum spielt verschiedene Rollen, je nach der Situation, in der es sich befindet, und den sozialen Erwartungen, die mit dieser Situation verbunden sind. Aus dieser Perspektive wird der öffentliche Raum als "Bühne" wahrgenommen, auf der die Individuen ihre sozialen Rollen inszenieren. Goffman unterscheidet zwischen der "vorderen Bühne", auf der die Individuen den sozialen Normen entsprechen und eine Rolle spielen, die dazu bestimmt ist, von anderen gesehen zu werden, und der "hinteren Bühne", auf der die Individuen sich entspannen, sie selbst sein und sich auf ihre Auftritte auf der vorderen Bühne vorbereiten können. Für Goffman ist die "Selbstdarstellung" ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Interaktion. Einzelpersonen versuchen, den Eindruck, den sie bei anderen hinterlassen, zu kontrollieren, indem sie ihr Aussehen, ihre Körpersprache und ihr Verhalten manipulieren. Beispielsweise kann sich eine Person auf eine bestimmte Art und Weise kleiden oder ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, um einen bestimmten Eindruck zu vermitteln, wie etwa kompetent oder vertrauenswürdig zu erscheinen. Für Goffman ist der öffentliche Raum also ein Ort, an dem Menschen ihre sozialen Rollen spielen, versuchen, den Eindruck, den sie bei anderen hinterlassen, zu kontrollieren, und durch ihre Interaktionen ständig ihre Identitäten und Beziehungen zu anderen aushandeln.
Erving Goffman legt in seiner Analyse des sozialen Lebens den Schwerpunkt auf die Formen des Engagements, die die Menschen in ihren Interaktionen eingehen. Die drei Fähigkeiten - Kooperation, Engagement und Absorption - sind entscheidend für die Art und Weise, wie sich Individuen in verschiedenen sozialen Situationen verhalten und interagieren. Sie sind besonders relevant für Goffmans Analyse der "sozialen Dramaturgie", in der soziale Interaktionen als Theateraufführungen betrachtet werden.
- Kooperation: Goffman betont, dass soziale Interaktionen eine gewisse Form der Kooperation zwischen den Individuen erfordern. Dies bedeutet, dass soziale Normen und Verhaltenserwartungen gegenseitig respektiert werden. Kooperation ist wichtig, um die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten und reibungslose soziale Interaktionen zu erleichtern. In einer Konversation müssen die Menschen zum Beispiel kooperieren, indem sie sich beim Sprechen abwechseln und zuhören, wenn der andere an der Reihe ist.
- Engagement: Laut Goffman bezieht sich Engagement auf das Ausmaß, in dem ein Individuum an einer sozialen Interaktion beteiligt ist. Das Engagement kann je nach Situation und Rolle, die der Einzelne spielt, variieren. Beispielsweise kann eine Person bei einem ernsthaften Gespräch mit einem Freund sehr engagiert sein, während sie bei einem informellen Gespräch mit einem Fremden weniger engagiert ist.
- Absorption: Goffman verwendet den Begriff "Absorption", um Situationen zu beschreiben, in denen ein Individuum vollständig in eine Aktivität involviert ist, so dass es von dieser "absorbiert" wird. In diesen Situationen kann der Einzelne so sehr auf die laufende Aktivität konzentriert sein, dass er sich seiner sozialen Umgebung weniger bewusst ist und weniger sensibel auf soziale Interaktionen reagiert.
Diese drei Fähigkeiten sind grundlegend für die Art und Weise, wie sich Individuen in der sozialen Welt bewegen, und sind Schlüsselkomponenten von Goffmans Theorie der sozialen Dramaturgie.
Erving Goffmans Perspektive auf die Gesellschaft als Theater impliziert, dass wir alle Schauspieler und Zuschauer im öffentlichen Raum sind. Diese Perspektive wird oft als "soziale Dramaturgie" bezeichnet und legt nahe, dass das soziale Leben eine Reihe von Aufführungen ist. In diesen Aufführungen spielen Einzelpersonen eine bestimmte Rolle, und gleichzeitig sind sie auch Zuschauer der Aufführungen anderer. Wenn wir mit anderen interagieren, "spielen wir eine Rolle" auf der Grundlage dessen, was wir für die Erwartungen halten, die andere an uns haben. Diese Erwartungen können auf sozialen Normen, sozialen Rollen, Stereotypen usw. beruhen. Und während wir unsere Rolle spielen, beobachten und interpretieren wir auch die Leistungen der anderen. Mit anderen Worten: Wir sind sowohl Akteure, die die soziale Interaktion gestalten, als auch Zuschauer, die sie interpretieren. Diese Interaktionen werden stark von der Kultur beeinflusst, denn es ist die Kultur, die das "Drehbuch" oder die allgemeinen Richtlinien für unsere Auftritte bereitstellt. Beispielsweise legt die Kultur angemessene Normen und Werte, Geschlechterrollen, akzeptable Verhaltensweisen usw. fest. Durch unsere Interaktionen im öffentlichen Raum sind wir also sowohl an der Schaffung der sozialen Realität (als Akteure) als auch an ihrer Interpretation (als Zuschauer) beteiligt. Und diese Prozesse werden beide durch den kulturellen Kontext geprägt, in dem sie stattfinden.
Laut Erving Goffman sind Sprache und Körper zwei entscheidende Elemente in der sozialen Interaktion. Sie sind die wichtigsten Werkzeuge, die wir verwenden, um unsere Rolle in der sozialen Performance zu "spielen".
- Sprechen: Goffman betont die Bedeutung der verbalen Kommunikation in der sozialen Interaktion. Die Art und Weise, wie wir sprechen, die Wörter, die wir wählen, der Tonfall, den wir verwenden usw., sind allesamt Elemente unserer Performance. Sie helfen uns dabei, unsere Identität auszudrücken, unseren sozialen Status anzuzeigen, unsere Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu demonstrieren etc. Darüber hinaus ist das Sprechen auch ein wichtiges Mittel, um die Leistungen anderer zu interpretieren. Indem wir anderen zuhören, sammeln wir Informationen über ihre Rolle, ihren Status, ihre Identität usw.
- Der Körper: Goffman betont auch die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation in der sozialen Interaktion. Körperbewegungen, Gesichtsausdrücke, Blickkontakt usw. sind Schlüsselelemente unserer Performance. Sie können eine Vielzahl von Informationen vermitteln, wie z. B. unsere Emotionen, Einstellungen, ob wir uns in einer Situation wohlfühlen oder nicht, usw. Darüber hinaus kann auch unsere körperliche Erscheinung (Kleidung, Frisur usw.) eine Rolle dabei spielen, wie wir von anderen wahrgenommen werden.
In der sozialen Interaktion setzen wir also sowohl Sprache als auch Körper ein, um unsere Rolle zu "spielen" und die Leistungen anderer zu interpretieren. Diese Prozesse ermöglichen es uns, unseren Platz in der Gesellschaft "auszuhandeln" und den Platz der anderen zu verstehen.
Der symbolische Interaktionismus[modifier | modifier le wikicode]
Erving Goffman untersuchte verschiedene Formen des Sozialverhaltens, darunter auch Vermeidungsstrategien. Individuen können diese Strategien einsetzen, um ihr "Gesicht" (ein Bild von sich selbst, das anderen präsentiert wird) zu wahren oder um durch potenziell unbequeme oder peinliche soziale Situationen zu navigieren.
Laut Goffman können einige dieser Vermeidungsstrategien Folgendes umfassen:
- Physische Vermeidung: Dazu können Dinge gehören wie den Weg zu ändern, um jemandem nicht zu begegnen, oder einen Raum zu verlassen, wenn bestimmte Personen ihn betreten.
- Kommunikationsvermeidung: Das Nichtbeantworten einer Nachricht, das Ignorieren einer Person in einem Gespräch oder das Vermeiden, über bestimmte Themen zu sprechen, können Formen der Kommunikationsvermeidung sein.
- Blickvermeidung: Manchmal können Personen den direkten Blickkontakt mit jemandem vermeiden, um eine Interaktion zu vermeiden.
- Vermeidung durch Ablenkung: Man kann vorgeben, beschäftigt oder abgelenkt zu sein, um eine Interaktion zu vermeiden.
Diese Strategien werden alle mit dem Ziel eingesetzt, die Art und Weise, wie wir von anderen wahrgenommen werden, zu steuern, was den Kern von Goffmans Rahmen des symbolischen Interaktionismus bildet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Verhaltensweisen auch negative Folgen haben können, wie etwa die Behinderung der Kommunikation oder die Entstehung von Missverständnissen.
Der symbolische Interaktionismus bietet eine interessante Perspektive für das Verständnis von Politik. In der Politik spielen die Interaktionen zwischen Einzelpersonen, Gruppen, politischen Parteien, Institutionen und sogar Nationen eine entscheidende Rolle dabei, wie Entscheidungen getroffen und politische Maßnahmen umgesetzt werden.
Hier einige wichtige Punkte des Interaktionismus im Bereich der Politik :
- Verhandlung und Debatte: In der Politik geht es oft um Verhandlungen und Debatten zwischen verschiedenen Parteien mit unterschiedlichen Interessen. Der Interaktionismus hilft zu verstehen, wie diese Prozesse ablaufen und wie Einzelpersonen und Gruppen Symbole und geteilte Bedeutungen nutzen, um diese Verhandlungen zu beeinflussen.
- Identitätskonstruktion: Politik ist auch ein Prozess, in dem Identitäten konstruiert und herausgefordert werden. Beispielsweise kann die politische Identität eines Individuums durch seine Interaktionen mit anderen in seinem sozialen und politischen Umfeld geprägt werden.
- Einfluss und Macht : Der Interaktionismus kann helfen zu verstehen, wie Macht in politischen Interaktionen ausgeübt und ausgehandelt wird. Zum Beispiel, wie Einzelpersonen oder Gruppen Sprache, Symbole und Rituale einsetzen, um andere zu beeinflussen und Macht zu gewinnen.
- Sozialer Wandel: Der Interaktionismus bietet eine Perspektive darauf, wie sozialer Wandel durch alltägliche Interaktionen entstehen kann. Zum Beispiel, wie soziale Bewegungen Interaktionen nutzen, um Unterstützung zu mobilisieren, Ideen zu verbreiten und Veränderungen in sozialen und politischen Normen zu bewirken.
Der symbolische Interaktionismus erinnert uns also daran, dass es in der Politik nicht nur um institutionelle Strukturen und formale Prozesse geht, sondern auch um soziale Interaktionen, geteilte Bedeutungen und alltägliche Verhandlungen.
Erving Goffman hat mehrere Situationen identifiziert, die rituelle soziale Interaktionen stören können. Hier eine ausführlichere Erklärung dieser drei Situationen:
- Beleidigung und Wiedergutmachung: In dieser Situation kann eine Person eine Beleidigung bzw. eine Verletzung der Interaktionsnormen begehen, was bei der beleidigten Person ein Gefühl der Scham oder des Unbehagens auslösen kann. In der Regel gibt es jedoch die Möglichkeit einer Wiedergutmachung, bei der sich die Person, die die Beleidigung begangen hat, entschuldigen oder Abbitte leisten kann, um die soziale Ordnung wiederherzustellen.
- Schändung: Hier weigert sich eine Person absichtlich, die Normen der Interaktion zu befolgen. Dies kann geschehen, wenn eine Person die etablierten sozialen Normen in Frage stellt oder offen kritisiert. Diese absichtliche Verletzung von Normen kann zu einer erheblichen Störung der sozialen Interaktion führen.
- Abnormalität: In diesem Fall ist eine Person aufgrund bestimmter Bedingungen oder Umstände, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, nicht in der Lage, die Interaktionsnormen zu befolgen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn eine Person an einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen Behinderung leidet, die sie daran hindert, auf die übliche Weise an sozialen Interaktionen teilzunehmen.
Jede dieser Situationen kann die soziale Ordnung stören und bei den anderen Interaktionsteilnehmern Unbehagen oder Unbehagen hervorrufen. Goffman argumentiert jedoch, dass diese Störungen auch Gelegenheiten sein können, etablierte soziale Normen zu überprüfen und in Frage zu stellen.
Die konstruktivistische Theorie[modifier | modifier le wikicode]
Zu den Ursprüngen: Die Epistemologie von Alfred Schütz (1899 - 1959)[modifier | modifier le wikicode]
Alfred Schütz war ein österreichischer Soziologe und Philosoph, der wesentlich zur Entwicklung der Sozialphänomenologie beigetragen hat, einem Ansatz, der zu verstehen versucht, wie Menschen ihrer sozialen Welt Bedeutung verleihen. Schütz ist der Ansicht, dass unser Verständnis der Welt durch unsere direkte Erfahrung mit ihr strukturiert wird. Das heißt, wir konstruieren unsere Realität auf der Grundlage unserer eigenen Perspektive und unserer persönlichen Erfahrungen. Er argumentiert, dass Individuen mit der Welt auf der Grundlage ihrer subjektiven Interpretationen und ihres subjektiven Verständnisses der Welt interagieren. Für Schütz ist die Realität ein sozial konstruiertes Phänomen. Jedes Individuum hat eine einzigartige, subjektive Vorstellung von der Realität, die auf persönlichen Erfahrungen, Interaktionen mit anderen und Interpretationen dieser Erfahrungen und Interaktionen beruht. Diese Perspektive wird häufig als "sozialer Konstruktionismus" bezeichnet. In der Tradition von Schütz hat Goffman auch untersucht, wie Individuen ihre soziale Realität konstruieren und interpretieren, wobei er sich insbesondere darauf konzentrierte, wie Individuen sich selbst in verschiedenen sozialen Situationen präsentieren und verwalten. Aus dieser Perspektive kann ein "Denkobjekt" als etwas verstanden werden, das von den Individuen durch ihre Interaktion und ihre Interpretation der Welt konstruiert wird. Beispielsweise können soziale Normen, Geschlechterrollen und kulturelle Identitäten alle als sozial konstruierte "Denkobjekte" betrachtet werden.
In den Sozialwissenschaften und generell in der Forschung ist die Konstruktion des Untersuchungsgegenstandes ein entscheidender Schritt, der eine rigorose Arbeit der Konzeptualisierung und Operationalisierung erfordert. Das bedeutet, dass der Forscher genau definiert, was er zu untersuchen versucht (Konzeptualisierung), und festlegt, wie er dieses Phänomen messen oder beobachten wird (Operationalisierung). Die Konstruktion des Untersuchungsgegenstandes bedeutet in der Regel, dass man ein Konzept oder eine allgemeine Idee nimmt und sie/ihn in etwas Spezifisches, Messbares und Beobachtbares umwandelt. Beispielsweise muss ein Forscher, der an der Untersuchung der "Lebensqualität" interessiert ist, genau definieren, was er unter diesem Begriff versteht (z. B. unter Einbeziehung von Faktoren wie Gesundheit, wirtschaftliches Wohlergehen, soziale Beziehungen usw.), und festlegen, wie er jeden dieser Faktoren messen wird. Wichtig ist auch, dass die Konstruktion des Untersuchungsgegenstandes häufig durch den theoretischen Rahmen des Forschers beeinflusst wird, d. h. die Gesamtheit der Theorien und Konzepte, die er zum Verständnis seines Themas heranzieht. So können verschiedene Forscher den Untersuchungsgegenstand auf unterschiedliche Weise konstruieren und interpretieren, je nach ihrer theoretischen Perspektive. Schließlich ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass die Konstruktion des Untersuchungsgegenstandes ein grundlegender Schritt in der wissenschaftlichen Forschung ist, der die Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Forschung gewährleistet. Ohne eine klare und präzise Definition des Untersuchungsgegenstandes wäre es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine rigorose Forschung durchzuführen und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
Alfred Schütz schlug einen phänomenologischen Ansatz für die Soziologie vor, was bedeutet, dass er sich dafür interessierte, wie Menschen die Welt um sich herum wahrnehmen und interpretieren. Seiner Ansicht nach ist unser Verständnis der Welt immer eine Konstruktion zweiten Grades, die auf unseren persönlichen und subjektiven Interpretationen der Realität beruht. Schütz zufolge besteht die Aufgabe des Soziologen darin, diese subjektiven Konstruktionen der Realität zu verstehen, und nicht darin, irgendeine "objektive Realität" zu entdecken. Dazu ist es notwendig, Forschungsinstrumente und -methoden zu entwickeln, mit denen die Wahrnehmungen und Interpretationen von Individuen erforscht und verstanden werden können. Das bedeutet, dass der Forscher, anstatt einfach das Verhalten von Individuen zu beobachten, sich bemühen muss, die Bedeutung zu verstehen, die Individuen ihrem Verhalten und ihren Erfahrungen beimessen. Dies kann qualitative Forschungsmethoden wie Tiefeninterviews oder teilnehmende Beobachtung beinhalten, mit denen detaillierte Daten über die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Einzelnen gesammelt werden können. In diesem Sinne kann der Ansatz von Schütz als Kritik an den traditionelleren Ansätzen der Soziologie gesehen werden, die versuchen, das soziale Verhalten in Form von Gesetzen oder objektiven Strukturen zu erklären. Stattdessen argumentiert Schütz, dass soziales Verhalten nur verstanden werden kann, wenn die Perspektive der sozialen Akteure selbst berücksichtigt wird.
Der konstruktivistische Ansatz, der von Denkern wie Schütz und Goffman vertreten wird, betont, wie wichtig es ist, die sozialen Realitäten so zu verstehen, wie sie von den Individuen selbst wahrgenommen und konstruiert werden. Diese Perspektive betont die aktive Rolle der Individuen bei der Schaffung und Veränderung ihrer sozialen Welt. In diesem Zusammenhang geht es bei der soziologischen Forschung nicht nur darum, die soziale Realität zu beobachten und zu beschreiben. Es geht auch darum, zu verstehen, wie diese Realität konstruiert wird, wie sie erlebt wird und wie sie von den Individuen interpretiert wird. Dieser Ansatz erfordert eine epistemologische Reflexion über die verwendeten Forschungsmethoden und die Annahmen, auf denen sie beruhen. Es bedeutet auch, anzuerkennen, dass unser eigenes Verständnis als Forscher ebenfalls ein Konstrukt ist, das durch unsere eigenen Erfahrungen, Perspektiven und unseren eigenen kulturellen und historischen Kontext geprägt wird. Daher ist das Ziel nicht, zu einer objektiven oder universellen "Wahrheit" zu gelangen, sondern vielmehr, die vielfältigen Realitäten zu verstehen, die von Individuen in verschiedenen sozialen Kontexten konstruiert und gelebt werden.
Die Sprachphilosophie von John Searle[modifier | modifier le wikicode]
John Searle ist ein bekannter amerikanischer Philosoph, der sich intensiv mit der Philosophie der Sprache und des Geistes beschäftigt hat. In "The Construction of Social Reality" (1995) untersucht Searle, wie unsere Vorstellungen von der Realität durch unsere Überzeugungen und sozialen Praktiken geprägt werden. Er unterscheidet zwischen nackten Tatsachen, die unabhängig von menschlichem Eingreifen existieren (z. B. die Schwerkraft), und institutionellen Tatsachen, die nur aufgrund unseres Glaubens an sie existieren (z. B. die Vorstellung von Geld als Tauschmittel). Searle argumentiert, dass viele unserer sozialen Realitäten - wie Regierungen, Ehen, Geld und Immobilien - durch sprachliche Prozesse konstruiert werden. Wenn wir beispielsweise sagen "Dies ist Geld", tragen wir dazu bei, die soziale Realität zu schaffen, dass das Papier oder Metall, das wir in der Hand halten, einen bestimmten Wert hat. Ebenso schaffen wir, wenn wir sagen "Wir sind verheiratet", eine neue soziale Realität mit bestimmten Rechten, Pflichten und Erwartungen. Searles Perspektive auf den Konstruktivismus ist daher eng mit der Art und Weise verknüpft, wie die Sprache zur Konstruktion unserer sozialen Realität beiträgt.
John Searle betrachtet die Sprache als ein grundlegendes Element unserer Konstruktion der sozialen Realität. Seiner Meinung nach ist Sprache nicht nur ein Mittel, um Informationen zu kommunizieren, sondern auch ein Werkzeug, um unsere soziale Realität zu erschaffen und zu verändern. In seiner Arbeit konzentriert er sich auf das, was er "Sprachhandlungen" nennt, d. h. die verschiedenen Arten, wie wir Sprache verwenden, um Handlungen in der sozialen Welt auszuführen. Wenn wir zum Beispiel ein Versprechen geben, verwenden wir Sprache, um eine soziale Verpflichtung zu schaffen. Wenn wir etwas benennen, verwenden wir Sprache, um einem Objekt oder einer Person eine Identität zu verleihen. Wenn wir Gesetze oder Regeln formulieren, verwenden wir die Sprache, um Verhaltensnormen festzulegen. Searles Ansicht über Sprache ist daher sehr ähnlich wie die von Piaget, der die Sprache ebenfalls als ein Konstrukt betrachtete, das für unser Verständnis und unsere Interaktion mit der Welt von entscheidender Bedeutung ist.
John Searle war ein wichtiger Beitrag zur Sprachphilosophie, einer Teildisziplin der Philosophie, die sich mit Konzepten im Zusammenhang mit Sprache und Sprachgebrauch befasst. Seiner Meinung nach spielt die Sprache eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion unserer sozialen Realität. Er argumentiert, dass wir, wenn wir Sprache verwenden, das tun, was er "Sprechakte" nennt. Ein Sprechakt ist nicht nur der Akt, etwas zu sagen, sondern auch der Akt, durch diese Worte etwas zu tun. Wenn wir beispielsweise sagen "Ich verspreche, das Geschirr zu spülen", teilen wir nicht nur eine Information mit, sondern verpflichten uns auch zu einer Handlung (ein Versprechen abgeben). Searle zufolge haben diese Sprechakte die Macht, soziale Realitäten zu schaffen. Wenn der Bürgermeister einer Stadt beispielsweise sagt "Ich erkläre diesen Jahrmarkt für eröffnet", beschreibt er nicht nur eine Situation, sondern schafft auch eine neue Realität: Der Jahrmarkt ist nun offiziell eröffnet. Durch diesen Prozess trägt die Sprache zur Konstruktion unserer sozialen Realität bei. Mit anderen Worten: Searle sieht Sprache nicht nur als Mittel, um die Welt zu beschreiben, sondern auch als Mittel, um sie zu verändern. Daher behauptet er, dass "Sprache eine Form des Handelns ist".
Das Studium der Etymologie, also des Ursprungs und der Geschichte von Wörtern, kann viele wertvolle Informationen darüber liefern, wie wir die Sprache verwenden, um unsere Realität zu entwerfen und aufzubauen. Jedes Wort hat eine Geschichte, und diese Geschichte ist oft damit verbunden, wie wir die Welt verstehen. Das Wort "verstehen" stammt beispielsweise vom lateinischen Wort "comprehendere" ab, das "zusammen fassen" bedeutet. Dies legt nahe, dass wir, um etwas zu verstehen, in der Lage sein müssen, alle seine Aspekte gleichzeitig zu erfassen, sie zu einem zusammenhängenden Ganzen zusammenzufügen. Wenn wir uns also mit der Etymologie von Wörtern beschäftigen, können wir besser verstehen, wie wir die Sprache verwenden, um der Welt um uns herum Bedeutung zu verleihen. Dies kann uns helfen, kritischer über die Art und Weise nachzudenken, wie wir Sprache verwenden, versteckte Vorannahmen in unserer Rede aufzuspüren und neue Wege zu entwickeln, über die Welt zu denken und zu sprechen. Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass die Etymologie nicht immer ein zuverlässiger Leitfaden ist, um die aktuelle Bedeutung eines Wortes zu verstehen. Die Bedeutungen von Wörtern ändern sich im Laufe der Zeit, und manchmal kann sich die ursprüngliche Bedeutung eines Wortes stark von seiner heutigen Verwendung unterscheiden. Daher sollte die Etymologie, obwohl sie interessante Einblicke bieten kann, als Instrument der linguistischen Analyse mit Vorsicht eingesetzt werden.
Die Sprache spielt eine wesentliche Rolle dabei, wie wir unsere soziale Realität begreifen und konstruieren. Sie ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Mittel, mit dem wir der Welt um uns herum Sinn verleihen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sprache zur Konstruktion unserer sozialen Realität beiträgt :
- Kategorisierung und Konzeptualisierung: Sprache hilft uns dabei, die Welt in verständliche Kategorien und Konzepte einzuteilen. Beispielsweise helfen uns die Wörter, die wir zur Beschreibung von Farben, Emotionen oder sozialen Beziehungen verwenden, unsere Erfahrungen mit der Welt zu strukturieren.
- Schaffung und Weitergabe von Kultur: Sprache ist das wichtigste Vehikel für Kultur. Sie ermöglicht es uns, unsere Ideen, Überzeugungen und Werte zu teilen und unsere Kultur von Generation zu Generation weiterzugeben.
- Verhandeln und Sinnstiftung : Mithilfe von Sprache können wir über die Bedeutung von Ereignissen, Ideen und Erfahrungen diskutieren, debattieren und verhandeln. Dies ist besonders wichtig in Situationen des sozialen Wandels oder in Konfliktsituationen.
- Aufbau und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen: Mithilfe von Sprache können wir soziale Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten. Beispielsweise verwenden wir Sprache, um unsere Zuneigung, unseren Respekt oder unsere Feindseligkeit gegenüber anderen auszudrücken.
- Definition und Aufbau von Identität: Sprache spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wir unsere Identität und unseren Platz in der Gesellschaft definieren. Beispielsweise können die Art und Weise, wie wir sprechen, und die Wörter, die wir verwenden, unsere ethnische Herkunft, unsere soziale Klasse, unser Geschlecht usw. widerspiegeln.
Sprache ist ein mächtiges Werkzeug, das unser Verständnis der Welt und unsere Interaktion mit ihr prägt. Sie trägt auf komplexe und facettenreiche Weise zum Aufbau unserer sozialen Realität bei.
Peter Berger und Thomas Luckman: "Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit"[modifier | modifier le wikicode]
Peter L. Berger und Thomas Luckmann haben in ihrem einflussreichen Buch "The Social Construction of Reality" (1966) eine soziologische Erkenntnistheorie entwickelt, die erklärt, wie soziale Wirklichkeiten geschaffen, institutionalisiert und für die Menschen in einer Gesellschaft bedeutsam gemacht werden. Für sie ist die Realität ein sowohl objektives als auch subjektives Phänomen, das durch menschliche Interaktionen und Sprache konstruiert wird.
- Soziale Konstruktion der Realität: Für Berger und Luckmann ist die Realität keine feste und unveränderliche externe Entität, sondern vielmehr ein sich ständig veränderndes Phänomen, das durch menschliche Interaktionen konstruiert und umgestaltet wird. Die Menschen schaffen durch ihre Handlungen und Interaktionen eine soziale Realität, die zwar subjektiv ist, aber als objektiv und "real" wahrgenommen wird.
- Rolle der Sprache: Die Sprache ist für diesen Prozess der sozialen Konstruktion der Realität von entscheidender Bedeutung. Sie bietet den Rahmen, in dem die Menschen ihre Erfahrungen mit der Welt interpretieren, beschreiben und ihnen Bedeutung verleihen. Durch den Austausch von Symbolen und Bedeutungen mittels Sprache konstruieren die Individuen gemeinsam eine geteilte Realität.
- Institutionalisierung und soziale Rollen: Wiederholte Interaktionsmuster werden institutionalisiert, d. h. sie entwickeln sich zu stabilen und vorhersagbaren sozialen Strukturen wie Familie, Bildung, Regierung etc. Diese Institutionen wiederum beeinflussen das Verhalten der Individuen, indem sie ihnen bestimmte Rollen zuweisen.
- Subjektive und objektive Realität: Obwohl die Realität sozial konstruiert ist, wird sie von den Individuen als objektive Realität erlebt, die unabhängig von ihrem Willen ist. Dies wird von Berger und Luckmann als "Verdinglichung" bezeichnet - der Prozess, durch den die sozial konstruierte Realität als objektive und unveränderliche Wirklichkeit wahrgenommen wird.
Die Perspektive von Berger und Luckmann hebt die zentrale Rolle sozialer Interaktionen und der Sprache bei der Konstruktion unserer wahrgenommenen Realität hervor. Die Sozialwissenschaften sollten sich ihrer Meinung nach daher auf das Verständnis dieser Prozesse der sozialen Konstruktion der Realität konzentrieren.
Peter L. Berger und Thomas Luckmann erklären in ihrem Buch "The Social Construction of Reality", dass die Realität ständig durch soziale Interaktionen erschaffen und verändert wird. Sie heben drei Schlüsselkonzepte in diesem Prozess hervor:
- Sprache als Grundlage des Alltagswissens: Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Mittel, mit dem Individuen ihrer Welt Bedeutung verleihen. Durch Sprache benennen, kategorisieren und interpretieren wir unsere Erfahrungen mit der Welt. Somit spielt die Sprache eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion unserer sozialen Realität.
- Die Gesellschaft als objektive Realität: Obwohl die Gesellschaft sozial konstruiert ist, wird sie von den Individuen als objektive Realität wahrgenommen, die unabhängig von ihrem Willen ist. Soziale Institutionen, Normen und Regeln werden als außerhalb des Individuums existierende Entitäten betrachtet, die Einfluss und Kontrolle auf das Verhalten des Individuums ausüben. Diese Objektivierung der sozialen Realität trägt zur Stabilität und Kontinuität der Gesellschaft bei.
- Gesellschaft als subjektive Realität: Berger und Luckmann argumentieren auch, dass die soziale Realität eine subjektive Realität ist. Das heißt, dass die Menschen ihrer Welt durch ihre eigenen Perspektiven und Erfahrungen Bedeutung verleihen. Dies beinhaltet die Identifikation mit anderen, bei der wir lernen, die Welt durch die Augen anderer zu sehen. Es ist dieser Prozess der Internalisierung, der es uns ermöglicht, soziale Erwartungen und Normen zu verstehen und einzuhalten.
Berger und Luckmann zeigen, dass die Realität ein soziales Konstrukt ist, das durch Sprache und soziale Interaktionen geformt und als objektive Einheit wahrgenommen wird, die einen Einfluss auf das Individuum ausübt. Gleichzeitig ist die Realität eine subjektive Erfahrung, die von unserer Identifikation und Empathie mit anderen Menschen beeinflusst wird.
Aus der Sicht der Politikwissenschaft ist Macht ein zentrales Element der sozialen Konstruktion der Realität. Macht ist die Fähigkeit, das Verhalten anderer Individuen oder Gruppen von Individuen zu beeinflussen, indem Regeln, Normen und Strukturen geschaffen werden, die das soziale Verhalten prägen und lenken.
Macht kann sich in einer Gesellschaft auf unterschiedliche Weise manifestieren:
- Institutionelle Macht: Hierbei handelt es sich um die Autorität und Kontrolle, die von gesellschaftlichen Institutionen wie der Regierung, juristischen Organisationen, Bildungseinrichtungen, religiösen Organisationen usw. ausgeübt wird. Diese Institutionen legen Normen und Regeln fest, die das Verhalten der Menschen lenken.
- Soziale Macht: Hierbei handelt es sich um den Einfluss, den soziale Gruppen auf Einzelpersonen ausüben. Dazu kann der Gruppendruck, der Einfluss der Medien, das Gewicht kultureller Traditionen usw. gehören.
- Individuelle Macht: Dies ist die Fähigkeit einer Person, andere zu beeinflussen, sei es durch Charisma, Wissen, Expertise, Reichtum, sozialen Status etc.
Somit ist die soziale Realität zum Teil ein Konstrukt der Macht. Die Menschen unterliegen den Regeln und Normen, die von den Machthabern aufgestellt werden, und sie sind auch an dieser Konstruktion beteiligt, indem sie diese Regeln und Normen akzeptieren, aushandeln oder sich ihnen widersetzen. Wenn wir verstehen, wie Macht die soziale Realität gestaltet, können wir die Dynamik der Gesellschaft und wie es zu sozialen Veränderungen kommen kann, besser verstehen. Die Fähigkeit, Individuen dazu zu bringen, sich einer konstruierten sozialen Realität anzuschließen, ist eine wesentliche Dimension von Macht. Soziale Institutionen üben Kontrolle über die Individuen aus, indem sie die Normen und Regeln, die die soziale Realität definieren, festlegen und durchsetzen. Wenn ein Einzelner diese Normen und Regeln in Frage stellt oder verletzt, kann er verschiedenen Formen von Sanktionen ausgesetzt sein, die von sozialer Missbilligung bis hin zu härteren gesetzlichen Sanktionen reichen. In extremen Fällen wie dem von Galileo Galilei können diejenigen, die sich der etablierten Ordnung widersetzen, sogar mit dem Tod oder anderen Formen extremer Gewalt bedroht werden. Der Fall Galileo Galilei ist ein Beispiel dafür, wie Macht eingesetzt werden kann, um eine bestimmte Vorstellung von der Realität durchzusetzen. Galileo Galilei wurde von der katholischen Kirche verurteilt, weil er den Heliozentrismus vertrat, eine Theorie, die dem damals akzeptierten geozentrischen Weltbild widersprach. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die konstruierte soziale Realität nicht unveränderlich ist und im Laufe der Zeit verändert oder in Frage gestellt werden kann. Beispielsweise wurde trotz Galileos Verurteilung seine Theorie des Heliozentrismus schließlich als wissenschaftliche Wahrheit akzeptiert. Dies verdeutlicht auch, dass Macht nicht immer absolut bestimmend ist: Sie kann in Frage gestellt und verändert werden, und die sozialen Realitäten können sich durch diesen Prozess der Anfechtung und Veränderung weiterentwickeln.
Laut Berger und Luckmann wird die soziale Realität im Alltag durch Institutionalisierungs- und Legitimationsprozesse konstruiert.
Institutionalisierung ist der Prozess, durch den bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen wiederholt und vorhersehbar werden und so Muster bilden, die die soziale Realität prägen. Diese institutionalisierten Verhaltensmuster werden von den Menschen verinnerlicht und zu Gewohnheiten, die ihre täglichen Handlungen strukturieren. Beispiele für institutionalisierte Verhaltensmuster sind das frühe Aufstehen zur Arbeit, das Einhalten von Verkehrsregeln oder das Einhalten von Höflichkeitsnormen in sozialen Interaktionen.
Der Legitimationsprozess andererseits ist der Mechanismus, durch den diese institutionalisierten Verhaltensweisen von der Gesellschaft bestätigt und unterstützt werden. Sie werden durch gemeinsame Überzeugungen, Werte, Normen und Regeln gerechtfertigt und unterstützt. Beispielsweise wird die Einhaltung von Gesetzen durch den Glauben legitimiert, dass dies notwendig ist, um die Ordnung und Stabilität in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
Diese beiden Prozesse arbeiten zusammen, um die soziale Realität zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Die Institutionalisierung legt Verhaltensweisen und Erwartungen fest, während die Legitimation die Rechtfertigung und Unterstützung für diese Verhaltensweisen und Erwartungen liefert. Durch diese Prozesse wird die soziale Realität im Alltag aufgebaut und aufrechterhalten.
Der Prozess der Institutionalisierung ist ein wesentlicher Aspekt jeder Gesellschaft. Dabei geht es darum, das Verhalten und die Interaktionen zwischen den Menschen zu formalisieren und zu kodifizieren, um eine stabile und vorhersehbare soziale Ordnung zu schaffen. Dies kann durch Gesetze, Regeln, soziale Normen, Traditionen und andere Formen sozialer Strukturen geschehen. Gewöhnung (die Übernahme von Verhaltensweisen durch Gewohnheit oder Routine) und Arbeitsteilung (die Spezialisierung von Rollen und Verantwortlichkeiten) sind zwei Schlüsselmechanismen der Institutionalisierung. Auch die Weitergabe ist ein entscheidender Aspekt dieses Prozesses. Die institutionalisierten Werte, Normen und Verhaltensweisen werden von einer Generation an die nächste weitergegeben und sorgen so für Kontinuität und Stabilität der sozialen Ordnung. Der Legitimationsprozess hingegen besteht darin, diese institutionalisierten Verhaltensweisen zu rechtfertigen und zu validieren. Traditionen, Sprache und gemeinsame Überzeugungen spielen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle, da sie die moralische, soziale und kulturelle Rechtfertigung für institutionalisierte Verhaltensweisen liefern. Diese beiden Prozesse, Institutionalisierung und Legitimation, sind intrinsisch miteinander verbunden und arbeiten zusammen, um die soziale Realität zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten: Sie tragen dazu bei, die "soziale Welt", wie wir sie kennen, aufzubauen.
Der Legitimationsprozess ist in jeder Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Er ist mit der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und Stabilität verbunden, indem er den etablierten Normen, Regeln, Institutionen und Verhaltensweisen Gültigkeit und Akzeptanz verleiht. Sie ist ein Schlüsselschritt bei der Festigung und Akzeptanz der konstruierten sozialen Realität. Symbole spielen in diesem Prozess eine große Rolle. Symbole - seien sie kultureller, religiöser, politischer oder anderer Art - dienen der Vermittlung von Werten, Idealen und Überzeugungen, die die konstruierte soziale Realität stärken. Im Zusammenhang mit Regierung und Macht tragen beispielsweise Symbole wie Flaggen, Nationalhymnen, Denkmäler, Embleme und offizielle Rituale dazu bei, die Autorität zu legitimieren und eine bestimmte Vision der Gesellschaft zu fördern. Der Legitimationsprozess kann auch als Mechanismus der sozialen Kontrolle betrachtet werden. Er hilft dabei, Normen und erwartete Verhaltensweisen festzulegen und aufrechtzuerhalten und Grenzen für das zu setzen, was in einer bestimmten Gesellschaft als akzeptabel gilt. Er kann auch dabei helfen, Konflikte zu verhindern oder zu bewältigen, indem er einen Konsens darüber herstellt, was als richtig und gerecht angesehen wird.
Der Legitimationsprozess zielt darauf ab, die kollektive Akzeptanz der konstruierten sozialen Realität zu gewährleisten. Dieser Prozess umfasst Mechanismen, mit denen Normen, Werte, Überzeugungen und Institutionen validiert und für die Mitglieder der Gesellschaft glaubwürdig gemacht werden. Wenn die Legitimation erfolgreich ist, wird die konstruierte soziale Realität weitgehend als "natürlich" oder "unvermeidlich" akzeptiert und nicht als Produkt sozialer Konstruktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Legitimation ein dynamischer Prozess ist. Konstruierte soziale Realitäten können aufgrund von sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen oder politischen Veränderungen in Frage gestellt, verändert oder sogar völlig abgebaut werden. Neue soziale Realitäten können dann konstruiert und legitimiert werden. In diesem Sinne ist die Legitimation ein wesentlicher Bestandteil von sozialer Stabilität und sozialem Wandel. Sie kann sowohl die bestehende soziale Ordnung aufrechterhalten als auch deren Wandel erleichtern.
Konstruktivismus in der Theorie der internationalen Beziehungen[modifier | modifier le wikicode]
Der Konstruktivismus im Bereich der internationalen Beziehungen vertritt die Ansicht, dass Normen, Ideen, Identitäten und Interaktionen zentrale Elemente bei der Strukturierung des internationalen Systems sind. Er nimmt Staaten und andere internationale Akteure nicht nur als von materiellen Erwägungen wie militärischer Sicherheit oder wirtschaftlichem Reichtum getrieben wahr, sondern auch von Ideen, Werten, Kulturen und sozialen Normen. Für Konstruktivisten ist das internationale System nicht einfach ein Schlachtfeld um Macht und Reichtum. Es ist auch ein Bereich der sozialen Konstruktion, in dem sich internationale Akteure durch ihre Interaktionen gegenseitig formen. Beispielsweise können internationale Normen zu Menschenrechten, Umwelt oder Handel das Verhalten von Staaten und anderen internationalen Akteuren beeinflussen. Darüber hinaus argumentieren Konstruktivisten, dass sich die internationalen Beziehungen ständig verändern. Die Normen, Ideen und Identitäten der internationalen Akteure können sich mit der Zeit verändern, und diese Veränderungen können wiederum das internationale System umgestalten. Beispielsweise hat die Entstehung internationaler Normen zum Klimawandel dazu beigetragen, die Prioritäten und die Politik vieler Staaten und internationaler Organisationen umzugestalten. Somit bietet der Konstruktivismus eine dynamische und sich ständig verändernde Perspektive auf die internationalen Beziehungen. Er legt den Schwerpunkt auf soziale Konstruktionsprozesse und die Bedeutung von Ideen, Werten und Normen bei der Strukturierung des internationalen Systems.
In einem interaktionistischen Feld, wie auch im Bereich der internationalen Beziehungen, sind Strategien ständig in Bewegung und entwickeln sich als Reaktion auf Veränderungen im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Kontext. Es ist entscheidend, diese Dynamiken zu verstehen, um das Verhalten der Akteure richtig zu interpretieren und zukünftige strategische Bewegungen oder Veränderungen vorherzusagen. Strategien können sich aufgrund verschiedener Faktoren ändern, darunter Veränderungen in der Wahrnehmung nationaler Interessen, Entwicklungen im internationalen Kontext, interne Transformationen von Akteuren (z. B. Veränderungen in der Führung oder der Politik) und Interaktionen zwischen den Akteuren selbst. So kann sich ein Land beispielsweise dafür entscheiden, seine Strategie im Bereich der internationalen Beziehungen als Reaktion auf einen Führungswechsel in einem anderen Land, auf eine Veränderung des internationalen politischen Klimas oder auf interne Entwicklungen wie wirtschaftliche oder soziale Veränderungen zu ändern. Darüber hinaus legt der symbolische Interaktionismus, der ein konstruktivistischer Ansatz ist, nahe, dass Strategien durch die Interaktionen zwischen den Akteuren beeinflusst werden. Die Akteure interpretieren und reagieren auf die Handlungen anderer, was zu Veränderungen ihrer eigenen Strategien führen kann. Daher kann die Analyse der Interaktionen zwischen den Akteuren wertvolle Informationen über die strategische Dynamik in den internationalen Beziehungen liefern.
Der konstruktivistische Ansatz in den internationalen Beziehungen ist sehr an den Akteuren und ihrer Interpretation von Situationen interessiert. Der Konstruktivismus betont, dass soziale Realitäten, einschließlich internationaler Strukturen, durch menschliche Interaktionen und geteilte Überzeugungen konstruiert werden. Diese Ebenen zeigen sich im Kontext der internationalen Beziehungen wie folgt:
- Rolle der Akteure: Die Akteure in den internationalen Beziehungen sind nicht nur Staaten, sondern auch internationale Organisationen, NGOs und sogar Einzelpersonen. Ihre Interpretation von Situationen und ihr Verhalten werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter ihre Überzeugungen, Werte, Ideologien sowie ihre materiellen Interessen. Tatsächlich haben die Akteure Identitäten, die ihre Interessen und Handlungen beeinflussen. Beispielsweise wird ein Land, das sich selbst als weltweit führend im Bereich der Menschenrechte sieht, anders handeln als ein Land, das diese Identität nicht teilt.
- Konstruktion sozialer Realitäten: Im Konstruktivismus werden internationale Strukturen als soziale Konstruktionen betrachtet. Das bedeutet, dass die Normen, Regeln und Institutionen, die die internationale Ordnung bilden, ein Produkt der menschlichen Interaktion sind. Sie sind nicht feststehend und können durch menschliches Handeln umgestaltet werden. Beispielsweise haben sich die internationalen Menschenrechtsnormen im Laufe der Zeit aufgrund der Handlungen und Interaktionen von Staaten, internationalen Organisationen und Akteuren der Zivilgesellschaft weiterentwickelt.
- Feld der Interaktionen: Der Konstruktivismus betont die Rolle der Interaktionen bei der Herausbildung internationaler Strukturen und des Verhaltens der Akteure. Akteure interagieren miteinander in verschiedenen Kontexten, wie etwa bei diplomatischen Verhandlungen, in internationalen Foren und sogar in Konflikten. Diese Interaktionen beeinflussen ihr Verständnis der Situation, ihre Interessen und ihr Handeln.
Der Konstruktivismus bietet einen wertvollen Rahmen, um die komplexe Dynamik der internationalen Beziehungen zu verstehen. Er hebt die Rolle von Ideen, Normen und Interaktionen bei der Bildung der internationalen Ordnung und dem Verhalten der Akteure hervor.
Der Konstruktivismus bietet eine alternative Perspektive zu den traditionelleren Ansätzen der internationalen Beziehungen, wie Realismus, Liberalismus und Funktionalismus. Diese Ansätze neigen dazu, sich auf materielle Strukturen und staatliche Interessen als Hauptdeterminanten des internationalen Verhaltens zu konzentrieren. Der Konstruktivismus betont jedoch die Bedeutung von Ideen, Normen und Identitäten bei der Strukturierung der internationalen Politik. Er legt nahe, dass die Interessen und Identitäten von Staaten durch ihre Überzeugungen und ihre Interaktionen mit anderen Akteuren geprägt werden. Somit ist das internationale Verhalten nicht einfach das Produkt struktureller Zwänge oder materieller Interessenkalküle, sondern wird auch von sozialen und ideologischen Faktoren beeinflusst. Darüber hinaus bestreitet der Konstruktivismus die Vorstellung, dass internationale Politik in Form von starren Systemen oder funktionalistischen Modellen verstanden werden kann. Stattdessen sieht er die internationale Welt als sich ständig verändernd, geformt durch dynamische Prozesse der Interaktion und der sozialen Konstruktion. In diesem Sinne bietet der Konstruktivismus eine differenziertere und komplexere Perspektive auf die internationale Politik, die der Vielfalt der Akteure, Ideen und Prozesse, die die Welt gestalten, Rechnung trägt. Diese Perspektive ist besonders nützlich, um die zeitgenössischen Herausforderungen der internationalen Beziehungen wie Multilateralismus, Menschenrechte, Klimawandel und Global Governance zu verstehen.
Konstruktivistische Theorien stellen die Vorstellung in Frage, dass es objektive Realitäten oder feste Strukturen in den internationalen Beziehungen gibt, wie z. B. das Konzept der Anarchie. Sie argumentieren, dass diese Konzepte in Wirklichkeit soziale Konstrukte sind, die durch unsere Überzeugungen, Normen und Interaktionen geprägt werden. Anarchie wird beispielsweise in realistischen Theorien häufig als grundlegendes Merkmal des internationalen Systems dargestellt, in dem es keine zentrale Autorität gibt, die Regeln aufstellt oder das Verhalten von Staaten reguliert. Konstruktivisten stellen diese Vorstellung jedoch in Frage und legen nahe, dass die Anarchie selbst ein soziales Konstrukt ist. Sie ist keine objektive Realität, sondern eine Wahrnehmung oder Interpretation der Realität, die durch unsere Überzeugungen und Interaktionen geprägt wird. Darüber hinaus argumentieren Konstruktivisten, dass es selbst in Abwesenheit einer zentralen Autorität internationale Normen, Regeln und Institutionen gibt, die das Verhalten von Staaten beeinflussen. Diese Normen und Institutionen sind nicht einfach das Produkt materieller Interessenkalküle, sondern werden auch durch soziale Konstruktionsprozesse geformt. Somit bietet der Konstruktivismus eine differenziertere und dynamischere Perspektive auf die internationalen Beziehungen, die die Vielfalt der Akteure und Prozesse berücksichtigt, die die Welt gestalten. Außerdem bietet er Werkzeuge, um komplexe Phänomene wie Konflikte, Kooperation, sozialen Wandel und den Aufbau der internationalen Ordnung zu analysieren und zu verstehen.
Der Konstruktivismus stellt die realistische Vorstellung von Anarchie als natürlichem Zustand des internationalen Systems in Frage. Für Konstruktivisten ist Anarchie kein fester oder vorsozialer Zustand, sondern ein Konstrukt, das aus den Interaktionen zwischen internationalen Akteuren hervorgeht. Mit anderen Worten: Anarchie ist nicht gegeben, sondern eine konstruierte Realität. Staaten sind nicht einfach in ein anarchisches Umfeld eingebettet; sie tragen durch ihre Interaktionen, Normen und Überzeugungen aktiv dazu bei, diesen Zustand zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Die Beziehungen zwischen Staaten werden nicht einfach durch den Wunsch nach Macht oder die Angst vor Unsicherheit bestimmt, sondern auch durch soziale, kulturelle und ideologische Faktoren geformt. Darüber hinaus erkennt der Konstruktivismus an, dass Staaten nicht die einzigen relevanten Akteure in den internationalen Beziehungen sind. Auch andere Akteure, wie internationale Organisationen, NGOs, soziale Bewegungen und sogar Einzelpersonen, können eine wichtige Rolle spielen. Ihr Einfluss beschränkt sich nicht auf ihre materielle Macht, sondern kann auch durch ihre Fähigkeit bestimmt werden, die Normen, Ideen und Überzeugungen zu prägen, die dem internationalen System zugrunde liegen. Aus dieser Perspektive kann sich die Analyse der internationalen Beziehungen nicht auf die Untersuchung der Machtverhältnisse zwischen den Staaten beschränken. Sie muss auch die sozialen und kulturellen Prozesse, die diese Beziehungen prägen, und die Strukturen, in die sie eingebettet sind, berücksichtigen.
Im Bereich der internationalen Beziehungen tauchen konstruktivistische Theorien auf: Sie gehen von der Realität der Strukturen und Konflikte aus und denken auch über Intersubjektivität nach, d. h. über die Tatsache, dass wir uns in der Darstellung befinden und wie es sich bestimmte Länder erlauben können, ein anderes im Namen der Interpretation ihrer eigenen Entwicklung zu charakterisieren.
Der Konstruktivismus betont die Bedeutung von Normen und Ideen für die Strukturierung der internationalen Beziehungen. Die Souveränität der Staaten ist zum Beispiel ein zentrales Prinzip der internationalen Ordnung, aber sie ist keine objektive und unveränderliche Tatsache. Sie ist vielmehr ein soziales Konstrukt, das auf der gegenseitigen Anerkennung von Staaten beruht. Im konstruktivistischen Rahmen spielen internationale Normen, seien sie explizit (wie internationale Verträge und Abkommen) oder implizit (wie ungeschriebene Verhaltensnormen), eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung des Verhaltens von Staaten. Diese Normen werden nicht einfach von außen auferlegt, sondern von den Staaten verinnerlicht und als Teil ihrer Identität und ihrer Interessen übernommen. Darüber hinaus erkennt der Konstruktivismus an, dass sich diese Normen im Laufe der Zeit aufgrund der Interaktionen zwischen den internationalen Akteuren ändern können. Wenn eine Norm von einem Staat nicht eingehalten oder akzeptiert wird, kann dies Reaktionen und Verhandlungen auslösen, die schließlich zu einer Änderung der Norm führen können. Kurz gesagt: Der Konstruktivismus bietet eine dynamische und evolutionäre Perspektive auf die internationalen Beziehungen und betont die Bedeutung sozialer Prozesse und Interaktionen bei der Entstehung und Veränderung der internationalen Ordnung.
Der Konstruktivismus in den internationalen Beziehungen legt besonderen Wert auf die Bedeutung der Identitäten und Interessen der Akteure, die als durch soziale Interaktion konstruiert und nicht, wie andere Theorien nahelegen, durch die menschliche Natur oder wirtschaftliche Strukturen vorbestimmt gesehen werden. Dies bedeutet, dass Staaten (und andere Akteure) von den Normen und Ideen beeinflusst werden, die in der internationalen Gesellschaft vorherrschen, und dass sich ihre Identitäten und Interessen im Laufe der Zeit aufgrund dieser Einflüsse verändern können. Beispielsweise kann ein Staat bestimmte Normen im Bereich der Menschenrechte oder der Umweltpolitik übernehmen, weil diese in der internationalen Gemeinschaft weitgehend akzeptiert werden, und nicht, weil sie direkt in seinem wirtschaftlichen oder sicherheitspolitischen Interesse liegen. Darüber hinaus erkennt der Konstruktivismus an, dass Akteure die Fähigkeit haben, kreativ und strategisch zu handeln, um internationale Normen und Ideen zu beeinflussen. Dies kann durch Diplomatie, Überzeugungskraft, Rhetorik und andere Formen der sozialen Kommunikation geschehen. Folglich werden die internationalen Beziehungen als dynamischer Prozess der Interaktion und Verhandlung gesehen und nicht als Nullsummenspiel, das von festen und unveränderlichen nationalen Interessen bestimmt wird.
Anhänge[modifier | modifier le wikicode]
- Vers un « constructivisme tempéré ». Le constructivisme et les études européennes, SiencePo - Centre d'études européennes